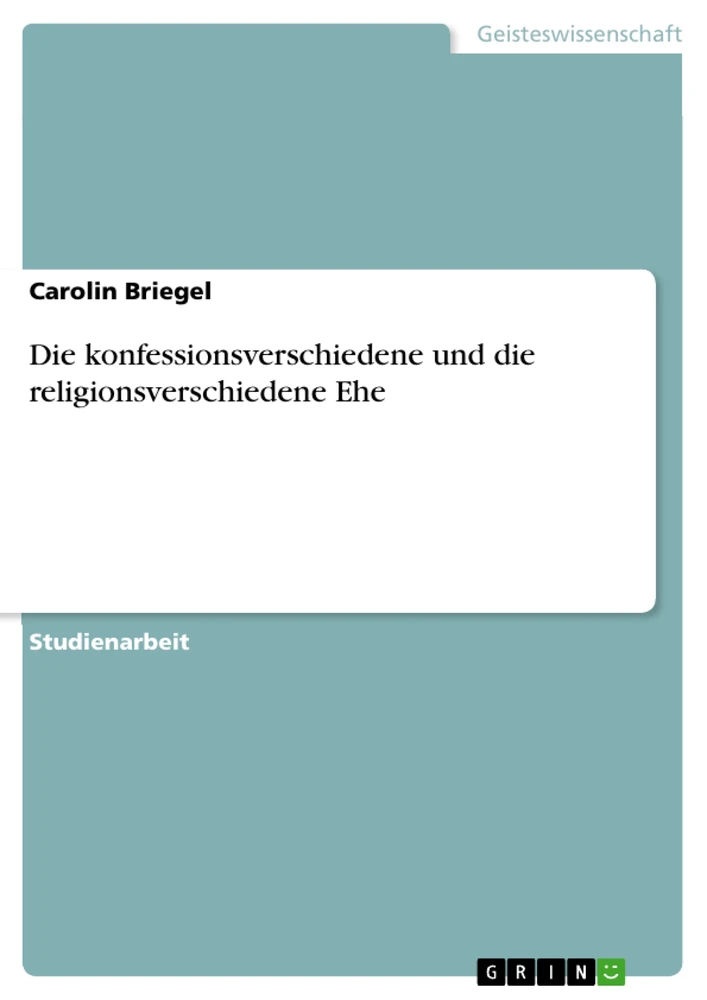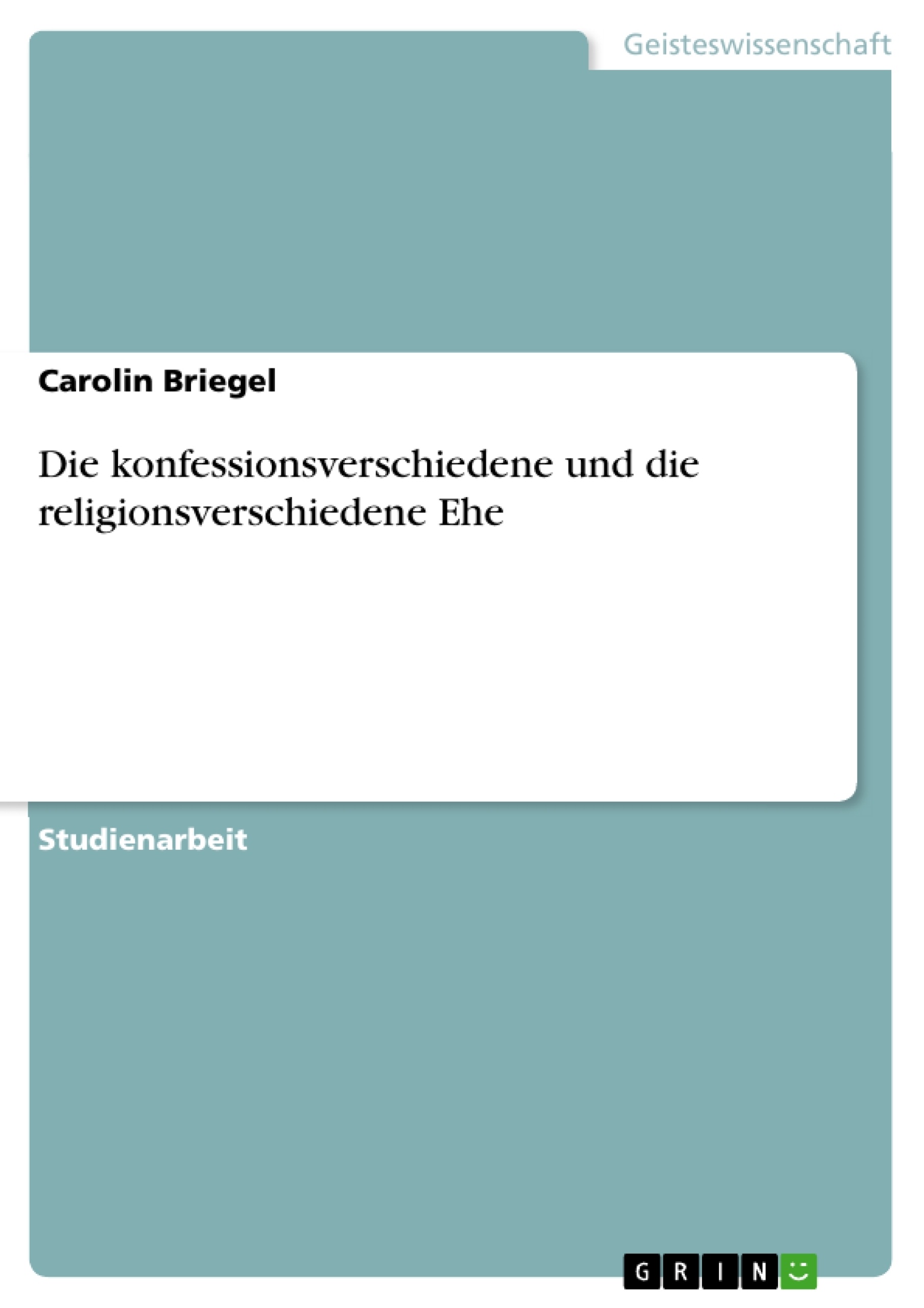„Jede dritte Ehe, die im Bereich der Bundesrepublik Deutschland geschlossen wird, wird zwischen einem katholischen und einem evangelischen Christen eingegangen“, heißt es in einem gemeinsamen Wort der Deutschen Bischofskonferenz und des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland. Globalisierung und gesellschaftlicher Umbruch führen dazu, dass Partnerschaften auch unabhängig von unterschiedlichen kulturellen Wurzeln, Konfession oder Religion eingegangen werden – ein Phänomen, das weltweit immer eminenter wird. Eine konfessions- oder gar religionsverschiedene Ehe ist daher durchaus keine Ausnahmeerscheinung mehr. Doch ist einem Katholiken die Eheschließung mit einem Partner, der nicht in voller Gemeinschaft mit der Katholischen Kirche steht überhaupt kirchenrechtlich möglich? Gilt Religionsverschiedenheit nicht als Ehehindernis und sind konfessionsverschiedene Ehen nicht sogar verboten?
Die vorliegende Hausarbeit wird versuchen auf diese Fragen hinreichende Antworten zu geben. Dabei wird zunächst der Begriff der Ehe im allgemeinen, ihre Grundsätze und Wesenseigenschaften, zu klären sein, um im folgenden deutlich zu machen, was unter den Termini „konfessionsverschiedene Ehe“ und „religionsverschiedene Ehe“ spezifisch zu verstehen ist. Danach wird die historische Entwicklung der kirchenrechtlichen Regelungen zur Mischehe dargelegt, um aus dieser sowohl die aktuelle Rechtslage, als auch abschließend mögliche ökumenische bzw. interreligiöse Perspektiven zu entwickeln. Der Schwerpunkt der Ausarbeitung wird dabei auf der konfessionsverschiedenen Ehe liegen, da dieser aufgrund des häufigeren Auftretens auch gesellschaftlich größere Eminenz zukommt und sie möglicherweise größeren Spielraum zur ökumenischen Zusammenarbeit bietet.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Ehe
- 2.1 Definition der Ehe nach CIC/1983
- 3. Die konfessionsverschiedene Ehe
- 3.1 Begriffsdefinition
- 3.2 Die Problematik
- 3.3 Historische Entwicklung der Rechtlichen Regelungen
- 3.3.1 Rechtliche Regelung im CIC von 1917
- 3.3.2 Die Reform des Mischehenrechtes
- 3.4 Rechtslage nach dem CIC von 1983
- 4. Die religionsverschiedene Ehe
- 4.1 Begriffsdefinition
- 4.2 Rechtslage nach dem CIC von 1983
- 5. Ökumenische und interreligiöse Perspektiven im katholischen Eherecht
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die kirchenrechtliche Behandlung konfessionsverschiedener und religionsverschiedener Ehen im katholischen Kontext. Ziel ist es, die rechtliche Möglichkeit der Eheschließung eines Katholiken mit einem nicht-katholischen Partner zu klären und die historische Entwicklung sowie die aktuelle Rechtslage darzustellen. Zusätzlich werden ökumenische und interreligiöse Perspektiven betrachtet.
- Definition und Wesen der Ehe im katholischen Kirchenrecht
- Begriffsbestimmung konfessionsverschiedener und religionsverschiedener Ehen
- Historische Entwicklung der rechtlichen Regelungen zu Mischehen
- Aktuelle Rechtslage im CIC von 1983
- Ökumenische und interreligiöse Perspektiven im katholischen Eherecht
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas heraus, indem sie auf die hohe Anzahl konfessionsverschiedener Ehen in Deutschland und den globalen Trend zu Partnerschaften über konfessionelle und religiöse Grenzen hinweg hinweist. Die Arbeit kündigt die Klärung des Ehebegriffs, die Unterscheidung zwischen konfessionsverschiedener und religionsverschiedener Ehe sowie die Darstellung der historischen und aktuellen Rechtslage an. Der Fokus liegt auf der konfessionsverschiedenen Ehe aufgrund ihrer größeren gesellschaftlichen Bedeutung und ihres Potenzials für ökumenische Zusammenarbeit.
2. Die Ehe: Dieses Kapitel definiert den Ehebegriff nach dem Codex Iuris Canonici von 1983 (CIC/1983). Es beschreibt die Ehe als einen Bund zwischen Mann und Frau, der auf die Gemeinschaft des ganzen Lebens, das Wohl der Ehegatten und die Zeugung und Erziehung von Nachkommen ausgerichtet ist. Die Ehe wird als Sakrament und Vertrag dargestellt, wobei der Konsens der Partner als Grundlage gilt. Die Formvorschriften der katholischen Ehe und die Wesenseigenschaften Einheit und Unauflöslichkeit werden ebenfalls erläutert.
3. Die konfessionsverschiedene Ehe: Dieses Kapitel beleuchtet den Begriff der konfessionsverschiedenen Ehe, ihre Problematik und ihre historische Entwicklung. Es differenziert zwischen dem ursprünglichen Verständnis von „matrimonium mixtum“ und der aktuellen Definition im CIC/1983. Die historische Entwicklung wird im Kontext der rechtlichen Regelungen im CIC von 1917 und der Reform des Mischehenrechts diskutiert. Der Abschnitt beschreibt die Rechtslage nach dem CIC von 1983, differenziert zwischen getauften und ungetauchten Partnern und erörtert die damit verbundenen Regelungen.
4. Die religionsverschiedene Ehe: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition und Rechtslage der religionsverschiedenen Ehe nach dem CIC/1983. Es wird die Unterscheidung zur konfessionsverschiedenen Ehe präzisiert und die spezifischen kirchenrechtlichen Aspekte einer Ehe zwischen einem Katholiken und einem nicht-getauften Partner behandelt. Die rechtlichen Regelungen und ihre Implikationen für die Eheschließung und das Leben der Ehepartner werden erläutert.
Schlüsselwörter
Katholisches Kirchenrecht, Ehe, Konfessionsverschiedene Ehe, Religionsverschiedene Ehe, CIC/1983, Matrimonium mixtum, Ökumene, Interreligiöser Dialog, Sakrament, Vertrag, Konsens, Mischehenrecht, historische Entwicklung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Konfessionsverschiedene und religionsverschiedene Ehen im katholischen Kirchenrecht
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die kirchenrechtliche Behandlung konfessionsverschiedener und religionsverschiedener Ehen im katholischen Kontext. Sie klärt die rechtliche Möglichkeit der Eheschließung eines Katholiken mit einem nicht-katholischen Partner, stellt die historische Entwicklung und die aktuelle Rechtslage dar und betrachtet ökumenische und interreligiöse Perspektiven.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition und Wesen der Ehe im katholischen Kirchenrecht, Begriffsbestimmung konfessionsverschiedener und religionsverschiedener Ehen, historische Entwicklung der rechtlichen Regelungen zu Mischehen, aktuelle Rechtslage im Codex Iuris Canonici von 1983 (CIC/1983), und ökumenische sowie interreligiöse Perspektiven im katholischen Eherecht.
Wie ist die Hausarbeit strukturiert?
Die Hausarbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Die Ehe (inkl. Definition nach CIC/1983), Die konfessionsverschiedene Ehe (inkl. historischer Entwicklung und Rechtslage nach CIC/1983), Die religionsverschiedene Ehe (inkl. Rechtslage nach CIC/1983), und Ökumenische und interreligiöse Perspektiven im katholischen Eherecht. Zusätzlich enthält sie ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten und Schlüsselwörter.
Was ist der Unterschied zwischen einer konfessionsverschiedenen und einer religionsverschiedenen Ehe?
Die Hausarbeit differenziert zwischen diesen Begriffen. Konfessionsverschiedene Ehen bezeichnen Ehen zwischen Partnern verschiedener christlicher Konfessionen. Religionsverschiedene Ehen hingegen betreffen Ehen zwischen einem Katholiken und einem Partner einer nicht-christlichen Religion oder ohne religiöse Zugehörigkeit.
Wie wird die Ehe im katholischen Kirchenrecht definiert?
Die Hausarbeit definiert die Ehe nach dem CIC/1983 als einen Bund zwischen Mann und Frau, der auf die Gemeinschaft des ganzen Lebens, das Wohl der Ehegatten und die Zeugung und Erziehung von Nachkommen ausgerichtet ist. Sie wird als Sakrament und Vertrag dargestellt, wobei der Konsens der Partner als Grundlage gilt. Einheit und Unauflöslichkeit sind Wesenseigenschaften.
Welche historische Entwicklung wird bezüglich des Mischehenrechts dargestellt?
Die Hausarbeit beleuchtet die historische Entwicklung des Mischehenrechts, insbesondere die rechtlichen Regelungen im CIC von 1917 und die anschließende Reform. Der Fokus liegt auf der Veränderung des Verständnisses von „matrimonium mixtum“ und der aktuellen Definition im CIC/1983.
Welche Rechtslage besteht nach dem CIC/1983 für konfessionsverschiedene und religionsverschiedene Ehen?
Die Hausarbeit beschreibt detailliert die Rechtslage nach dem CIC/1983 für beide Eheformen. Sie differenziert zwischen getauften und ungetauchten Partnern und erläutert die damit verbundenen Regelungen und Implikationen für die Eheschließung und das Leben der Ehepartner.
Welche ökumenischen und interreligiösen Perspektiven werden betrachtet?
Die Hausarbeit widmet sich ökumenischen und interreligiösen Perspektiven im katholischen Eherecht, indem sie den gesellschaftlichen Kontext und das Potential für Zusammenarbeit in diesem Bereich beleuchtet.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Hausarbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Katholisches Kirchenrecht, Ehe, Konfessionsverschiedene Ehe, Religionsverschiedene Ehe, CIC/1983, Matrimonium mixtum, Ökumene, Interreligiöser Dialog, Sakrament, Vertrag, Konsens, Mischehenrecht, historische Entwicklung.
- Quote paper
- Carolin Briegel (Author), 2010, Die konfessionsverschiedene und die religionsverschiedene Ehe, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/155909