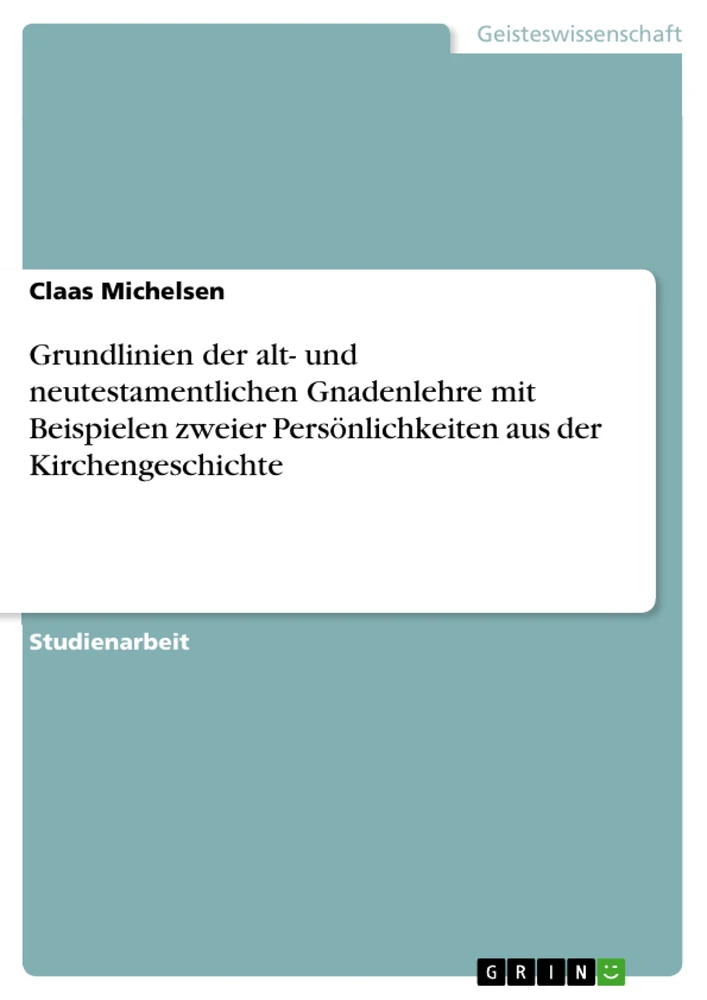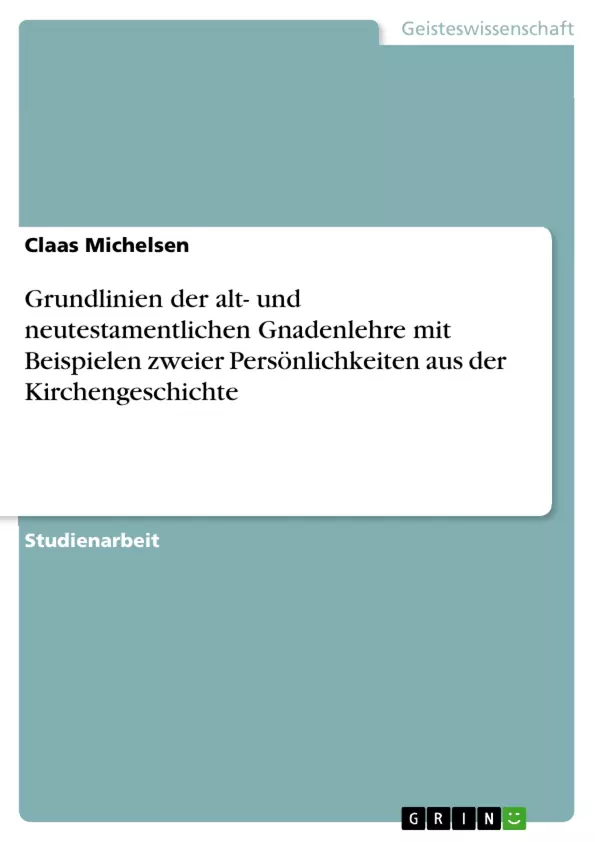Die vorliegende Arbeit zeigt die Grundlinien der alt- und neutestamentlichen Gnadenlehre auf und erläutert am Beispiel zweier Persönlichkeiten der Kirchengeschichte wie das biblische Zeugnis aufgegriffen und fruchtbar gemacht wurde. Dazu werden zunächst im zweiten Kapitel die Grundlinien der alt- und neutestamentlichen Gnadenlehre vorgestellt. Im dritten Kapitel werden Rezeption und Interpretation der Gnadentheologie durch Augustinus und Martin Luther erarbeitet. In diesem Zusammenhang wird auch auf das Konzil von Trient Bezug genommen. Die Arbeit schließt mit einem kurzen Resümee der erarbeiteten Inhalte im vierten Kapitel.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Grundlinien der alt- und neutestamentlichen Gnadentheologie
2.1 Grundlinien des Alten Testaments
2.2 Grundlinien des Neuen Testaments
3. Schwerpunkte und Auslegung der Gnadentheologie durch Persön-lichkeiten der Kirchengeschichte
3.1 Augustinus
3.2 Martin Luther
3.3 Das Konzil von Trient (1545-1563)
4. Schluss
Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Im Shin-Buddhismus - der sogenannten Schule des Reinen Landes - spricht man von der eigenen Kraft und der anderen Kraft.1 Gnadenelemente sind eine absolute Ausnahme im Buddhismus. Trotzdem zeigt dieses Beispiel sehr tref-fend, dass Gnade nicht bedeutet, von Almosen einer übernatürlichen Instanz zu leben, sondern dass dem Menschen grundsätzlich eine gewisse Handlungsfrei-heit geschenkt wurde, er aber durch die Faktoren Wissen, Energieressourcen und Lebensdauer in seiner Handlungsfähigkeit eingeschränkt ist. Und es zeigt, dass sich auch in anderen Kulturkreisen die Gewissheit herausgebildet hat, dass es noch eine andere Kraft geben muss, die über die natürlichen Begrenzungen des Menschen hinausgeht.
Im Gegensatz zum Buddhismus ist Gnade ein wesentliches Element des Chris-tentums. Auch wenn wir - zumindest regional - im christlichen Abendland leben, so hat die Theologie der Gnade in der Postmoderne einen schweren Stand. Nicht selten wird sie als billiger Trost interpretiert, der die Menschen passiv und weiner-lich werden lässt, anstatt ihre Ressourcen zu mobilisieren.2 Gnade scheint in der aktuellen Zeit einfach keinen Platz zu haben. Zumindest auf den ersten Blick.
Das postmoderne Lebensgefühl ist allerdings nicht ausschließlich durch Freiheit, Pluralität und Selbstbestimmung geprägt, sondern wird auch wesentlich durch östliche Religionen beeinflusst, in denen ein gewisses intuitives Gelenktwerden im Sinne eines go with the flow prägend ist. Und so ist die christliche Gnadenleh-re möglicherweise besser mit der postmodernen Transkulturalität verein- bar als es auf den ersten Blick scheint.3
Die vorliegende Arbeit zeigt die Grundlinien der alt- und neutestamentlichen Gnadentheologie auf und erläutert am Beispiel zweier Persönlichkeiten der Kir-chengeschichte wie das biblische Zeugnis aufgegriffen und fruchtbar gemacht wurde. Dazu werden zunächst im zweiten Kapitel die Grundlinien der alt- und neutestamentlichen Gnadenlehre vorgestellt. Im dritten Kapitel werden Re-zeption und Interpretation der Gnadentheologie durch Augustinus und Martin Lu-ther erarbeitet. In diesem Zusammenhang wird auch auf das Konzil von Trient Bezug genommen. Die Arbeit schließt mit einem kurzen Resümee der erarbeite-ten In- halte im vierten Kapitel.
2. Grundlinien der alt- und neutestamentlichen Gnadentheologie
2.1 Grundlinien des Alten Testaments
Schon im biblischen Sprachgebrauch hat das Wort Gnade ein sehr weites Be-deutungsfeld: Es reicht von Güte, über Huld, Gunsterweisung, Gerechtigkeit bis hin zur Vorstellung des Beschenktwerdens und des absolut folgerichtigen Ge-schehens, dass in seiner Logik aber nur über Gott erklärt werden kann. Die ur-sprüngliche Wortschöpfung ist nur schwierig auf einen einzigen Begriff oder ei-nen einzigen Wortstamm zurückzuführen. Das Alte Testament enthält Formen von Gnadenerzählungen oder solcher Texte, die zum Nachdenken über das Thema Gnade im weitesten Sinne anregen möchten. JHWH ist hierbei die einzi-ge Quelle der Gnadengewährung in jeglicher Form. JHWH begleitet Mose und sein Volk während der gesamten Zeit des Exodus - unabhängig davon, ob das Volk sich seinem Schöpfer verbunden fühlt oder nicht. JHWH stellt aber nicht den Zufall oder einen Despoten dar, der nach Lust und Laune belohnt oder bestraft, vielmehr ist JHWH das Element des Unerwartbaren. Unerwartbar, aber doch - wie schon der antike Logos - einer eigenen Logik und universalen Gerechtigkeit folgend.
Eine entscheidende Grundlinie der alttestamentlichen Gnadenlehre ist die An-nahme, dass Gott (in der Folge synonym zu JHWH) Gnade und Erbarmen grundsätzlich frei gewährt und der Mensch keinen freien Zugriff auf das Gnaden-geschehen im Sinne einer nutzbaren Ressource haben kann. Gnade wird als ein Beziehungsgeschehen zwischen Gott und Israel gesehen, Gott selbst bleibt je-doch stets der Souverän, der frei und selbstbestimmt die Beziehung zum Men-schen aufnimmt. Vor diesem Hintergrund sind alle entscheidenden Ereignisse in der Geschichte des Gottesvolkes auf die bewusste Zuwendung Gottes zu seinem Volk zurückzuführen.4 Selbst die Bereitschaft zur Umkehr, ein prägender Begriff christlichen Glaubens, kann ausschließ durch die Zuwendung Gottes erfolgen, nicht etwa durch eigene Kraft oder eigenes Bemühen.5
Gott ist im Sinne des Alten Testaments kein Richter, der nach festgelegten Krite-rien über Schuld und Unschuld entscheidet und richtet. Vielmehr setzt er den Menschen unverdientermaßen in ein neues Verhältnis zu sich selbst, sodass sich in der Wechselbeziehung zwischen Gott und Mensch ein segenreiches Leben entfalten kann. Das Ideal der Parteilosigkeit, die sich schon bei Homer in der griechischen Literatur herausbildete, wird zum Wohle des Menschen - in Ver-trauen auf Gottes Gerechtigkeit - verschoben.6
Soweit die Darstellung aus dem Alten Testament als geschlossene Einheit. Be-trachtet man die Gnadentheologie des Alten Testaments vor dem Hintergrund des Neuen Testaments, so kann ein wesentlicher Aspekt darin gesehen werden, dass Gott selbst - zur Zeit des Alten Testaments - kein eigenes Opfer gebracht hat.
2.2 Grundlinien des Neuen Testaments
Auch im Neuen Testament ist Gnade ein Beziehungsgeschehen zwischen Gott und den Menschen. In der Theologie des christlichen Ostens ist es in erster Linie der Heilige Geist, der vom Menschen empfangen werden kann und den Men-schen auf einen Weg der Vergöttlichung führt. In einer Art Erziehungsprozess wird der Mensch dem Ebenbild Gottes zunehmend ähnlicher. Bezugnehmend auf Röm 10,13 kann sogar ein gewisser Einfluss des Menschen auf das Gnadenge-schehen unterstellt werden: „Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden“.
Die Theologie des christlichen Westens hingegen nimmt ihren Ausgangspunkt am Kreuz Christi. Gott gibt der Menschheit seinen Sohn Jesus Christus und er-löst die Menschheit somit aus der Knechtschaft der Sünde. Gott macht mit dem Leben und Sterben Jesu ein konkretes und unzweifelhaftes Angebot der Freund-schaft an die Menschen. Gott ist bereit, alles zu geben und alles zu verzeihen. Das Reich Gottes steht den Menschen als dauerhaftes und verbindliches Ange-bot zur Verfügung. Allerdings sind mit diesem Angebot und diesem Versprechen auch radikale Forderungen verbunden: Der Mensch soll umkehren und an das Evangelium glauben.7 Aber nicht erst das Opfer am Kreuz zeigt die Bedingungs-losigkeit der neutestamentlichen Gnadentheologie auf. Schon das Wirken Jesu zu Lebenszeiten war und ist Herausforderung und Provokation; für den einzelnen Menschen, für Regierungen und Institutionen. Die Unfähigkeit und die Angst vie-ler Menschen, sich auf radikal Neues einzulassen, darf sicherlich als ein Aspekt gesehen werden, der schließlich zur Hinrichtung am Kreuz geführt hat.
Unter Bezug auf Paulus wird deutlich, dass auch aus Sicht des Neuen Testa-ments das Geschenk der Gnade frei und unverdient gegeben wird. Zudem formu-liert Paulus einen Sündenbegriff, der sich von rein moralisierenden Aspekten ab-hebt: In Sünde lebt, wer sich von Gott abwendet, sich seinem Angebot der Freundschaft verweigert. Ohne Gott wird der Mensch ganz und gar auf sich selbst zurückgeworfen.8 Während die Unfähigkeit oder der Unwille vieler Men-schen, sich auf neue Sinnzusammenhänge einzulassen, heute genauso beo-bachtet werden kann wie zu biblischen Zeiten, ist auch der Sündenbegriff des Paulus - und damit die gesamte Neutestamentliche Gnadentheologie - überra-schend aktuell. Der jüdische Psychiater Viktor E. Frankl sieht eine Art Sinnfrustra-tion als Ursache vieler persönlicher Krisen unserer Zeit. Wenn sich der Mensch nur dem Materiellem zuwendet, und den Über-Sinn verliert - der fast ausschließ-lich im Religiösen gefunden werden kann - gerät er über kurz oder lang in erheb-liche seelische Bedrängnis.9 Der Sühnetod Jesu - als Grundline der neutesta- mentlichen Gnadentheologie - ist das immerwährende Angebot eines Über-Sinnes Gottes an den Menschen. Das vom Verfasser gemutmaßte fehlende Op-fer Gottes im Alten Testament erfolgt nun in Form eines Geschenkes Gottes an die Menschen: Gott opfert seinen Sohn und das ausdrücklich zum Wohle alle Menschen.
3. Schwerpunkte und Auslegung der Gnadentheologie durch Persönlich-keiten der Kirchengeschichte
3.1 Augustinus
Verschiedene Persönlichkeiten der Kirchengeschichte sehen eine gewisse Flexi-bilität bzw. ein gewisses Zusammenspiel im Gnadengeschehen zwischen dem freien Willen des Menschen einerseits und der Zuwendung Gottes zum Men-schen andererseits. Im christlichen Osten findet sich bis heute ein Synergismus, der dem Mitwirken des Menschen eine nicht unbeträchtliche Bedeutung zumisst. Auch Johannes Cassian, der die Erfahrungen der sogenannten Wüstenväter dem christlichen Westen zugänglich macht, weiß um den Aktiven Einsatz der Mönche zur Erlangung des Gnadenbeistand Gottes. Auch Origenes stellt das Miteinander von Gott und Mensch anschaulich dar. Erst Augustinus widerspricht mit seiner Theologie deutlich der Selbsterfahrung und dem freien Willen des Menschen. Vielmehr verhält es sich bei Augustinus so, dass die Freiheit der ei-genen Entscheidung und die Entscheidung zur Umkehr eine Folge der göttlichen Gnade ist. Diese radikale Unterstellung beruht auf der genauso radikalen Erb-sündenlehre des Augustinus. Die Erbsünde hat alle Menschen von Anfang an in die Sünde einbezogen, sodass sie nicht Fähig sind, das Gute zu wollen. Der freie Wille des Menschen ist unter der Knechtschaft des Bösen zunichte gemacht wor- den.10
Das Wesen der Sünde besteht für Augustinus im Bruch des Verhältnisses zwi-schen dem Menschen und Gott. Das Ergebnis dieses Bruches sind Unfreiheit, Zerrissenheit und Tod. Augustinus unterscheidet hierbei zwischen der Ursünde Adams, der aus freier Entscheidung den Bruch mit Gott vollzogen hat und der Erbsünde, die allen auf Adam folgenden Menschen die Möglichkeit zur freien Entscheidung für Gott abspricht. Die Synode von Karthago kommt zu dem Er-gebnis, dass die Freiheit des Menschen von der Erbsünde geprägt ist und bestä-tigt im Wesentlichen die Aussagen Augustinus.11
Für Augustinus gibt es - zumindest auf den ersten Blick - keinen Konflikt zwi-schen dem von ihm vertretenem Neuplatonismus und seiner Zuwendung zum christlichen Glauben. Tatsächlich weicht er aber insbesondere in Bezug auf seine Gnadentheologie vom Primat der Vernunft ab. Nach und nach erkennt er die Au-torität Gottes an und gelangt zu der Überzeugung, dass die Autorität - die Gnade - zeitlich der Vernunft vorausgehen muss. Er geht in seinen Annahmen sogar soweit, dass die reine Vernunft allmählich überflüssig werden könnte. Ein aus seiner Sicht wesentlicher Vorzug, der den antiken Philosophien verschlossen bleibt. Die fehlende Demut der Platoniker macht Augustinus dafür verantwortlich, dass diese nicht in der Lage sind, die Autorität zur erkennen, die Voraussetzung für alles tugendhafte Handeln sein musste.12
Augustinus Schriften zeigen seinen allmählichen Wandel vom theoretischen Phi-losophen hin zum praktisch begabten Prediger und Kirchenlehrer. Mehr und mehr verfolgt Augustinus die Absicht, seine Erkenntnisse zu verbreiten und ei-nem breiten Publikum zugänglich zu machen; ausdrücklich auch einfachen Men-schen mit fehlender oder mangelnder theologischer und formaler Bildung. Die mündlichen Bekehrungen gewinnen immer mehr an Wichtigkeit. Zugleich rückt Augustinus von einer theoretischen Beschäftigung mit Lebensfragen ab und kommt zu der Überzeugung, der Mensch solle sich für die lebenspraktischen Belange in der Gemeinschaft einsetzen. Die vita activa wird zum Lebenskon- zept.13
Die Gnadenlehre des Augustinus bildet gewissermaßen die Grundlage seines theologischen Denkens. Sie mag radikal und kompromisslos erscheinen, trotz-dem beschäftigt sie bis heute Theologen, Wissenschaftler und Gläubige gleich-ermaßen. Eine mögliche Erklärung für dieses Phänomen kann in der Integrität seiner Biographie in Theorie und Praxis gesehen werden: Als weltlicher Gelehrter erkennt er für sich die Sinnlosigkeit seiner Existenz und begibt sich auf einen ge-nauso radikalen wie dramatischen Weg der Umkehr. Seine Zuwendung zum Christentum erlebt Augustinus als heilvolle und unverdiente Wende. Diese Erfah-rung macht er zur Grundlinie seiner Gnadentheologie.
3.2 Martin Luther
„Nur der Glaube zählt. Und glauben heißt gerecht gemacht werden.“14 Mit diesen kurzen Sätzen beschreibt Norbert Bolz sehr treffend die Gnadentheologie des Martin Luther.
Luther bahnt mit seiner Erfahrung und mit seiner daraus formulierten Theologie den Weg in die Neuzeit. Insbesondere der Ablasshandel der damaligen Zeit ver-mittelt den Eindruck, Gnade könne in irgendeiner Weise verdient oder erarbeitet werden. Dass hinter solchen Praktiken weniger theologische Erwägungen ste-hen, sondern vor allem finanzielle Interessen, kann in der historischen Rück-schau als einer der großen Irrwege der Kirche erkannt und verworfen werden. Luther zieht mit seiner neuen Gnadenlehre einen Schlußstrich unter alle Entwür-fe, die eine aktive Beteiligung des Menschen unterstellen. Nicht nur der Ablass-handel, auch die Scholastik weist Luther in diesem Punkt energisch zurück. Der Mensch ist zwar in der Lage, seine Sündhaftigkeit und seine Erlösungsbedürftig-keit zu erkennen, jedoch nicht diesen Zustand zu beheben. Christus allein ist der Weg zur Erlösung. Luther greift dabei auf die Vorstellung des stellvertretenden Strafleidens Jesu zurück: Jesus ist - obwohl er als einziger das Gesetz Gottes vollkommen erfüllt hat - für unsere Sünden am Kreuz gestorben. Genau an die-ser Stelle kommt es zum offensichtlichen theologischen Bruch mit der Katholi-schen Kirche.15
Luther und Augustinus haben gemeinsam, dass sie von der Alleinwirksamkeit Gottes ausgehen. Gott allein tut alles, unser Wille kann nichts tun (es sei denn, Gott möchte es so). Für Luther geschieht alles durch Gott und seinem Wirken kann weder zugearbeitet noch Widerstand geleistet werden. Bemerkenswert ist bei Luther, dass er davon ausgeht, dass Gott grundsätzlich zum Guten im Men-schen wirkt. Der Mensch darf also darauf vertrauen, dass - was immer Gott ver-fügt - zum Wohle des Menschen geschieht, auch wenn der Mensch die komple-xen Zusammenhänge und das Heilsgeschehen nicht immer mit seinem Verstand erfassen kann. Glaube bedeutet daher das Vertrauen zu haben, dass Gott es gut und richtig macht.16 Luthers theologisches Denken ist unverhandelbar christo- zentrisch. Es ist daher konsequent, dass auch seine Gnadenlehre ganz im Zei-chen des Solus Christus steht.17
Der interessierte Laie wäre bei einer spontanen Gegenüberstellung von Augusti-nus und Luther möglicherweise geneigt, beide Persönlichkeiten als Gegensätze in Bezug auf ihre jeweilige Theologie einzustufen. Zu unterschiedlich sind die As-soziationen, die möglicherweise entstehen, sobald beide Namen genannt wer-den. Tatsächlich ist es aber gerade Luthers radikale Rückkehr zu Augustinus, die schlussendlich zum theologischen Konflikt führt.
Aus der Sicht eines Gläubigen können die Lehren Luthers und Augustinus in Be-zug auf das Gnadengeschehen als eine befreiende Wende, weg von der Selbst-bezogenheit und hin zum Gottvertrauen gesehen werden. Andererseits ist es ge-rade der Protestantismus gewesen, der Individualität, Selbstbezogenheit und Leistungsdenken gefördert und bis in die Postmoderne wirksam gemacht hat. Ein theoretischer und praktischer Konflikt, der sicherlich auch zunehmend für gläubi-ge Christen relevant ist.
3.3 Das Konzil von Trient (1545-1563)
Der Verfasser hat sich bei der Auswahl der zu beschreibenden Persönlichkeiten bewusst für Augustinus und Luther entschieden, da so nicht nur gezeigt werden kann, wie das biblische Zeugnis aufgegriffen wurde, sondern auch, wie es in der Folge zu relevanten theologischen Auseinandersetzungen gekommen ist. Sicher-lich haben weder Luther und noch viel weniger Augustinus eine solche Entwick-lung absehen können, jedoch geht die Fruchtbarmachung des biblischen Zeug-nisses - dessen Beschreibung Teil des gewählten Themas werden sollte - mit dem Konzil von Trient weit über das jeweilige persönliche Wirken hinaus und mündete in ein bis heute grundlegendes Dokument der Kirchengeschichte.
Luther vertritt mit seiner Gnadenlehre einen konsequenten Augustinismus, der die Römische Kirche der damaligen Zeit vor eine große Herausforderung stellt: Augustinus doctor gratiae musste in Einklang gebracht werden mit den vorherr-schenden scholastischen Elementen, die eine Mitwirkung des Menschen unter-stellen. Das Konzil kommt zu dem Schluss, dass dem Sünder eine gewisse Ent-scheidungsfreiheit verbleibt, diese aber eben nicht ohne die zuvorkommende Gnade möglich ist. Der freie Wille des Menschen wird in dem Sinne einbezogen, dass er selbst umkehren, die durch Gnade bewusst gemachte Notwendigkeit zur Umkehr aber auch verweigern kann.18
Bis heute führen die Ergebnisse des Konzils - und die Frage, inwieweit eine möglicherweise veraltete Auffassung von Gnade den Menschen in Passivität und Schicksalsglauben verstrickt - zu Diskussionen. Die gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigung der Katholischen Kirche und des Lutherischen Weltbundes von 1999 zeigen jedoch, dass die theologischen Differenzen innerhalb des Christen-tums eher marginal sind.19
4. Schluss
Das Thema Gnadenlehre stellt sich als deutlich komplexer dar als erwartet. Nicht nur in Bezug auf die Auseinandersetzung verschiedener Schulen und Persön-lichkeiten mit dem Thema, sondern auch in Hinblick auf aktuelle theologische Diskussionen und schließlich dem Zeitgeist, der die Menschen immer in einem gewissen Maße beeinflusst. Ist Gnade ein Relikt aus der Vergangenheit, dass sich im besten Falle noch für theoretische Abhandlungen und Studienarbeiten eignet oder kann das Konzept der Gnade eine Botschaft, ja vielleicht einen Nut-zen für die Menschen der Postmoderne bieten?
Sehr wahrscheinlich liegt die Antwort in der individuellen Beurteilung des The-mas. Ist Gnade das passive akzeptieren des eigenen Schicksals, sollte der Mensch also besser - um es mit diesen Worten zu sagen - in seiner Kaste blei-ben und auf das warten, was kommt? Oder ist Gnade auch ein Geschehen, dass Ressourcen und Lebensenergien im Menschen wecken kann?
Die dargestellten Persönlichkeiten sind Leuchtfeuer des lebendigen Glaubens. Und sie zeigen, dass der Glaube die Kraft hat, Menschen zu entwickeln. Sie zei-gen, dass gelebter Glaube eine verheißungsvolle Herausforderung für den Men-schen sein kann. Vielleicht ist es ja sogar so, dass der Mensch eine gewisse Passivität braucht - ein gewisses Urvertrauen, um es tiefenpsychologisch aus-zudrücken - um seine Potenziale voll zu entfalten, aber auch um die schwersten Schicksalsschläge zu verarbeiten, die das menschliche Dasein regelmäßig mit sich bringt. Vielleicht kann auch der Mensch der Gegenwart nur bei Gott wirkliche Ruhe finden. Das Einbinden von Elementen der Akzeptanz in moderne psycho-therapeutische Konzepte könnten dieser Hypothese recht geben.
So teilen auch das Verständnis und das Erleben der Gnade im christlichen Sinne das gleiche Schicksal wie Religion insgesamt: Sie muss erfahrbar sein. Und möglicherweise kann Erfahrbarkeit nur aus gelebtem Glauben entstehen.
Literaturverzeichnis
J. Polakova, Perspektive der Hoffnung: Transzendenzsuche in der Postmoderne, Pader-born (Verlag Ferdinand Schöningh) 2005.
J. Werbick, Gnade, Paderborn (Verlag Ferdinand Schöningh) 2013.
L. Schwienhorst-Schönberger, Einleitung in das Alte Testament (LB 4), Würzburg (Theo-logie im Fernkurs/Domschule Würzburg) 2019.
M. Eckholt, Der Mensch in der Gnade Gottes (LB 13), Würzburg (Theologie im Fern- kurs/Domschule Würzburg), 2019.
N. Bolz: Zurück zu Luther, Paderborn (Verlag Wilhelm Fink), 2016.
R. Elm/M. Takayama (Hrsg.), Zukünftiges Menschsein: Ethik zwischen Ost und West, Baden-Baden (Nomos Verlagsgesellschaft) 2003.
U. Heckel et al., Luther heute: Ausstrahlung der Wittenberger Reformation, Tübin-gen (Mohr Siebeck), 2017.
U. Neumann, Augustinus, Berlin (Rowohlt eBook-Verlag) 2018.
V. E. Frankl, Ärztliche Seelsorge: Grundlagen der Logotherapie und Existenzanalyse, München (DTV), 2020
[...]
1 Vgl. R. Elm/M. Takayama, Zukünftiges Menschsein: Ethik zwischen Ost und West, Baden-Baden (Nomos Verlagsgesellschaft) 2003, S. 177-178.
2 Vgl. M. Eckholt, Der Mensch in der Gnade Gottes (LB 13), Würzburg (Theologie im Fern- kurs/Domschule Würzburg) 2019, S. 8.
3 Vgl. J. Polakova, Perspektive der Hoffnung: Transzendenzsuche in der Postmoderne, Paderborn (Verlag Ferdinand Schöningh) 2005, S. 57.
4 Vgl. M. Eckholt, Der Mensch in der Gnade Gottes (LB 13), S. 14-15.
5 Vgl. L. Schwienhorst-Schönberger, Einleitung in das Alte Testament (LB 4), Würzburg (Theologie im Fernkurs/Domschule Würzburg) 2019, S. 93.
6 Vgl. J. Werbick, Gnade, S. 32.
7 Vgl. M. Eckholt, Der Mensch in der Gnade Gottes (LB 13), S. 17-18.
8 Vgl. M. Eckholt, Der Mensch in der Gnade Gottes (LB 13), S. 19.
9 Vgl. V. E. Frankl, Ärztliche Seelsorge: Grundlagen der Logotherapie und Existenzanalyse, München (DTV), 2020, S. 72.
10 Vgl. J. Werbick, Gnade, S. 38-40.
11 Vgl. M. Eckholt, Der Mensch in der Gnade Gottes (LB 13), S. 26.
12 Vgl. U. Neumann, Augustinus, Berlin (Rowohlt eBook-Verlag) 2018, Pos. 378-379.
13 Vgl. U. Neumann, Augustinus, Pos. 851-856.
14 N. Bolz: Zurück zu Luther, Paderborn (Verlag Wilhelm Fink), 2016, S. 79.
15 Vgl. M. Eckholt, Der Mensch in der Gnade Gottes (LB 13), S. 35-36.
16 Vgl. J. Werbick, Gnade, S. 70.
17 Vgl. U. Heckel et al., Luther heute: Ausstrahlung der Wittenberger Reformation, Tübingen (Mohr Siebeck), 2017, S. 70.
18 Vgl. J. Werbick, Gnade, S. 86-87.
19 Vgl. M. Eckholt, Der Mensch in der Gnade Gottes (LB 13), S. 40.
- Arbeit zitieren
- Claas Michelsen (Autor:in), 2021, Grundlinien der alt- und neutestamentlichen Gnadenlehre mit Beispielen zweier Persönlichkeiten aus der Kirchengeschichte, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1559662