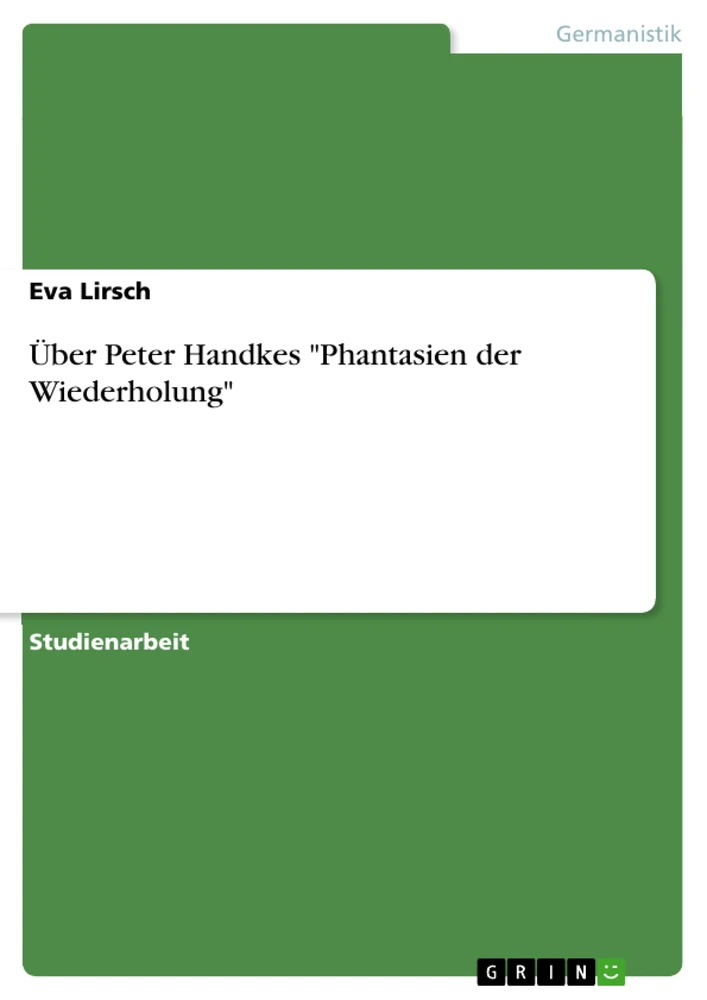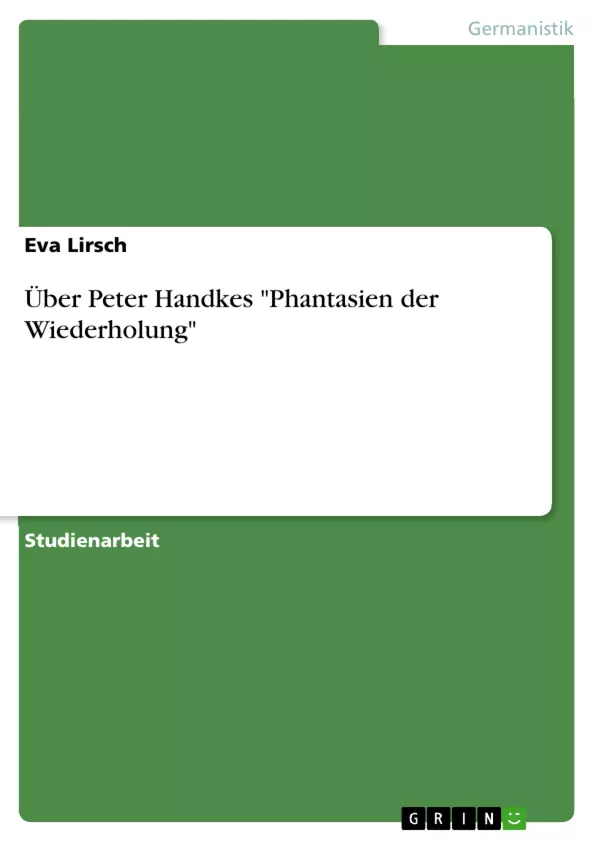Viele Kritiker schreiben Peter Handke kaum verdeckte Züge narzißtischen Größenwahns zu. Hier sei das eingetreten, was Walser so beschrieben hat: „Der Autor ist die Botschaft“ . Handke selbst vermerkt im Journal Das Gewicht der Welt in Bezugnahme auf den Mythos vom Narziß, der sich im Wasser spiegelnd, seine eigene Schönheit selbstvergessen bewundert und dabei ertrinkt:
Ob nicht vielleicht gerade das lange, ausforschende Anschauen des eigenen Spiegelbildes (und im weiteren Sinn: der von einem verfertigten Sachen) die Kraft und Offenheit zu langem, unverwandtem, sich vertiefendem Anschauen andrer geben kann?
Für ihn dient Literatur primär der Selbstreflexion, sie ist „ein Vehikel seiner Selbstbewußtwerdung. Dieser Spiegelungsvorgang fungiert als eigentlicher Kontrast Handkes zur Realität. Indem er sein Ichbewußtsein in der Literatur klärt, reflektiert er seine Beziehung zur Realität, läßt er sich von der Wirklichkeit verändern.“ Ausgehend von seinem eigenen Empfinden sucht er nach einem „Regelwerk“, um sich selbst und andere zu verstehen. Im Aufsatz „Ich bin ein Bewohner des Elfenbeinturms“ spricht er davon, daß es nur ein Thema für ihn gebe, nämlich über sich selbst klarer zu werden. Die „Wirklichkeit der Literatur steht im Dienst der Erhellung der wirklichen Wirklichkeit, die Handke als [seine] persönliche Wirklichkeit begreift.“ Literatur, die ihre (formale) Differenz zur außerliterarischen Wirklichkeit betont, erfüllt laut Handke in zweierlei Hinsicht eine bewußtseinsbildende, Ich- klärende
Funktion.
Inhaltsverzeichnis
- Subjekt und Selbsterfahrung in der Sprache
- Handke und das Sprachproblem
- Handkes „Journale“
- Das Prinzip des teilnehmenden Sehens
- Mythos und Epiphanie
- Die "Phantasien der Wiederholung"
- Nachwort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit Peter Handkes Werken und untersucht die zentrale Rolle, die die Sprache in seiner Auseinandersetzung mit der eigenen Existenz spielt. Handke erforscht die Grenzen der Sprache und die Schwierigkeiten, die sich aus dem Versuch ergeben, die eigene Erfahrung in Worte zu fassen.
- Die Suche nach Selbstfindung und Selbstverständnis durch Sprache
- Die Problematik der Identitätsstiftung in einer von Sprache geprägten Welt
- Die Grenzen und Möglichkeiten von literarischer Selbstdarstellung
- Handkes kritische Auseinandersetzung mit dem Verhältnis von Subjekt und Wirklichkeit
- Die Bedeutung von Mythos und Epiphanie in Handkes Werk
Zusammenfassung der Kapitel
Im ersten Kapitel wird Handkes Konzept von Sprache und Selbsterfahrung beleuchtet. Es wird diskutiert, wie er die Sprache als Werkzeug der Selbstreflexion nutzt, gleichzeitig aber auch an ihren Grenzen scheitert. Das zweite Kapitel widmet sich dem Sprachproblem in Handkes Werk. Dabei geht es um die Schwierigkeiten, die sich aus dem Versuch ergeben, die eigene Erfahrung in Worte zu fassen und eine eindeutige Identität zu definieren. Das dritte Kapitel befasst sich mit Handkes „Journalen“. Hier werden die verschiedenen Aspekte von Handkes Schreibweise und die Rolle des „teilnehmenden Sehens“ in seinen Texten behandelt. Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit Handkes „Phantasien der Wiederholung“, einem Werk, in dem Handke sich mit den Themen Wiederholung, Erinnerung und der Suche nach Sinn auseinandersetzt.
Schlüsselwörter
Peter Handke, Sprache, Selbstfindung, Identität, Sprachproblem, Journale, Mythos, Epiphanie, Phantasien der Wiederholung, Selbstreflexion, Wirklichkeit, literarische Selbstdarstellung, "teilnehmendes Sehen".
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielt die Literatur für Peter Handke?
Für Handke dient Literatur primär der Selbstreflexion und ist ein Vehikel seiner Selbstbewusstwerdung.
Was ist das zentrale Thema in Handkes Werk laut dem Aufsatz?
Das zentrale Thema ist es, über sich selbst klarer zu werden und die persönliche Wirklichkeit durch die Literatur zu erhellen.
Was versteht Handke unter dem "Prinzip des teilnehmenden Sehens"?
Es beschreibt eine Art des ausforschenden Anschauens, das die Kraft zur vertieften Wahrnehmung der Welt und anderer Menschen gibt.
Worum geht es in den "Phantasien der Wiederholung"?
In diesem Werk setzt sich Handke mit Themen wie Wiederholung, Erinnerung und der Suche nach Sinn auseinander.
Was wird am Verhältnis von Subjekt und Sprache problematisiert?
Untersucht wird die Schwierigkeit, die eigene Erfahrung in Worte zu fassen und die Grenzen der Sprache bei der Identitätsstiftung.
- Citation du texte
- Eva Lirsch (Auteur), 2002, Über Peter Handkes "Phantasien der Wiederholung", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/155967