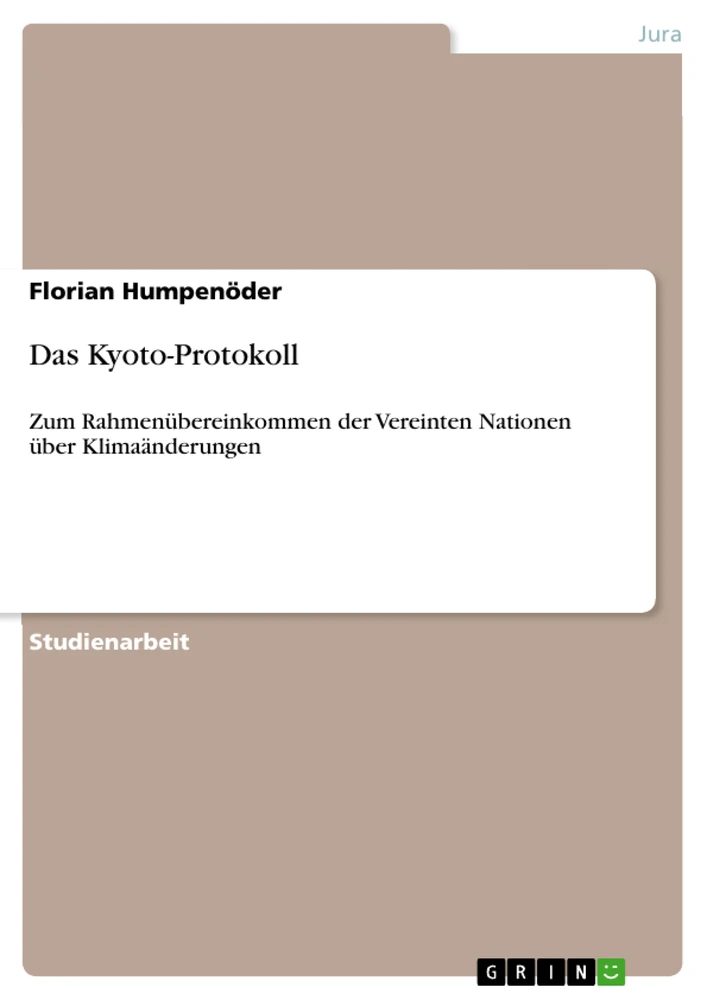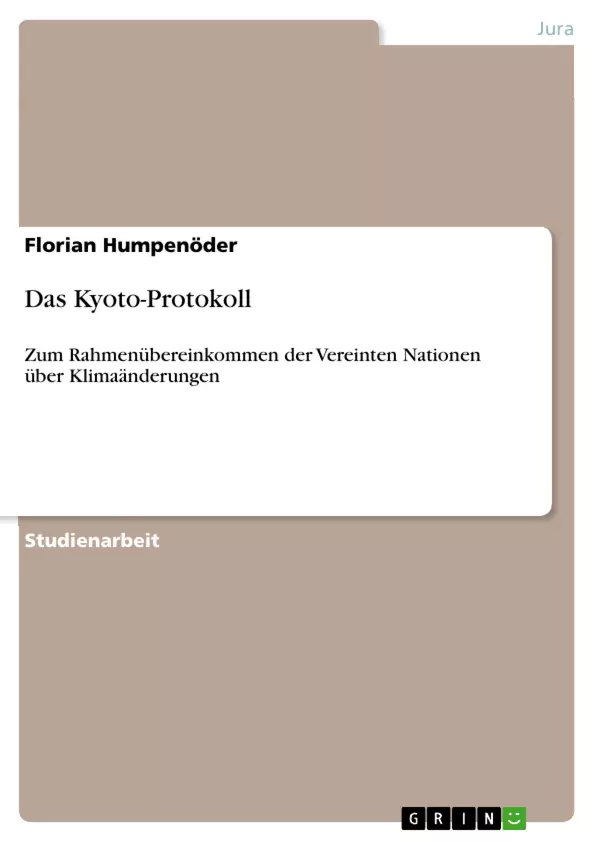In der Arbeit wird zunächst die Entstehungsgeschichte des Kyoto-Protokolls dargelegt. Anschließend werden die wesentlichen Übereinkünfte des Kyoto-Protokolls, aus juristischer Sichtweise, erläutert. Dazu gehören Reduktionsverpflichtungen und Maßnahmen, die Anrechenbarkeit von Kohlenstoffsenken, die drei flexiblen Mechanismen (Emissionshandel, Joint Implementation, Clean Development Mechanism), sowie Mittel zur Rechtsdurchsetzung. Den Abschluss bildet ein Ausblick auf die Entwicklungen im internatiolen Klimaschutzrecht.
Inhaltsverzeichnis
1 Entstehungsgeschichte
2 Wesentliche Übereinkünfte
2.1 Reduktionsverpflichtungen und Maßnahmen
2.2 Anrechnung von Senken
2.3 Flexible Mechanismen
2.3.1 Emissionshandel
2.3.2 Joint Implementation
2.3.3 Clean Development Mechanism
2.4 Rechtsdurchsetzung
3 Ausblick
Literaturverzeichnis
- Quote paper
- Florian Humpenöder (Author), 2010, Das Kyoto-Protokoll, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/155987