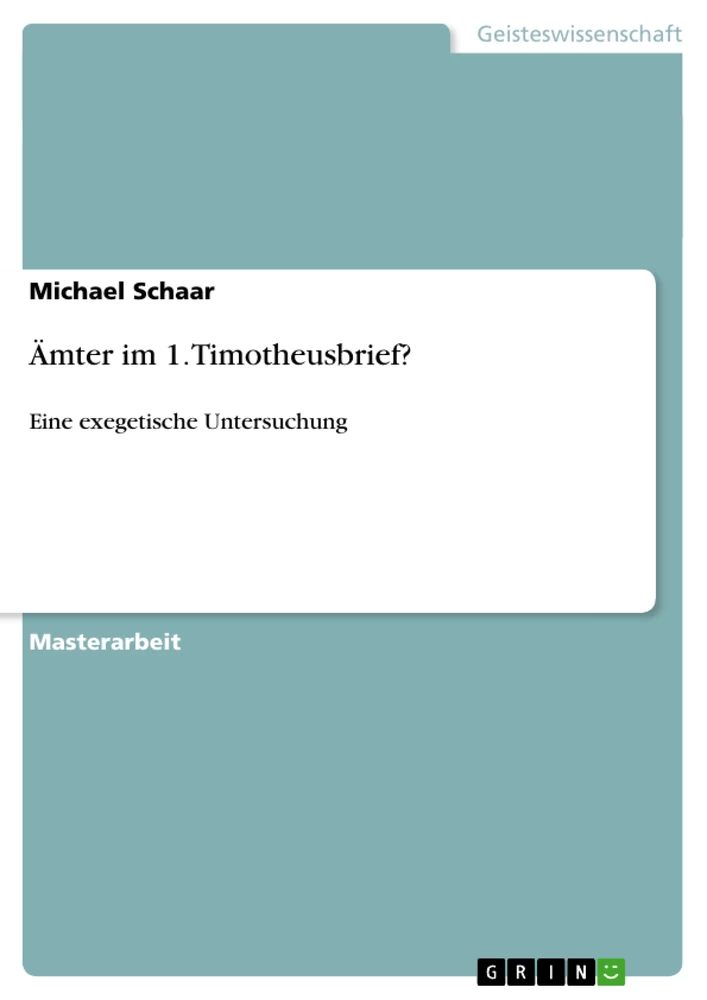Der Autor geht der so genannten Ämterfrage im 1. Timotheusbrief nach. Hierzu verwendet er neben dem Urtext des Neuen Testaments auch pagane Inschriften, um so aufzuzeigen, wie sich mögliche Amtsfunktionen mit der Zeit in der Kirche entwickelt, aber auch Funktionen verändert haben.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Hauptteil
1. Der 1. Timotheusbrief
2. Episkopos, Diakone und Frauen (1Tim 3,1-3)
Ubersetzung
Qualifikationen
Aufgaben
Prufung
Ergebnis
3. Witwen und Presbyteroi (1Tim 5,3-22)
Kontexteinordnung und Grobgliederung
3.1. Witwen (1Tim 5,3-16)
Ubersetzung
Sprachliche Analyse
Tradition
Redaktion
Qualifikationen
Aufgaben
Ergebnis
3.2 Presbyter (1Tim 5,17-22)
Ubersetzung
Sprachliche Analyse
Qualifikationen
Aufgaben
Prufung und DisziplinarmaGnahmen
Ergebnis
3.3 xlya (v. 3) und 5inA^ xiy^ (v. 17)
Ruckblick und Ausblick
1. Zeitgeschichtliche Einordnung
2. Die „Amter“ im 1Tim
Literaturverzeichnis
Einleitung
,,Diese Epistel schreibt S. Paulus zum Vorbilde alien Bischofen, was sie lehren und wie sie die Christenheit in allerlei Standen regieren sollen, auf dafi nicht not sei, aus eigenem Menschendunkel die Christen zu regieren.1
[...]
Im dritten [Kapitel] beschreibt er, was fur Personen die Bischofe oder Priester und ihre Weiber sein sollen,
item die Kirchendiener und ihre Weiber, und lobt’s, so jemand begehrt, ein Bischof solcher Weise zu sein.
[...]
Im funften [Kapitel] befiehlt er, wie die Witwen undjungen Weiber sollen bestellt werden, und welche Witwen man von der gemeinen Steuer nahren solle; auch wie man fromme und strafliche Bischofe oder Priester in Ehren halten oder strafen solle. “2
Diesen Worten Martin Luthers zufolge, die er in der Vorrede zum 1.3 Timotheusbrief (1Tim) wahlt, scheint in diesem Brief eine klare Vorgabe daruber gegeben zu werden, wie ein Bischof und andere gemeindeleitenden Amtsinhaber zu sein haben. Auffallig ist jedoch die Tatsache, dass in der heutigen kirchlichen Praxis gerade diese Textstellen aus dem 1Tim nicht bei der Einfuhrung von Amtstragerinnen und Amtstragern gelesen werden.
Schlagt man die entsprechenden Stellen in der Bibel in der Fassung des revidierten Luthertextes von 1984 auf, scheint man die Bestatigung zu erhalten, dass der auctor ad Timotheum uns heute vertraute „Amter“ kennt. Im Text ist von Bischofen, Diakonen und Presbytern die Rede. Es sind also drei Bezeichnungen zu finden, die uns heute als Amter der Kirche gelaufig sind. Damit stellt sich naturlich ein bestimmtes Bild im Kopf der Leserin und des Lesers ein, weil man nur allzu gern heutige Vorstellungen dieser drei Amter unserer Kirche in dem Text wiederfinden mochte, um fur diese eine kanonische Legitimation vorweisen zu konnen.
Ahnliches scheint fur romisch-katholische Christinnen und Christen zu gelten, die im speziellen Fall der im 1Tim genannten Witwen und der Aussagen uber sie eine besondere Form eines „geistlichen Standes“ erkennen, der sich heute im Ordenswesen widerspiegelt. Es wird also eine „Notwendigkeit besonderer Formen christlicher Existenz und deren Verwurzelung in den Anfangen der Kirche“4 aus diesem Text herausgelesen.
Kommentare widmen den „gemeindeleitenden Amtern“ des „Bischofs“, der Diakone und der Presbyter umfangreiche Exkurse und malen ein klar zu greifendes Bild dieser Amter aus.5
Der Arbeitsauftrag, der uber der vorliegenden Arbeit steht, fragt jedoch danach, ob im 1Tim uberhaupt von Amtern nach unserer heutigen Definition zu sprechen ist.
Will man zunachst einmal genau wissen, was nach heutigem Verstandnis ein Amt ist, scheint der Blick in ein gangiges Lexikon hilfreich zu sein. Schlagt man in einem Standardwerk nach, so ist zu lesen, ein Amt sei im Sinne des Verwaltungsrechtes ein „auf Dauer festgelegter Geschaftskreis im Dienst anderer, aber auch die Institution, der dieser Geschaftskreis zur Wahrnehmung ubertragen ist. Man unterscheidet private und offentl.[iche] Amter, je nachdem ob es sich um Geschafte privater oder offentl.[licher] Verbande handelt. I.[m] e.[ngeren] S.[inn] ist A.[mt] nur das offentliche Amt, ein durch Zustandigkeitsnormen abgegrenzter Geschaftsbereich der Staatsgewalt (z.B. das Gewerbeaufsichtsamt). In einem noch engeren Sinn bezeichnet man den einem einzelnen Amtswalter (Amtstrager) ubertragenen Zustandigkeitsbereich als A.[mt], zu dem gemaB Art.[ikel] 33 Abs.[atz] 2 G[rund]G[esetz] jeder Deutsche nach Eignung, Befahigung und Leistung gleichen Zugang haben muss. [...] Durch Ubernahme des A.[mtes] ergeben sich mannigfache Rechte und Pflichten des Amtswalters, die durch Verfassung und Gesetz sowie durch interne Dienstanweisungen festgelegt sind (Amtspflichten).“6 Somit wird im heutigen Sprachgebrauch ein Amt als eine rechtlich definierte und im Rahmen einer bestimmten institutionellen Ordnung angesiedelte Funktion verstanden, die eine rechtliche Anerkennung voraussetzt.
Ein Amt wird in einer theologischen Monographie durch die folgenden Merkmale charakterisiert: Es wird zum einen ein klar umschriebener Kompetenzbereich genannt, eine auf eine gewisse Dauer ubertragene Tatigkeit beschrieben, aus der eine Sonderstellung innerhalb einer bestimmten Gruppe (Gemeinde) hervorgeht, die Autoritat mit sich zieht und eine gewisse Anerkennung verlangt. Es findet dabei eine offizielle Ubertragung der Funktion statt, die eingebunden ist in das Gesamt der Gemeinde und zur Sicherung der Kontinuitat und Kontrolle der Amtsausubung dient.
Innerhalb des Neuen Testaments gibt es keinen einheitlichen Begriff fur „Amt“, geschweige denn eine Definition von Amt wie im oben genannten Lexikonartikel. Die entsprechenden profan-griechischen Begriffe apx^> Tipp, tsAos bzw. Asixoupyia werden fur gemeindeordnende oder Leitungsfunktionen 7 nicht verwendet.
Die entsprechenden Textstellen im 1Tim, in denen von einem Episkopos, von Diakonen, „Diakoninnen“, Witwen und Presbytern die Rede ist, sollen im Vordergrund der vorliegenden Untersuchung stehen. Nach einer grundlegenden Einfuhrung in den 1Tim folgt die Analyse der einzelnen Textabschnitte. Auf deren Ubersetzung und Kontexteinordnung soll ein genaues Lesen folgen: Was sagen die Textstellen des 1Tim konkret uber das scheinbar vorliegende „Amt“ aus? In einem zweiten Schritt muss geklart werden, ob diese Ergebnisse es zulassen, von „Amtern“ nach heutiger Definition zu sprechen.8
Hauptteil
1. Der 1. Timotheusbrief
Der 1. Timotheusbrief (1Tim) gehort wie der 2. Timotheusbrief und der Titus- brief zur Gruppe der Pastoralbriefe. Diese Briefe sind an Einzelpersonen adressiert, aber fur die Gemeinde bestimmt, wie dies auch im 1Tim ganz deutlich wird, wenn sich der Verfasser direkt an sie als rechtglaubige Gemeinschaft wendet (1Tim 6,21).
Der 1Tim gibt vor, Paulus habe diesen Brief selbst geschrieben (1Tim 1,1). Der Apostel sei nach Makedonien gereist, plane aber seine baldige Ruckkehr nach Ephesus (1Tim 3,14; 4,13). Der Adressat des Briefes ist das „rechtmaBige Kind im Glauben“ Timotheus9, der nach Apg 16,1 der Sohn eines Heiden und einer Judenchristin10 ist, den Paulus wahrscheinlich selbst zum Christen machte (1Kor 4,17; anders Apg 16,1). Timotheus erscheint als Mitabsender mehrerer paulinischer Briefe (1Thess, Phil, 2Kor, Phlm) und zweier deuteropaulinischer Briefe (2Thess und Kol).
Angeblich wurde Timotheus von Paulus in Ephesus zuruckgelassen, als dieser nach Makedonien weiter zog. In seinem Brief an ihn wiederholt Paulus die schon mundlich erteilten Auftrage (1Tim 1,3). Eine solche Situation liegt aber in den echten Paulusbriefen nicht vor. Auch nach dem Zeugnis der Apg ist Paulus zwar von Ephesus nach Makedonien gereist (Apg 19,21; 20,1f.), hat aber Timotheus nicht in Ephesus zuruckgelassen, sondern ihn im Gegenteil schon nach Makedonien vorausgeschickt (Apg 19,22). AuBerdem ist der Sinn und Zweck des Briefes schon aus formalen Grunden nur bedingt nachzuvollziehen, wenn Paulus selbst nur eine kurze Zeit abwesend ist, sein baldiges Kommen ankundigt (1Tim 3,14), aber trotzdem von einer moglichen Verzogerung spricht (1Tim 3,15). Dieser Brief ware somit eine sehr umfangreiche vorbeugende MaBnahme fur eine Eventualitat. Paulinische Begriffe wie Gerechtigkeit, Freiheit, Kreuz, Sohn Gottes und Leib Christi fehlen in Ganze. Ebenfalls gegen eine paulinische Verfasserschaft spricht das Frauenbild im 1Tim: Das Lehrverbot fur Frauen (1Tim 2,11f.) widerspricht der Aussage in 1Kor 11,5, wo Paulus - entgegen der Interpolation in 1Kor 14,33b-36 - keinen AnstoB am prophetischen Wirken von Frauen im Gottesdienst nimmt. Wahrend in 1Tim 2,14 die Verfuhrbarkeit Evas hervorgehoben wird, bringt nach Rom 5,12-21 Adams Ubertretung Verdammnis uber die Menschen.
Aus diesen formalen und inhaltlichen Grunden ist eine Verfasserschaft des Paulus sehr unwahrscheinlich. Beim 1Tim handelt es sich somit um ein pseud- epigraphes Zeugnis. In der literarischen Fiktion wird eine Kontinuitat zu Paulus selbst hergestellt, der den normativen Ursprung der 5i5aaKaAia des 1Tim darstellt.11 Pseudepigraphe Schreiben werden in einer aktuellen Auseinandersetzung verfasst, um die Position einer Konfliktpartei mit Autoritat abzusichern.12 13
Aber um welchen Konflikt geht es im 1Tim? In der Gemeinde ist eine Identitatskrise entstanden, weil die zunehmende Herausbildung und Veranderung der Gemeindestruktur nicht auf Paulus direkt zuruckgefuhrt werden kann. Dieses Problem verstarkt sich in dem Moment, als von auBen kommende „Irrlehrer“ diese Legitimationslucke nutzen, um ihren Einfluss geltend zu machen. Jedoch durfte die Bewaltigung der Abwesenheit des Paulus und damit das Ausbleiben apostolischer Weisung schon einige Zeit vorher ein Thema gewesen sein. Einen wichtigen Hinweis zur Klarung der aufgeworfenen Frage gibt der 1Tim selbst: Der Verfasser spricht von Paulusanhangern in der Gemeinde, die sich abgewandt (1Tim 4,1) und einem anderen Lager angeschlossen haben.14 Der polemische Stil des 1Tim verstarkt daruber hinaus die Annahme einer Auseinandersetzung zwischen denjenigen, die sich als die wahren Paulustreuen sehen, und denjenigen, denen genau dieses abgesprochen wird.15
Auf der anderen Seite konnte der polemische Stil des 1Tim aber auch fur eine weitere Gruppe von Gegnern sprechen, die nicht aus der Gemeinde selbst erwachsen sind und auch nicht eindeutig ausgemacht werden konnen. Hier ist an eine fruhe Form der Gnosis zu denken.16
In summa kann gesagt werden, dass eine eindeutige Identifizierung der Gegner schwer fallt, denn der Verfasser des 1Tim wertet ihre Lehre bewusst als „leeres Gerede“ ab (1Tim 6,20) und tritt mit ihnen in seinem Brief nicht in eine wirkliche Auseinandersetzung ein. Gewisse Zuge17 seiner Gegner teilt der Briefschreiber dennoch mit: Sie behaupten, uber yvWais zu verfugen (1Tim 6,20), ihre Lehre weist Genealogien auf (1Tim 1,4), sie verbieten die Heirat und meiden bestimmte Speisen (1Tim 4,3).
Der Abfassungszeitraum des Briefes wird kurz nach der Wende zum zweiten Jahrhundert angegeben.18
Der 1Tim lasst sich nach Praskript (1Tim 1,1f.) und Briefeingang (1Tim 1,320) grob in zwei Teile gliedern19: Der erste Teil beinhaltet Weisungen fur die Gemeinde (1Tim 2,1-3,16), der zweite Teil Weisungen an Timotheus (1Tim 4,16,2). Dem Briefschluss (1Tim 6,3-19) folgt das Postskript (1Tim 6,20f.)20.
Der Verfasser wahlt das Bild des o!kos als Leitmetapher fur die Gemeinde (1Tim 3,14f.):[Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten]. „Ordnung und Festigkeit sind die Merkmale“ , die bei der Verwendung dieser Metapher mitschwingen. Diese Ordnungselemente entsprechen antiker Oikonomik, „der Lehre uber das Leben und die Leitung im antiken Hauswesen sowie auch weitgehend deren gelebter Wirklichkeit.“ Diese Lebensweise sieht so aus, dass der Hausvater21 uber allen weiteren Familienmitgliedern steht, seine Frau, die Kinder und die Hausangestellten bis zu den Sklaven ihm untergeordnet sind. Die Oikonomik wird nun auf die Gemeinde ubertragen.22
2. Episkopos, Diakone und Frauen (1Tim 3,1-13)
Ubersetzung
(1) Glaubwurdig ist das Wort: Wenn jemand das Episkopenamt anstrebt, begehrt er eine gute Aufgabe.
(2) Es ist also notig, dass der Episkopos untadelig ist, Mann einer einzigen Frau, nuchtern, besonnen, maBvoll, gastfreundlich, zum Lehren befahigt,
(3) kein Saufer, kein Schlager, sondern gutig, frei von Streitsucht, nicht geldgierig,
(4) seinem eigenen Haus in guter Weise vorstehend, [seine] Kinder in Unterordnung habend, mit aller Ehrbarkeit
(5) (denn wer nicht versteht, seinem eigenen Haus vorzustehen, wie soll er sorgen fur die Gemeinde Gottes?),
(6) kein Neubekehrter, damit er nicht aufgeblasen werde und dem Gericht des Satans verfalle.
(7) Es ist aber auch notig, dass er einen guten Leumund hat bei den AuBenstehenden, damit er nicht in uble Nachrede komme und in die Schlinge des Satans.
(8) [Es ist notwendig, dass] Diakone in eben dieser Weise ehrbar sind, nicht doppelzungig, nicht vielem Wein zugetan, nicht gewinnsuchtig,
(9) das Geheimnis des Glaubens in reinem Gewissen haben.
(10) Diese aber sollen zuerst gepruft werden, dann den Dienst ausuben, wenn sie vorwurfsfrei sind.
(11) [Es ist notwendig, dass] Frauen in eben dieser Weise ehrbar, nicht verleumderisch, nuchtern, zuverlassig in allem [sind].
(12) Diakone sollen Manner einer einzigen Frau sein, in guter Weise vorstehend den Kindern und ihren eigenen Hausern.
(13) Diejenigen namlich, die den Dienst in guter Weise ausgeubt haben, verschaffen sich selbst einen guten Rang und groBe Offenheit im Glauben an Christus Jesus.
Gliederung
Innerhalb des Corpus des 1. Timotheusbriefes folgt auf Anweisungen fur das Verhalten im Gottesdienst (1Tim 2) mit der uberleitenden und einfuhrenden Bekraftigungsformel23 'maTos 0 Loyds der so genannte „Episkopenspiegel“. In den v. 2-7 findet sich eine Aufzahlung, welche Qualifikationen ein EpiaKopos mitbringen muss, damit das KaAOv Epyov ausgefuhrt werden kann. In den v. 8-13 folgt eine Nennung von positiven und negativen Merkmalen, die fur den Diakon bzw. fur die Frauen, die selbst nicht als Diakoninnen bezeichnet werden, Relevanz haben. Entsprechend einem „Episkopenspiegel“ ist in diesen Versen ein „Diakonenspiegel“ zu sehen. Auffallig ist die Nennung von Episkopos im Singular (v. 2) und Diakonen und Frauen (yuvaiKEs) im Plural (v. 8 und v. 11). Syntaktisch ist die Parallele zwischen den v. 2, 8 und 11 hervorzuheben. In v. 2 ist der Acl von SeI abhangig, welches in v. 8 und v. 11 erganzt werden muss.
Es steht fur den Episkopos die Untadeligkeit am Anfang der Aufzahlung, die als thematischer Leitbegriff Gultigkeit hat. In dem Katalog finden sich 11 Aussagen, die zum Teil positiv, zum Teil negativ formuliert sind und ohne ein erkennbares sprachliches oder inhaltliches Ordnungsprinzip aneinander gereiht werden. Fur die ausschlieBenden Merkmale werden entweder Adjektive mit a- Privativum gebraucht oder Nomen mit pp verneint. Einzig in den v. 6f. erfolgt zusatzlich eine Begrundung fur das genannte Qualifikationsmerkmal.
Parallel zum ^iaxOs-Leitbegriff des EpiaKopos gibt es einen solchen auch bei den Diakonen und den Frauen: Hier ist der Leitbegriff aspvOs/aspvp (v. 8 und v. 11). Die anschlieBend genannten Qualifikationsmerkmale fur die SaKovoi sind wie folgt angeordnet: In v. 8 werden drei ausgrenzende, jeweils durch pp verneinte Merkmale genannt, denen in v. 9 eine positive Aussage folgt, die dann in v. 10 ausgefuhrt wird.
V. 8 und v. 11 sind vom Aufbau gleich: Nach der Nennung der Personengruppe folgt Waauxws aspvous bzw. aspvas. So sollen sowohl SaKovoi als auch Frauen in gleicher Weise ehrbar sein. An diese Aussage schlieBen sich in v. 11 im Unterschied zu v. 8 nicht drei negative Formulierungen an, sondern lediglich eine negative Aussage, die von zwei positiven Qualifikationsmerkmalen erganzt wird. Inhaltlich aber liegt eine Entsprechung der beiden ersten Glieder vor, die sich als Synonyme lesen lassen, denn diese beschreiben den Bereich von Kommunikation mit Dritten (pp SiAoyos - pp Sa^oAos) und den Bereich des ubermaBigen Konsums von Alkohol (pp olvw poAAw ppoaExwv - vp^aAia).
In den v. 12f. kehrt der Verfasser nach den Aussagen uber die Frauen erneut durch die Nennung der SaKovoi zu diesen zuruck.
Insbesondere aufgrund dieser Beobachtungen lasst sich der Eindruck nicht verwehren, dass der „Diakonenspiegel“ wohl durchkomponierter als der „Episkopenspiegel“ ist. Es liegt die Vermutung nahe, dass es sich bei den v. 8-11, die in vielfacher Weise koharent sind, um eine Tradition handelt, die der24 Verfasser des 1Tim durch die v. 12f. erganzt. Auf diese Weise lasst sich auch der abrupte Subjektwechsel zwischen v. 11 und v. 12 (yuvaiKEs - SiaKovoi) erklaren.
Qualifikationen
Die Qualifikationsmerkmale fur einen s'maKO'nos sind zusammengefasst folgende: Er soll untadelig sein (avErtiAppuTos), Mann einer Frau (pas yuvaiKOs avpp), nuchtern (vp^aAios), besonnen (au^puv), maBvoll (KOapios), gastfreundlich (^lAo^svos), zum Lehren befahigt (SiSaKTiKos), kein Saufer (pp ^apoivos), kein Schlager (pp 'ApKTps), gutig (E'iEiKps), frei von Streitsucht (apayos) und nicht geldgierig (a^iAapyupos). Er soll seinem privaten Haus gut vorstehen (tou iSiou oiKou KaAWs 'poiaTapEvos) und seine eigenen Kinder in Unterordnung haben (T£Kva Eywv Ev U'oTayp). Die private Bewahrung im Bereich des eigenen Hauses und der Familie wird auf die Funktion innerhalb der Gemeinde ubertragen: Ei SE tis tou ’iSiou oiKou 'poaTpvai ouk olSsv, 'Ws EKKApaias 0eou E'ipsApasTai;
Die Diakone sollen ehrbar sein (aspvos), nicht doppelzungig (pp SiAoyos), nicht dem vielen Wein zugetan (pp oivw 'oAAW npoaEywv), nicht gewinnsuchtig (pp aiaxpoKspSps), das Geheimnis des Glaubens in reinem Gewissen haben (Eywv to puaTppiov Tps 'iaTEws) und vorwurfsfrei sein (avEyKApTos). Auch fur sie gilt, nur Mann einer Frau zu sein (Eivai pias yuvaiKos avpp) und ihrem Haus und ihren Kindern gut vorzustehen (tEkvwv KaAWs npoiaTapEvos Kai twv iSiwv oIkwv). Jedoch wird bei ihnen - im Gegensatz zum E'iaKo'os - die geforderte Bewahrung im Haus nicht „auf die offizielle Funktion in Gemeinde und Kirche, wie sie in V 5 fur den Episkopos formuliert ist“25, ubertragen.
Fur die Frauen gilt es wie fur die mannlichen Diakone, ehrbar zu sein (aEpvp). Ihre Qualifikationsmerkmale sind nicht verleumderisch (pp Sia^oAos), nuchtern (vp^aAia) und zuverlassig in allem ('iaTp Ev 'aaiv) zu sein. Bei diesen Frauen handelt es sich weder um die Frauen der Diakone, wie oft angenommen, oder gar allgemein Frauen in der Gemeinde, sondern um weibliche Diakone.26
In bezug auf den Episkopos werden weitgehend profane Tugenden erwahnt, die er erfullen muss. Lediglich die Tatsache, nicht ein Neubekehrter zu sein, hat hier eine typisch christliche Farbung. Zweck dieser Eingrenzung der Kandidaten ist es, ein „Aufblahen“ zu verhindern (pp tu^w0eis sis Kpipa sp^sap Kai ^ayiSa tou Sia^oAou). In den Angaben zu den Diakonen und den Frauen fehlen christliche Bezuge vollkommen.
Eine Erklarung fur diese Beobachtung liefern formgeschichtliche Untersuchungen: Die genannten Qualifikationen fur den EmaKonos, die SaKovoi und die Frauen entlehnt der Verfasser des 1Tim so genannten Berufspflichtenkatalogen. Derartige Kataloge „fuBen auf der Grundthese hellenistischer popularphilosophischer Ethik, daB jeder, gleich welchen Berufes oder Geschlechtes, tugendhaft zu sein habe.“27 28 Auffallig im 1Tim ist die in den paganen Katalogen unubliche besondere Betonung der guten Fuhrung des eigenen Hauses und der Kinder. Dieses Element scheint deshalb auf die Hand des Verfassers des 1Tim zuruckzugehen, zumal es ganz auf seiner Linie der Orientierung an der Leitmetapher oIkos liegt.
Aufgaben
So umfangreich die Liste der gewunschten Qualifikationen ist, so wenig auskunftsfreudig ist der Text, welche konkreten Aufgaben der EmaKonos innerhalb der christlichen Gemeinde hat.
Einzig durch die Adjektive SiSaKTiKos in v. 2 sowie a^iAapyupos in v. 3 lassen sich mogliche Ruckschlusse auf eine Aufgabe ziehen. Die Hervorhebung der Lehrfahigkeit des s^iaKo^os hat wohl mit dem aktuellen Anlass der Abfassung des 1Tim zu tun. Es geht dem Verfasser um den Erhalt der reinen Lehre, der Voraussetzung fur den Bestand der Gemeinde ist. Aus diesem Grund benotigt man jemanden, der zur rechten Lehre auch befahigt ist. Dieses Merkmal wird von den Diakonen und den „Diakoninnen“ nicht eingefordert. Die Lehre obliegt also dem Episkopos.29 30
Das Fehlen von Geldgier, das in v. 3 gewunscht wird, lasst die Annahme zu, dass der Episkopos Geld zu verwalten hat. Um welches Geld es sich dabei handelt und ob in diesem Fall von einer Gemeindekasse gesprochen werden kann, ergibt sich aus dem Text nicht.
„1. Das aus der Okonomik stammende Ordnungsgefuge wird nicht mehr auf das Zusammenleben der Familienmitglieder im Haushalt[,] sondern auf die Gemeinde als Hauswesen angewandt. 2. Die Anweisungen ergehen nicht mehr direkt an die das Hauswesen konstituierenden Personengruppen[,] sondern an die Amtstrager und sollen durch sie den einzelnen Personengruppen der Gemeinde vermittelt werden. 3. Von der sozialethischen.
[...]
1 D.h. versorgt werden.
2 Martin Luther, Vorrede auf die erste Epistel S. Pauli an Timotheum von 1522 (zitiert nach Bornkamm, Luthers Vorreden, S. 207).
3 Vgl. Agende fur die Evangelisch-Lutherischen Kirchen und Gemeinden. Band IV: Ordination und Einsegnung, Einfuhrungshandlungen, Einweihungshandlungen.
4Roloff, 1. Timotheusbrief, S. 303.
5 Vgl. „Exkurs: Die gemeindeleitenden Amter (Bischof, Alteste, Diakone)“ in Roloff, 1. Timotheusbrief, S. 169-189; Merkel, Pastoralbriefe, S. 90-93 „Das kirchliche Amt in den Pastoralbriefen“ sowie Brox, Pastoralbriefe, S. 147-155 „Das kirchliche Amt - Bischof, Presbyter, Diakon“.
6 Brockhaus Enzyklopadie, Art. Amt, S. 537.
7 Vgl. Brockhaus, Charisma und Amt, S. 24f., Anm. 106: „Diese Aufstellung ist ein Resultat, was »man« rein formal unter Amt [...] versteht.“
8Roloff, Art. Amt IV. Im Neuen Testament, Sp. 509.
9 Zu Timotheus vgl. Ollrog, Mitarbeiter, S. 20-23.
10Vgl. Haenchen, Apostelgeschichte, S. 461.
11 Vgl. Wolter, Pastoralbriefe, S. 63.
12 Dazu Reinmuth: „Im Blick auf pseudepigraphe Texte ist es folglich geboten, zwischen realem, abstraktem und fiktivem Autor zu unterscheiden. Ein uns unbekannter Autor fingiert durch die Wahl eines Pseudonyms eine Verfasserschaft, die nicht der tatsachlichen entspricht. Dabei wird der betreffende Text mit dem gewahlten Pseudonym so in Verbindung gebracht, daB er der vorausgesetzten Kenntnis des Pseudonyms bei den Adressaten zugeordnet werden kann [...]. Soll die beabsichtigte Kommunikation mittels des pseudonymen Textes gelingen, so muB dieser hinreichend mit Signalen versehen sein, die einer solchen Kenntnis entsprechen bzw. sie erweitern. Zugleich verhullt der Autor weitgehend seine tatsachliche Verfasserschaft. [...] Weder abstrakter und fiktiver Autor noch intendierte und fiktive Adressaten kommen freilich in pseudepigraphen Texten voll zur Deckung. Diese zwar tendenziell, aber doch nicht restlos vollzogene Ubereinstimmung ist vielmehr Voraussetzung ihrer tatsachlichen Wirkung. Denn diese Texte wollen ja die Gegenwart ihrer intendierten Rezipienten, nicht der fiktiven, erreichen.“ In: DERS., Brief, S. 193f.
13 Vgl. Wolter, Pastoralbriefe, S. 15-17, 243-256, ahnlich auch Lips, Glaube, S. 157.
14 Vgl. Roloff, Irrlehrer, S. 115: „Die Irrlehrer sind nicht von auBen in die Gemeinden eingedrungen.“
15 Lips, Glaube, S. 155f.
16 Vgl. Lips, Glaube, S. 152; Brox, Pastoralbriefe, S. 40; Dibelius/Conzelmann, Pastoralbriefe, S. 40; Wolter, Pastoralbriefe, S. 263. Diese mogliche Fruhform der yvwais hat eine besondere Vorliebe fur asketisches Leben, setzt sich fur die Emanzipation der Frauen ein und hat ein prasentisches Auferstehungsverstandnis. All dies fuhren ihre Anhanger direkt auf Paulus zuruck.
17 Ausfuhrlich zu den Zugen der Irrlehre Lips, Glaube, S. 152-160; Roloff, 1. Timotheusbrief, S. 228-239 sowie auch Wolter, Pastoralbriefe, S. 256-270.
18 Vgl. Lips, Glaube, S. 24; Wolter, Pastoralbriefe, S. 22; Dibelius/Conzelmann, Pastoralbriefe, S. 2. Merkel schwankt beim Abfassungsort zwischen Rom und Ephesus und legt sich auch bei der Datierung nicht eindeutig fest, vgl. ders., Pastoralbriefe, S. 13f. Anders Roloff, der die Abfassung um das Jahr 100 n.Chr. datiert, ders., 1. Timotheusbrief, S. 46.
19 Gliederung nach Niebuhr, Grundinformation, S. 282. Die Gliederung des 1Tim folgt dem traditionellen Schema antiker Briefe: Dem Praskript mit superscriptio (nauAos AnOaxoAos Xpiaxou ’Ipaou rax’ Emxayriv 0eou awxHpos HgWv Ka'i Xpiaxou ’Ipaou xps EAniSos HgWv), adscriptio (Tigo0Ew yvHaiw xEkvw Ev niaxEi) und salutatio (xApis eAeos Eip^vp AnO 0eou naxpOs Kai Xpiaxou ’Ipaou xou Kupiou HgWv) schlieBt sich das Proomium an. Darauf folgt das Briefcorpus. Der Briefschluss umfasst GruBe und einen abschlieBenden Gnadenwunsch. Zur antiken und neutestamentlichen Briefliteratur vgl. grundsatzlich Klauck, Briefliteratur.
20 Weiser, Kirche, S. 108.
21 Weiser, Kirche, S. 108.
22 Mittelposition, fur die die Gegenseitigkeit der Wertschatzung sowie der Rechte und Pflichten kennzeichnend war, ist nichts mehr zu spuren, statt dessen stehen Uber- und Unterordnung ganz im Vordergrund und zwar in patriarchaler Auspragung.“ Weiser, Kirche, S. 109.
23 Roloff, 1. Timotheusbrief, S. 152. „Als Ubergangswendung dient eine den Gemeinden bekannte Maxime (V1), die durch die Beglaubigungsformel »zuverlassig ist das Wort« als solche gekennzeichnet und zugleich bejaht wird.“ A.a.O., S. 149.
24Roloff, 1. Timotheusbrief, S. 149.
25 Oberlinner, Pastoralbriefe, S. 143.
26 „So spricht alles dafur, dass es in V. 11 nicht um die Frauen der Diakone, sondern um weibliche Diakone, also um Amtstrager, geht. Wenn der Verfasser der Pastoralbriefe an dieser Stelle wenig exakt formuliert, so hangt dies wohl einfach damit zusammen, dab er eine bereits vorgepragte Tradition ubernommen hat.“, Lohfink, Weibliche Diakone, S. 333. Vgl. auch den Exkurs bei Roloff, 1. Timotheus, S. 164f. sowie Merkel, der die Wichtigkeit der Mitarbeit der Frauen in den fruhchristlichen Gemeinden betont, DERS., Pastoralbriefe, S. 31f.
27 Vogtle, Tugend- und Lasterkataloge, S. 51-56.90; Roloff, 1. Timotheusbrief, S. 150; Oberlinner, Pastoralbriefe, S. 110: „Formal und inhaltlich greift die Liste wieder zuruck auf das Vokabular der Tugendlisten der hellenistischen Umwelt.“
28 Roloff, 1. Timotheusbrief, S. 150.
29 Auch bei den Presbyteroi wird von der Lehre gesprochen (1Tim 5,17). Das Verhaltnis dieser Aussagen zueinander soll an anderer Stelle dieser Arbeit bestimmt werden.
Haufig gestellte Fragen
Was ist der Zweck des 1. Timotheusbriefes laut Einleitung?
Laut der Einleitung zu Martin Luthers Vorrede dient der 1. Timotheusbrief (1Tim) als Vorbild für Bischöfe, um zu lehren und die Christenheit in verschiedenen Ständen zu regieren. Der Brief beschreibt die Eigenschaften, die Bischöfe/Priester und ihre Frauen, sowie Kirchendiener und ihre Frauen haben sollten. Er behandelt auch die Ordnung der Witwen und jungen Frauen, und wie fromme und straffällige Bischöfe/Priester geehrt oder bestraft werden sollen.
Was wird kritisch hinterfragt in Bezug auf die im 1Tim genannten "Ämter"?
Die Arbeit hinterfragt, ob die im 1Tim genannten Bezeichnungen wie Episkopos, Diakone und Presbyter tatsächlich als "Ämter" im heutigen Verständnis des Wortes verstanden werden können. Es wird untersucht, ob diese Funktionen die Merkmale eines Amtes im modernen Sinne (rechtlich definierte Funktion, institutionelle Ordnung, Anerkennung) aufweisen.
Welche Kritik wird an der paulinischen Verfasserschaft des 1Tim geäußert?
Es wird argumentiert, dass der 1Tim wahrscheinlich nicht von Paulus selbst verfasst wurde (Pseudepigraphie). Gründe dafür sind das Fehlen paulinischer Begriffe, das abweichende Frauenbild im Vergleich zu echten Paulusbriefen, und die Diskrepanz zwischen den im Brief dargestellten Umständen und den Informationen aus der Apostelgeschichte bezüglich der Reisen und Tätigkeiten von Paulus und Timotheus.
Worum geht es bei dem Konflikt, der im 1Tim angedeutet wird?
Der Brief deutet auf eine Identitätskrise in der Gemeinde hin, verursacht durch die Veränderung der Gemeindestruktur und den Einfluss von "Irrlehrern". Es wird vermutet, dass es eine Auseinandersetzung zwischen verschiedenen Gruppen gab, die sich entweder als die wahren Paulustreuen betrachteten oder im Gegensatz zu diesen standen. Es wird auch die Möglichkeit von Einflüssen einer frühen Form der Gnosis in Betracht gezogen.
Wie ist der 1. Timotheusbrief aufgebaut?
Der 1. Timotheusbrief lässt sich grob in zwei Teile gliedern: Weisungen für die Gemeinde (1Tim 2,1-3,16) und Weisungen an Timotheus (1Tim 4,1-6,2). Dem vorangestellt sind Praskript und Briefeingang, gefolgt vom Briefschluss und Postskript.
Welche Qualifikationen werden für den Episkopos im 1Tim 3,1-13 genannt?
Ein Episkopos soll untadelig sein, Mann einer Frau, nuchtern, besonnen, maßvoll, gastfreundlich, zum Lehren befähigt, kein Säufer, kein Schläger, gütig, frei von Streitsucht und nicht geldgierig. Er soll seinem eigenen Haus gut vorstehen und seine Kinder in Unterordnung haben.
Welche Qualifikationen werden für Diakone und Frauen (Diakoninnen) im 1Tim 3,1-13 genannt?
Diakone sollen ehrbar sein, nicht doppelzüngig, nicht vielem Wein zugetan, nicht gewinnsüchtig, das Geheimnis des Glaubens in reinem Gewissen haben und vorwurfsfrei sein. Sie sollen Mann einer Frau sein und ihrem Haus und ihren Kindern gut vorstehen. Frauen (Diakoninnen) sollen ehrbar, nicht verleumderisch, nüchtern und zuverlässig in allem sein.
Welche Aufgaben des Episkopos lassen sich aus dem 1Tim ableiten?
Aufgrund der geforderten Qualifikationen lässt sich ableiten, dass der Episkopos eine Lehrfunktion innehat und möglicherweise Geld zu verwalten hat.
Häufig gestellte Fragen
Kennt der 1. Timotheusbrief kirchliche Ämter im heutigen Sinne?
Die Arbeit untersucht kritisch, ob Bezeichnungen wie Episkopos, Diakon oder Presbyter bereits rechtlich definierte Ämter nach moderner Definition darstellen oder eher Funktionsbeschreibungen sind.
Gilt Paulus als der tatsächliche Verfasser des 1. Timotheusbriefes?
In der Forschung wird die Verfasserschaft des Paulus aufgrund inhaltlicher und formaler Unterschiede zu seinen echten Briefen (z. B. das Frauenbild) als sehr unwahrscheinlich angesehen; es handelt sich um ein pseudepigraphes Zeugnis.
Welche Personengruppen werden im Brief hinsichtlich ihrer Qualifikationen genannt?
Der Brief nennt Anforderungen und Aufgaben für Bischöfe (Episkopoi), Diakone, Frauen (Diakoninnen), Witwen und Älteste (Presbyteroi).
Welche methodischen Hilfsmittel nutzt der Autor für die Analyse?
Neben dem griechischen Urtext des Neuen Testaments werden auch pagane (heidnische) Inschriften herangezogen, um die Entwicklung von Amtsfunktionen zeitgeschichtlich einzuordnen.
Was ist das Ziel der im Brief beschriebenen Gemeindestrukturen?
Sie dienten vermutlich dazu, eine Identitätskrise der Gemeinde zu bewältigen und sich gegen „Irrlehrer“ abzugrenzen, indem man sich auf die Autorität des Paulus berief.
- Citation du texte
- Michael Schaar (Auteur), 2005, Ämter im 1. Timotheusbrief?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/156003