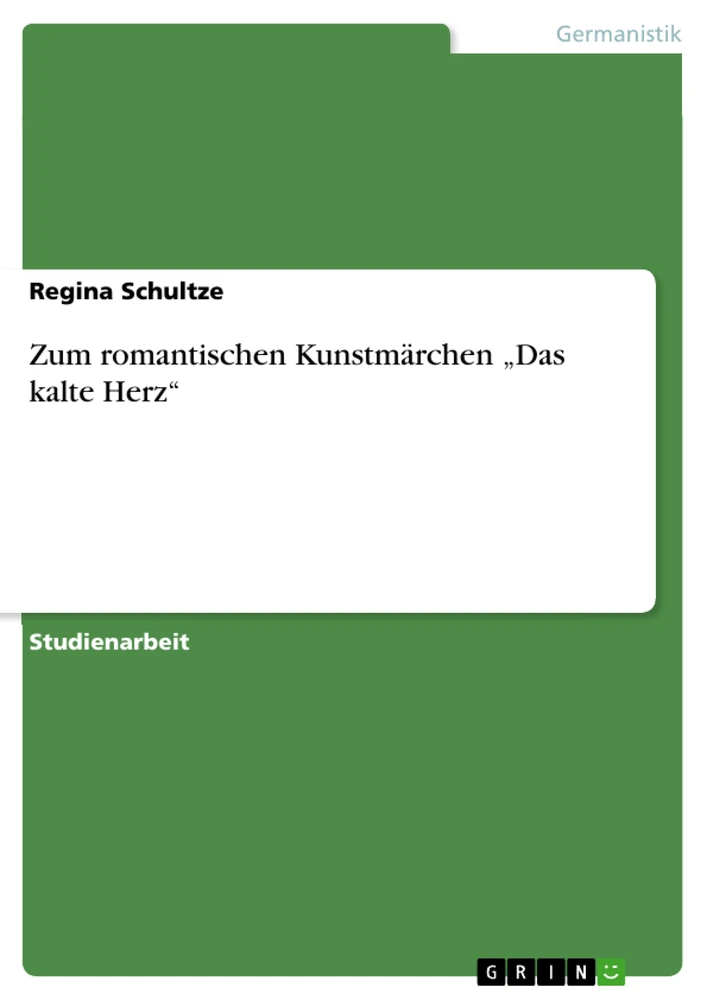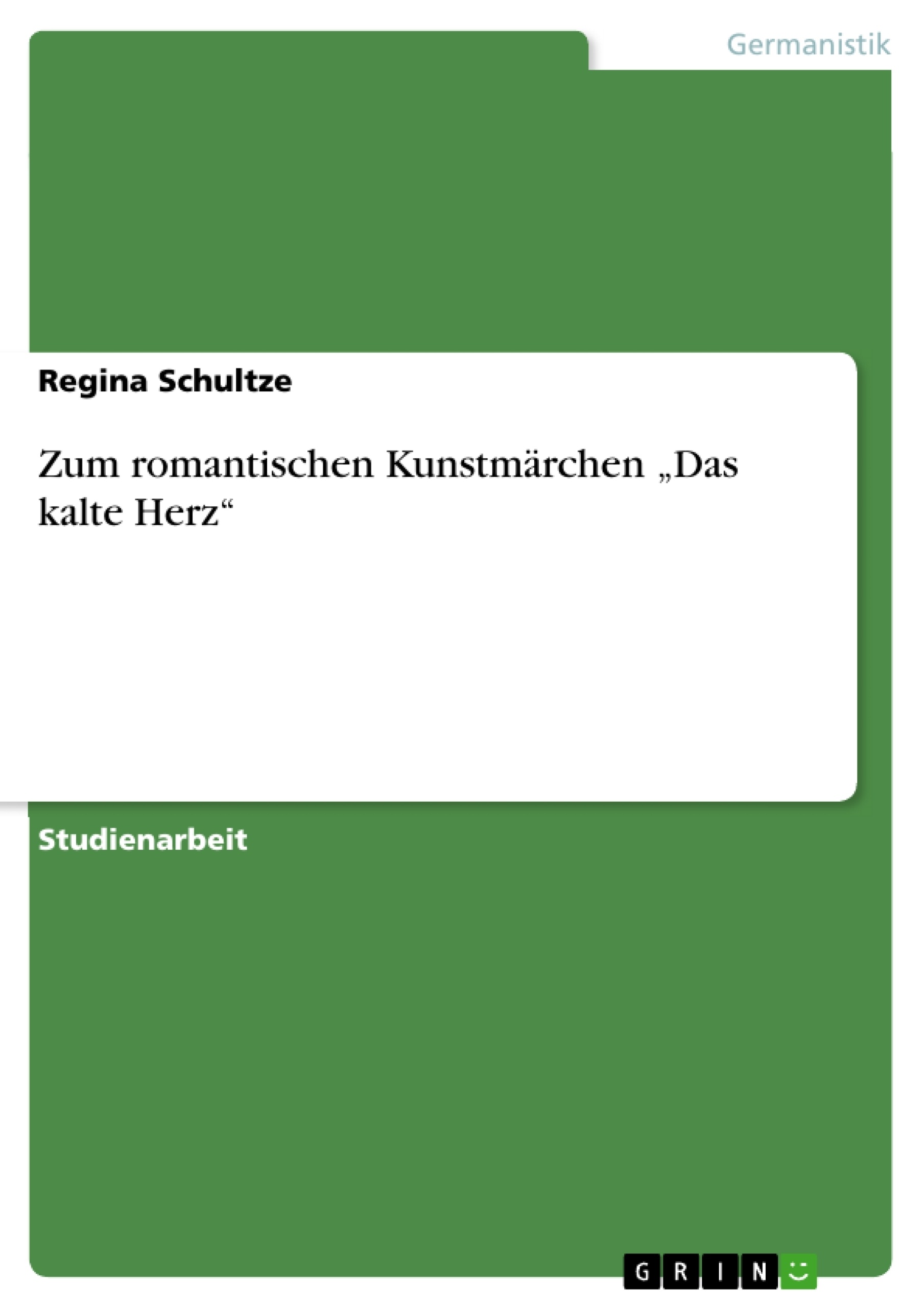Wilhelm Hauffs Kunstmärchen „Das kalte Herz“ erschien erstmals 1827 in Hauffs „Märchenalmanach auf das Jahr 1828“. Es beschäftigt sich mit dem sozialen Aufstieg und dem Berufsethos des Peter Munk. In der Zeit zwischen 1770 und 1830 entsteht in Deutschland die moderne bürgerliche Gesellschaft. Das Bürgertum erkämpft sich die Daseinsberechtigung als eigener Stand in Abgrenzung zu Adligen und Bauern. Es entstehen Handwerkergilden und –zünfte, in denen sich das Bürgertum organisiert. Unter Einfluss der Französischen Revolution gewinnt die individuelle Leistung eine zentrale Bedeutung (ebd.) und die Menschen verstehen, dass sie sich selbst eine gewisse Stellung in der Welt erarbeiten können. Eine „Reflexion über die eigene gesellschaftliche Identität“ (Schmitz-Emans 2007, S. 22) ist die Folge. Die Sehnsucht danach, etwas aus dem eigenen Leben zu machen, verfolgt auch Peter Munk.
Der romantische Dichter schöpft nicht aus der Wirklichkeit, sondern seinem eigenen Innern, was nach Jean Paul heißt, dass sich auch die Geschöpfe nur von sich selbst aus entwickeln und dass jeder Mensch selbst eine schöpferische Kraft darstellt. Hauffs Protagonist Peter Munk scheint diesem Bild zunächst nicht zu entsprechen, denn er legt sein Glück in die Hände anderer und ihm gelingt der soziale Aufstieg ohne eigenes Zutun, denn der nötige Verstand fehlt ihm. Der Plot ist durchaus realistisch angelegt, doch er wird von Fantasiegestalten und Wundern durchkreuzt. P.W. Wührl charakterisiert „Das kalte Herz“ als Wirklichkeitsmärchen. Die Wirklichkeit und die Wunderwelt existieren, zumeist räumlich getrennt, nebeneinander und bedrohen sich nicht gegenseitig. Sie sind miteinander vereinbar. Jedoch gelten in der jeweiligen Welt eigene Regeln. Zum Beispiel hat das Reich des Holländer-Michels eine klare Grenze - einen kleinen Graben-, die er nicht übertreten darf und über die er nicht hinauskommt, um Peter zu erhaschen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Kunstmärchen der Romantik
- Einsicht und Verstand
- Das Wunderbare
- Romantische Motive in „Das kalte Herz“
- Nacht und Natur
- Sehnsucht
- Abschluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Wilhelm Hauffs Kunstmärchen „Das kalte Herz“ im Kontext der romantischen Literatur. Die Zielsetzung besteht darin, das Märchen als Beispiel für das romantische Kunstmärchen zu analysieren und seine zentralen Motive und Themen herauszuarbeiten. Die Arbeit beleuchtet den Zusammenhang zwischen dem Werk und den gesellschaftlichen Veränderungen des 18. und 19. Jahrhunderts.
- Das romantische Kunstmärchen als literarische Gattung
- Der soziale Aufstieg und das Berufsethos in der Romantik
- Die Verbindung von Realismus und Fantastik in „Das kalte Herz“
- Romantische Motive wie Nacht, Natur und Sehnsucht
- Die Rolle von Verstand und Einsicht
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt den Kontext von Wilhelm Hauffs „Das kalte Herz“ dar, welches 1827 im „Märchenalmanach auf das Jahr 1828“ erschien. Sie skizziert den historischen Hintergrund des aufstrebenden Bürgertums im 18. und 19. Jahrhundert in Deutschland und den damit einhergehenden gesellschaftlichen Veränderungen, die die Sehnsucht nach sozialem Aufstieg und individueller Leistung hervorbrachten. Die Einleitung stellt Peter Munk als Protagonisten vor, dessen Lebensweg im Fokus der Analyse steht und dessen Schicksal die zentralen Themen des Märchens vorwegnimmt. Sie kündigt die bevorstehende Auseinandersetzung mit dem romantischen Kunstmärchen und den darin enthaltenen Motiven an.
Das Kunstmärchen der Romantik: Dieses Kapitel untersucht die Gattung des romantischen Kunstmärchens. Es beleuchtet den Aufstieg des Bürgertums als gesellschaftliche und schöpferische Kraft und dessen Beschäftigung mit Sprache, Mythen und Dichtungen als Ausdruck der Seele. Der Vergleich mit den Volksmärchen der Gebrüder Grimm hebt die Unterschiede zwischen der "originalgetreuen" und der dichterischen Neugestaltung hervor. Das Kunstmärchen wird als literarisches Experiment und als "hochgradig intertextuell" beschrieben, das in ironischer Weise mit poetischen Stoffen und Motiven der Volksdichtung spielt, ohne jedoch ein rein ästhetisches Spiel zu sein, sondern auf die Wirklichkeit deutend. Die französischen Feenmärchen und orientalischen Märchensammlungen werden als Vorläufer des deutschen Kunstmärchens genannt.
Romantische Motive in „Das kalte Herz“: Dieses Kapitel analysiert typisch romantische Motive in Hauffs Märchen, insbesondere die Bedeutung von Nacht und Natur sowie die Sehnsucht als zentrale Elemente der Handlung. Es betrachtet, wie diese Motive die Atmosphäre des Märchens prägen und die inneren Konflikte des Protagonisten Peter Munk widerspiegeln. Die Analyse der Verwendung dieser Motive verdeutlicht die romantische Ästhetik und ihre Auswirkungen auf die Erzählstruktur und die Charakterentwicklung. Die Verbindung dieser Motive zu den zuvor analysierten Aspekten von Verstand und Wunderbarem wird thematisiert.
Schlüsselwörter
Romantisches Kunstmärchen, Wilhelm Hauff, „Das kalte Herz“, Sozialer Aufstieg, Berufsethos, Bürgertum, Romantik, Realismus und Fantastik, Nacht, Natur, Sehnsucht, Verstand, Einsicht, Wunderbares.
Häufig gestellte Fragen zu Wilhelm Hauffs "Das kalte Herz"
Was ist der Inhalt dieser HTML-Datei?
Diese HTML-Datei bietet eine umfassende Übersicht über eine akademische Arbeit zu Wilhelm Hauffs Kunstmärchen "Das kalte Herz". Sie enthält ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte der Arbeit, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und abschließend eine Liste von Schlüsselbegriffen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit analysiert "Das kalte Herz" im Kontext der romantischen Literatur. Zentrale Themen sind das romantische Kunstmärchen als Gattung, der soziale Aufstieg und das Berufsethos im 18. und 19. Jahrhundert, die Verbindung von Realismus und Fantastik im Märchen, sowie romantische Motive wie Nacht, Natur und Sehnsucht. Die Rolle von Verstand und Einsicht wird ebenfalls untersucht.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel über das romantische Kunstmärchen, ein Kapitel zur Analyse romantischer Motive in "Das kalte Herz" und einen Schluss. Die Einleitung stellt den Kontext des Märchens und seinen Protagonisten Peter Munk vor. Das Kapitel zum romantischen Kunstmärchen vergleicht es mit Volksmärchen und beleuchtet seine literarischen Vorläufer. Das Kapitel zu den romantischen Motiven analysiert die Bedeutung von Nacht, Natur und Sehnsucht in der Erzählung.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für die Analyse?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Romantisches Kunstmärchen, Wilhelm Hauff, "Das kalte Herz", Sozialer Aufstieg, Berufsethos, Bürgertum, Romantik, Realismus und Fantastik, Nacht, Natur, Sehnsucht, Verstand und Einsicht.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, "Das kalte Herz" als Beispiel für das romantische Kunstmärchen zu analysieren und seine zentralen Motive und Themen herauszuarbeiten. Sie untersucht den Zusammenhang zwischen dem Werk und den gesellschaftlichen Veränderungen des 18. und 19. Jahrhunderts.
Wie wird "Das kalte Herz" in der Arbeit analysiert?
Die Analyse betrachtet "Das kalte Herz" unter verschiedenen Aspekten: als literarisches Werk im Kontext der romantischen Bewegung, im Hinblick auf seine typischen romantischen Motive (Nacht, Natur, Sehnsucht) und im Bezug auf die gesellschaftlichen Veränderungen der Zeit, die den sozialen Aufstieg und das Berufsethos thematisieren. Der Vergleich mit anderen Märchenformen und die Betrachtung des Verhältnisses von Realismus und Fantastik spielen ebenfalls eine Rolle.
- Quote paper
- Regina Schultze (Author), 2010, Zum romantischen Kunstmärchen „Das kalte Herz“ , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/156017