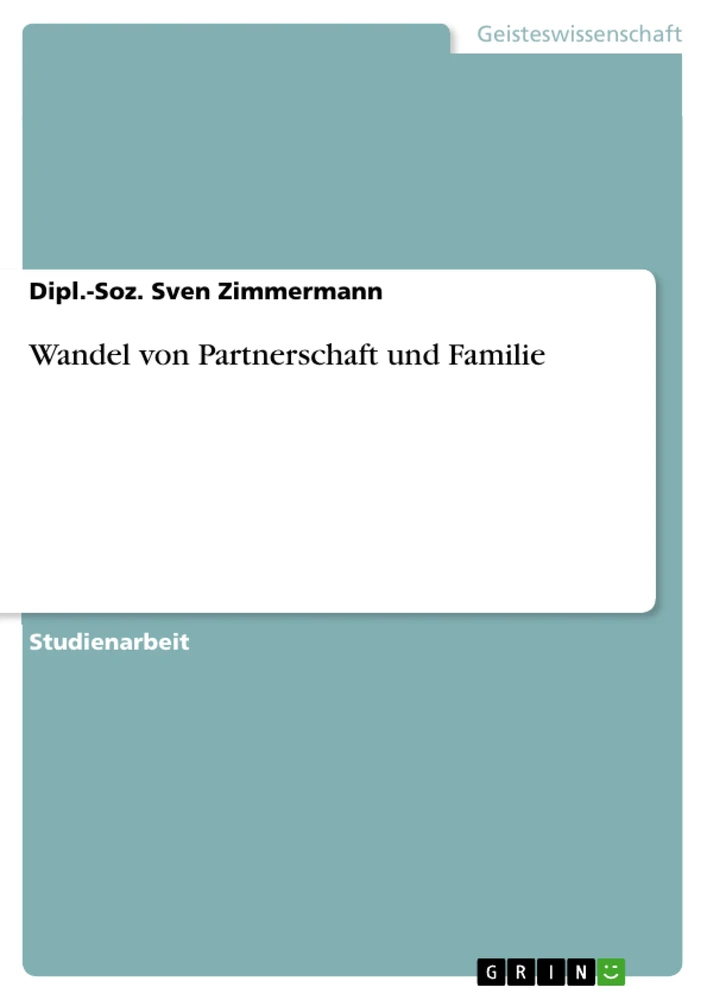Die Problematik der Familialen Arbeitsteilung ist ein Thema das wohl wie wenige andere ein besonderes Konfliktpotenzial zwischen Mann und Frau birgt. Gerade in den vergangenen Jahrzehnten hat dieses Konfliktpotenzial, durch sich stetig verändernde Rahmenbedingungen, der Möglichkeit von Frauen nahezu uneingeschränkt am Arbeitsmarkt teilzunehmen, durch die feministischen sowie studentischen Bewegungen und der Bildungsexpansion der 1970er Jahre weiter zugenommen (Peuckert 1996: 197). Das Traditionale Modell der häuslichen Arbeitsteilung sieht ohne wenn und aber den Mann in der Versorgerrolle, welcher für das Aufbringen der finanziellen Mittel durch Erwerbsarbeit sorgt. Im Gegenzug kümmert sich die Frau um den Haushalt und die Kindererziehung ohne den Mann nicht noch zusätzlich damit zu „belasten“. Dieses traditionale Modell hatte seinen Höhepunkt in den 50 er und 60 er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Doch durch die oben bereits angedeuteten Prozesse und einen generellen gesellschaftlichen Wandel kam es zu weitreichenden Änderungen. Zumindest sollte man dies annehmen.
Die vorliegende Arbeit soll einen kurzen Überblick über die vorherrschenden Theoretischen Ansätze in der Familiensoziologie zur Erklärung häuslicher Arbeitsteilung geben. In einem weiteren Teil soll dann die Ist-Situation in Deutschland skizziert werden, um aufzuzeigen ob sich aufgrund der erwähnten Veränderungsprozesse tatsächlich etwas am klassischen Modell der Familialen Arbeitsteilung geändert hat. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf den Faktoren Ehedauer, Hausarbeitszeit und der Aufgabenverteilung im Haushalt. Durch Betrachtung dieser Indikatoren soll das Bild für Deutschland skizziert werden. Weiterhin sollen diese Ergebnisse in einen kurzen innereuropäischen Vergleich diskutiert werden. Interessant ist dabei vor allem die Situation in dem, wie man annehmen kann Bildungs- und sozialpolitischen skandinavischen Vorreiterland Dänemark. Ein zu erwartendes anderes Extrem, dass des patriarchalen „Familienherrschers“, soll in Spanien erörtert werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Innerfamiliale Arbeitsteilung und familiensoziologische Theoriebildung
- 2.1. Die ökonomische Theorie der Familie
- 2.2. Der Ressourcentheoretische Ansatz
- 2.3. Der Geschlechtsrollenansatz
- 3. Innerfamiliale Arbeitsteilung in Deutschland
- 3.1. Arbeitsteilung und Ehedauer
- 3.2. Hausarbeitszeit und Aufgabenverteilung
- 4. Innerfamiliale Arbeitsteilung im europäischen Vergleich
- 5. Ergebnisdiskussion und Schlussbemerkungen
- 6. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der familialen Arbeitsteilung und beleuchtet diese aus verschiedenen theoretischen Perspektiven der Familiensoziologie. Sie analysiert die Ist-Situation in Deutschland, speziell im Hinblick auf Ehedauer, Hausarbeitszeit und Aufgabenverteilung im Haushalt. Darüber hinaus setzt sie diese Erkenntnisse in einen europäischen Vergleich, wobei Dänemark als Beispiel für einen skandinavischen Vorreiter und Spanien als Beispiel für ein eher patriarchales Modell dienen.
- Theoretische Ansätze zur Erklärung familialer Arbeitsteilung
- Die Situation der familialen Arbeitsteilung in Deutschland
- Faktoren wie Ehedauer, Hausarbeitszeit und Aufgabenverteilung
- Ein europäischer Vergleich der familialen Arbeitsteilung
- Der Wandel des traditionellen Arbeitsteilungsmusters
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der familialen Arbeitsteilung ein und betont die Relevanz dieser Thematik im Kontext gesellschaftlicher Veränderungen. Die Kapitel 2 beleuchtet verschiedene theoretische Ansätze aus der Familiensoziologie, darunter die ökonomische Theorie der Familie, der Ressourcentheoretische Ansatz und der Geschlechtsrollenansatz. Kapitel 3 fokussiert auf die Situation der familialen Arbeitsteilung in Deutschland, indem es die Faktoren Ehedauer, Hausarbeitszeit und Aufgabenverteilung im Haushalt untersucht. In Kapitel 4 wird die Situation in Deutschland in einen europäischen Vergleich mit Dänemark und Spanien gesetzt.
Schlüsselwörter
Familiale Arbeitsteilung, Familiensoziologie, Geschlechterrollen, ökonomische Theorie der Familie, Ressourcentheorie, Zeitbudget-Ansatz, Ehedauer, Hausarbeitszeit, Aufgabenverteilung, Deutschland, Dänemark, Spanien, europäischer Vergleich.
Häufig gestellte Fragen
Welche theoretischen Ansätze erklären die häusliche Arbeitsteilung?
Die Arbeit behandelt die ökonomische Theorie der Familie, den Ressourcentheoretischen Ansatz und den Geschlechtsrollenansatz.
Wie hat sich das traditionelle Versorgermodell verändert?
Trotz gesellschaftlichen Wandels und Bildungsexpansion zeigt die Arbeit, dass traditionelle Muster oft bestehen bleiben, sich aber durch veränderte Rahmenbedingungen Konfliktpotenziale ergeben.
Welche Faktoren beeinflussen die Aufgabenverteilung im Haushalt?
Zentrale Indikatoren sind die Ehedauer, die tatsächlich aufgewendete Hausarbeitszeit und die spezifische Verteilung der Aufgaben zwischen den Partnern.
Wie unterscheidet sich die Arbeitsteilung in Dänemark von Spanien?
Dänemark gilt als skandinavisches Vorreiterland für Gleichberechtigung, während Spanien in der Analyse als Beispiel für eher patriarchale Strukturen dient.
Welche Rolle spielt die Ehedauer bei der Arbeitsteilung?
Die Arbeit untersucht, ob sich die Aufteilung der Hausarbeit im Laufe der Jahre einer Ehe festigt oder zugunsten einer Seite verschiebt.
Was besagt der Ressourcentheoretische Ansatz?
Dieser Ansatz geht davon aus, dass der Partner mit den größeren Ressourcen (z.B. Einkommen, Bildung) mehr Verhandlungsmacht besitzt, um Hausarbeit zu vermeiden.
- Quote paper
- Dipl.-Soz. Sven Zimmermann (Author), 2008, Wandel von Partnerschaft und Familie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/156049