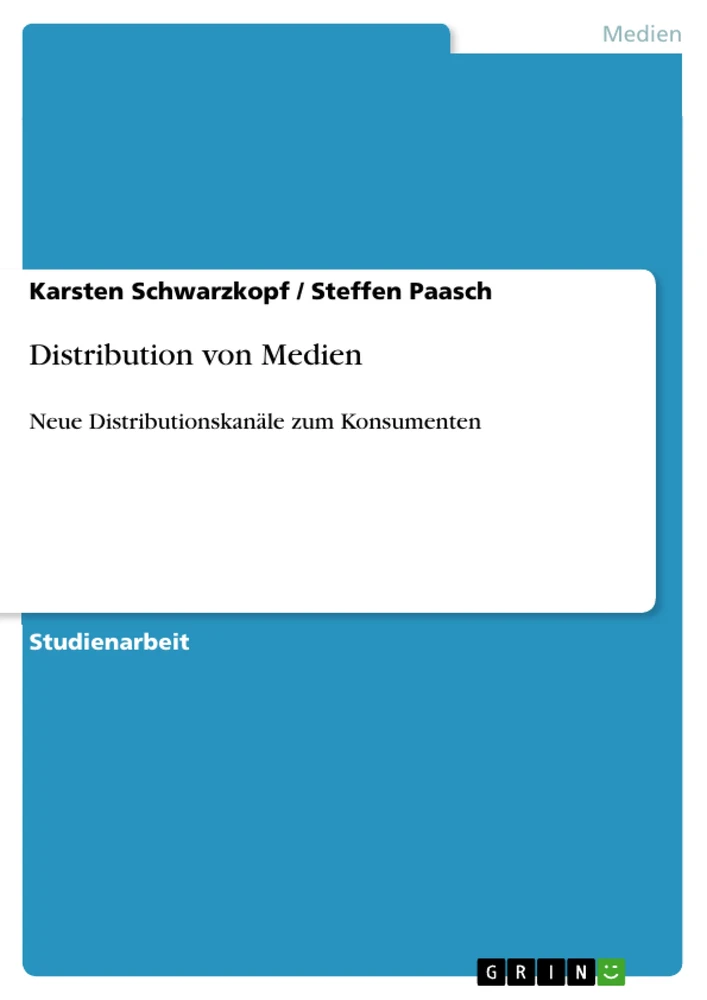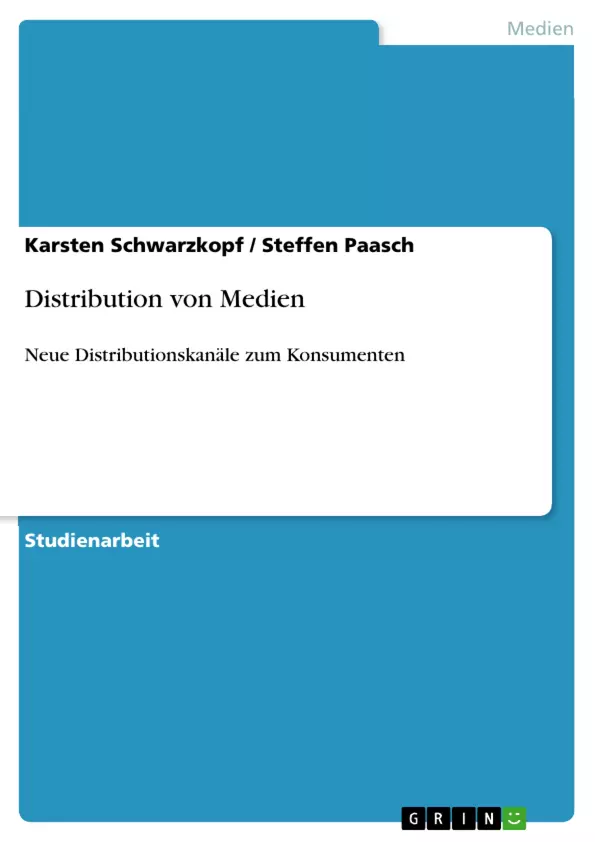In der digitalen Welt werden sich Medienkonsum, Wünsche und Ansprüche der Hörer und Zuschauer verändern - nicht in Form einer „digitalen Revolution“ sondern eher im Zuge eines evolutionären Prozesses. Ortsunabhängige, zeitsouveräne und interaktive Nutzungsformen
gewinnen immer mehr an Bedeutung. Der Medienkonsument von heute erwartet ein Angebot von HDTV auf großen Bildschirmen über Kleinbild-TV bis hin zur neuesten Literatur auf Netbooks und Handys. In einer Zeit von hunderten „Special-Interest“ Kanälen und unzähligen(semi-) professionellen Content-Angeboten bedarf es auch in Zukunft gut recherchierter, verlässlicher und von kommerziellen Interessen freier Informationsversorgung. In der analogen Welt musste sich die Medienkonsumenten noch nach den Zeiten und Programmplätzen
der Rundfunktanstalten richten. Nicht so in der digitalen Welt, in der sie unabhängig von Ort und Zeit über mehrere Verbreitungswege gezielt Inhalte abrufen und ihren Bedürfnissen anpassen können. Hörfunk, Fernsehen und Internet stehen nicht mehr separiert
nebeneinander sondern werden mehr und mehr vernetzt.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- 1 Einleitung
- 1.1 Begriffsklärung
- 2 Vertrieb von Medien
- 2.1 Printmedien
- 2.1.1 Bücher
- 2.1.2 Presse
- 2.2 Musik
- 2.3 Radio, Digitalradio, Podcast, Film und Video, Video on Demand, IPTV
- 2.3.1 Radio
- 2.3.2 Podcasts
- 2.3.3 Digital Radio
- 2.3.4 Film und Video
- 2.3.5 Video on Demand
- 2.3.6 IPTV
- 2.4 Spiele / Software
- 2.1 Printmedien
- 3 Digital Rights Management - eine mögliche Lösung?
- 3.1 Einleitung
- 3.2 Definition
- 3.3 DRM in der Praxis
- 4 Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Wandel der Mediendistribution im Kontext der Digitalisierung. Ziel ist es, einen Überblick über aktuelle Vertriebswege von Medien zu geben und die Herausforderungen der digitalen Verbreitung, insbesondere im Hinblick auf Urheberrechte, zu beleuchten.
- Veränderung der Mediendistribution durch die Digitalisierung
- Analyse verschiedener Vertriebskanäle für unterschiedliche Medien (Print, Musik, Film etc.)
- Herausforderungen des Onlinevertriebs
- Probleme der Urheberrechtswahrung im digitalen Raum
- Möglichkeiten des Digital Rights Management (DRM)
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung beschreibt den kontinuierlichen Wandel der Medienbranche und deren Vertriebswege, der eng mit dem technischen Fortschritt verbunden ist. Die zunehmende Digitalisierung und die Verbreitung des Internets führen zu einer Verlagerung vom physischen zum Onlinevertrieb. Die Arbeit gibt einen Überblick über den aktuellen Stand der Mediendistribution und beleuchtet die Herausforderungen der Verwertung digitaler Inhalte, wobei der Fokus auf dem Onlinevertrieb liegt. Die Vor- und Nachteile des digitalen Absatzhandels werden diskutiert und Lösungsansätze für Probleme bei der Wahrung und Vermarktung von Urheberrechten werden angestrebt.
2 Vertrieb von Medien: Dieses Kapitel bietet eine umfassende Übersicht über verschiedene Medien und deren Vertriebswege. Für Printmedien (Bücher und Presse) werden Direktvertrieb, einstufig und zweistufig indirekter Vertrieb erläutert, wobei der Konflikt zwischen Verlagen und Buchhandlungen im Kontext des Direktvertriebs über das Internet hervorgehoben wird. Die Distribution von Musik, Radio, Digitalradio, Podcasts, Film und Video, Video-on-Demand und IPTV wird ebenfalls behandelt, wobei die zunehmende Vernetzung dieser Medien betont wird. Schließlich wird der Vertrieb von Spielen und Software kurz angesprochen.
3 Digital Rights Management - eine mögliche Lösung?: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Digital Rights Management (DRM) als möglicher Lösungsansatz für die Probleme bei der Verwertung digitaler Inhalte. Es beginnt mit einer Definition von DRM und untersucht dessen praktische Anwendung im Kontext der Mediendistribution. Die Kapitel beleuchten die Herausforderungen und die Bedeutung von DRM im Schutz von Urheberrechten im digitalen Zeitalter.
Schlüsselwörter
Mediendistribution, Digitalisierung, Onlinevertrieb, Printmedien, Musik, Film, Video, Radio, Podcasts, Digital Rights Management (DRM), Urheberrechte, Verlagswesen, Buchhandel, Internet.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument "Mediendistribution im digitalen Wandel"
Was ist der Hauptfokus dieses Dokuments?
Der Hauptfokus liegt auf der Analyse des Wandels der Mediendistribution im Kontext der Digitalisierung. Das Dokument untersucht aktuelle Vertriebswege verschiedener Medien und die damit verbundenen Herausforderungen, insbesondere im Hinblick auf Urheberrechte.
Welche Medien werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt eine breite Palette von Medien, darunter Printmedien (Bücher und Presse), Musik, Radio, Digitalradio, Podcasts, Film, Video, Video-on-Demand, IPTV und Spiele/Software.
Welche Vertriebswege werden beschrieben?
Für Printmedien werden Direktvertrieb, einstufiger und zweistufiger indirekter Vertrieb erläutert. Für die anderen Medien werden die jeweiligen Online- und Offline-Vertriebskanäle detailliert beschrieben und deren Entwicklung im Zuge der Digitalisierung beleuchtet.
Welche Herausforderungen der digitalen Mediendistribution werden angesprochen?
Das Dokument beleuchtet die Herausforderungen des Onlinevertriebs, insbesondere die Probleme der Urheberrechtswahrung im digitalen Raum. Der Konflikt zwischen Verlagen und Buchhandlungen im Kontext des Direktvertriebs über das Internet wird ebenfalls hervorgehoben.
Welche Rolle spielt Digital Rights Management (DRM)?
Das Dokument untersucht Digital Rights Management (DRM) als möglichen Lösungsansatz für die Probleme der Urheberrechtswahrung im digitalen Raum. Es definiert DRM, beschreibt seine praktische Anwendung und diskutiert seine Herausforderungen und Bedeutung im Schutz von Urheberrechten.
Welche Kapitel enthält das Dokument?
Das Dokument gliedert sich in folgende Kapitel: Vorwort, Einleitung (inkl. Begriffsklärung), Vertrieb von Medien (mit Unterkapiteln zu verschiedenen Medientypen), Digital Rights Management - eine mögliche Lösung?, und Schlussfolgerung. Zusätzlich enthält es ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der Kapitel und Schlüsselwörter.
Welche Zielsetzung verfolgt das Dokument?
Das Dokument zielt darauf ab, einen Überblick über aktuelle Vertriebswege von Medien zu geben und die Herausforderungen der digitalen Verbreitung, insbesondere im Hinblick auf Urheberrechte, zu beleuchten.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Mediendistribution, Digitalisierung, Onlinevertrieb, Printmedien, Musik, Film, Video, Radio, Podcasts, Digital Rights Management (DRM), Urheberrechte, Verlagswesen, Buchhandel, Internet.
- Citar trabajo
- Karsten Schwarzkopf (Autor), Steffen Paasch (Autor), 2009, Distribution von Medien, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/156087