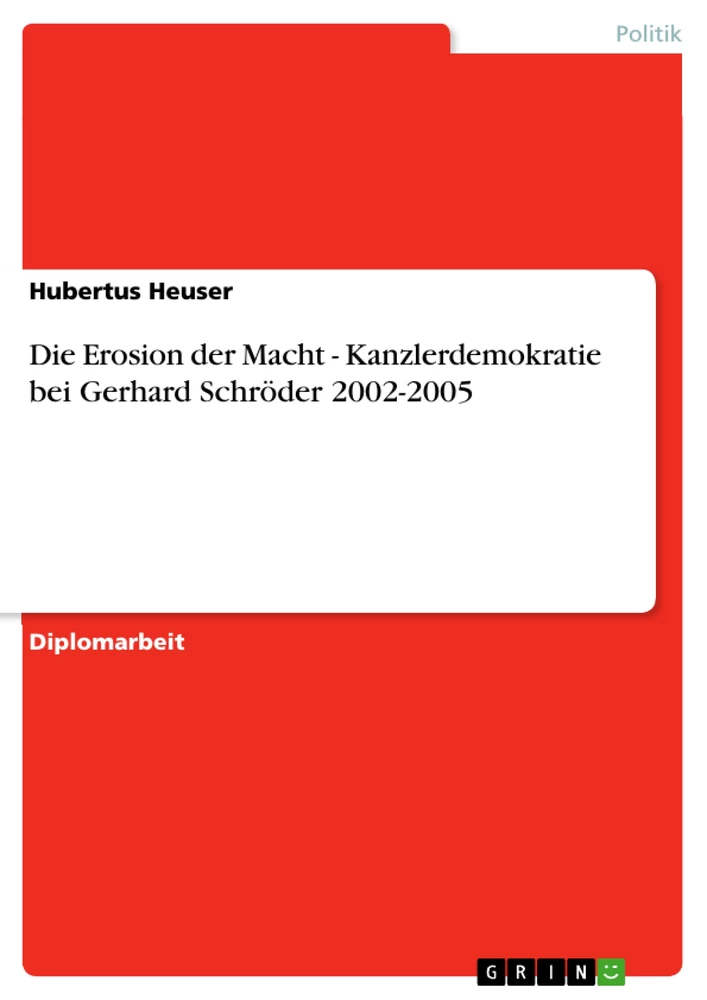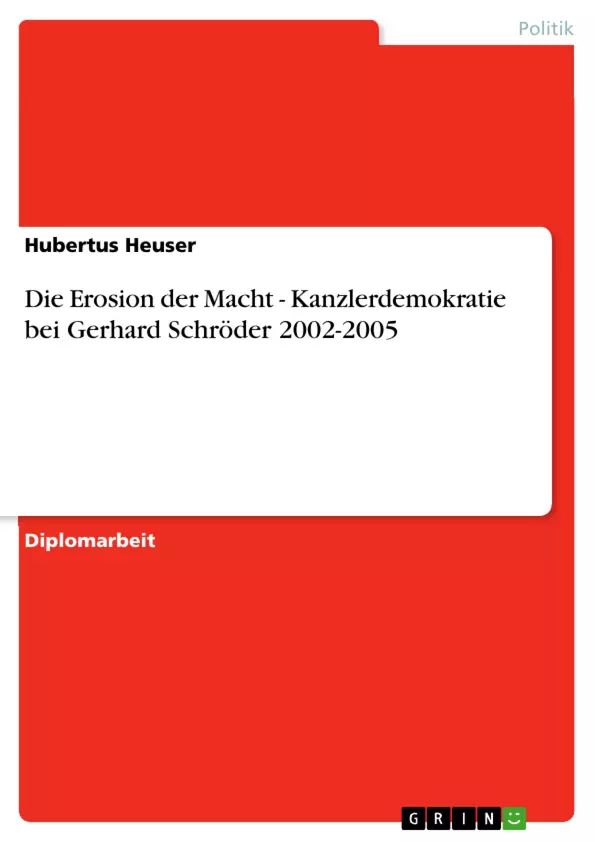Gerhard Schröder gehört wohl zu den charismatischsten Spitzenpolitikern in der jüngeren deutschen Geschichte.Aus politikwissenschaftlicher Sicht drängt sich die Frage auf, was diesen Regierungsstil eigentlich genau ausgemacht hat, und wie Schröders Machtmanagement am Ende so fulminant scheitern konnte. Diese „Erosion der Macht“, führt Schröder offenbar am Ende zu der Entscheidung für vorgezogene Neuwahlen und im September 2005 in den Machtverlust. Deshalb ist diese Entscheidung ebenfalls der Betrachtung wert, um Machterhalt und Machtverlust im System Schröder auf die Spur zu kommen.
Das Ziel dieser Arbeit ist es deshalb, politikwissenschaftlich zu analysieren, wie Gerhard Schröder in seiner zweiten Kanzlerschaft regiert hat und den Zerfall seiner politischen Macht zu untersuchen, der ihn in der Niederlage von 2005 geführt hat. Es gilt dabei insbesondere eine Erklärung zu finden für Schröders eigentliche Motive, vorgezogenen Neuwahlen anzustreben.
Die Verfassungsnorm des Art. 68 GG, die Schröder dazu benutzte, wird in der Art ihrer Anwendung noch einmal gesondert betrachtet werden.
Als Analysewerkzeug für Schröders Regierungsstil wird der von Niclauß entwickelte Regierungstyp der Kanzlerdemokratie dienen. Niclauß bietet klare Maßstäbe für die faktische politische Macht, als Analysewerkzeug wird der Regierungstyp Kanzlerdemokratie eine Aussage darüber erlauben, ob und in wieweit Gerhard Schröder in seiner zweiten Amtszeit tatsächlich ein machtvoller Kanzler in der Qualität eines Konrad Adenauer war. Die dabei gefundenen Ergebnisse werden beleuchten, welche Ausprägung der Regierungstyp Kanzlerdemokratie unter Schröder erfahren hat.
Als „Nagelprobe“ soll im zweiten Teil Schröders Entscheidung von 2005 für vorgezogene Neuwahlen untersucht werden, als Strategie dem Machtverlust etwas entgegenzusetzen. Im dritten Teil der Arbeit sollen die beiden analytischen Teile ausgewertet werden und Schröders Management der Macht aus den Ergebnissen skizziert, wie auch für dessen Zerfall bis zum Ende. Zudem bietet es sich zugleich auch an, noch einmal zum Ausgangspunkt zurückzukehren zum Niclauß’schen Analyseschema, das auf der Basis der Gesamtergebnisse noch einmal einer konstruktiven Kritik unterworfen werden soll. Inwieweit, so die Fragestellung, kann der Typus Kanzlerdemokratie die Erosion der Macht der zweiten Kanzlerschaft Schröder erklären, inwieweit benötigt es eventuell der Justierung oder Ergänzung?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Teil 1: Schröder im Kanzlertest: Kanzlerdemokratie in Theorie und Praxis
- Der Begriff „Kanzlerdemokratie“
- 3 Merkmale der Kanzlerdemokratie nach Niclauß
- Das Kanzlerprinzip
- Die Parlamentswahl - Art. 63 GG
- Das Konstruktive Misstrauensvotum - Art. 67 GG
- Die Vertrauensfrage – Art. 68 GG
- Die Richtlinienkompetenz - Art. 65, S.1 GG
- Das Kreations- und Organisationsrecht - Art. 64 I GG
- Koalitionsrunden und informelle Gremien
- Der Kanzler und die Kanzlerpartei
- Gegensatz von Regierung und Opposition
- Der Kanzler in der Außenpolitik
- Personalisierung und Medienpräsenz
- Das Kanzlerprinzip
- Die Kanzlerdemokratie in der Diskussion
- Zwischenergebnis: Diskussion um die Kanzlerdemokratie
- Ausblick: Kanzlerdemokratie bei Gerhard Schröder
- Gerhard Schröder als Bundeskanzler 1998 - 2005
- Der Fall Schröder: Kanzlerdemokratie im Praxistest
- Das Kanzlerprinzip bei Gerhard Schröder
- Schröders Kanzleramt
- Schröder als Regierungschef
- Der Kanzler und die Regierungsfraktionen
- Koalitionsrunden und informelle Gremien
- Schröders Führungsrolle in der SPD
- Schröder und die Opposition
- Schröder als Außenpolitiker
- Schröder, der Medienkanzler
- Das Kanzlerprinzip bei Gerhard Schröder
- Zwischenergebnis: Kanzlerdemokratie bei Gerhard Schröder
- Phänomenologische Analyse
- Substantielle Analyse
- Teil 2: Art. 68 GG und Schröders Entscheidung
- Schröder 2.0: Neustart oder Fehlstart?
- Art. 68 GG in der verfassungspolitischen Diskussion
- Art. 68 GG: Die Rolle des Kanzlers
- Die verfassungsrechtliche Problematik
- Schröders Vertrauensfrage: Kalkül oder Rechenfehler?
- Landtagswahlen - Anstoß zur Vertrauensfrage
- Reaktionen: Die Frage nach der Frage
- Der selbst gewählte Strick - Schröders Motive
- Ergebnis der Nagelprobe: Schröders Vertrauensfrage
- Art. 68 GG in der verfassungspolitischen Diskussion
- Teil 3: Auswertung
- Ergebnis und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit zielt darauf ab, politikwissenschaftlich zu analysieren, wie Gerhard Schröder in seiner zweiten Kanzlerschaft regiert hat und den Zerfall seiner politischen Macht zu untersuchen, der ihn in der Niederlage von 2005 geführt hat. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Erklärung von Schröders Motiven, vorgezogene Neuwahlen anzustreben. Die Verfassungsnorm des Art. 68 GG, die Schröder dazu benutzte, wird in ihrer Anwendung gesondert betrachtet.
- Die Analyse von Gerhard Schröders Regierungsstil im Kontext der „Kanzlerdemokratie“
- Die Untersuchung des Zerfalls von Schröders politischer Macht in der zweiten Amtsperiode
- Die Rolle des Art. 68 GG in Schröders Entscheidung für vorgezogene Neuwahlen
- Die Analyse der Motive hinter Schröders Entscheidung für die Vertrauensfrage
- Die Auswirkungen von Schröders Regierungsstil auf das politische System in Deutschland
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit untersucht den Regierungsstil von Gerhard Schröder im Rahmen der „Kanzlerdemokratie“. Dabei werden die theoretischen Grundlagen des Konzepts der „Kanzlerdemokratie“ nach Niclauß vorgestellt und in der Praxis am Beispiel von Schröder angewendet. Die Arbeit analysiert Schröders Regierungsstil in Bezug auf sein Kanzlerprinzip, seine Führungsrolle in der SPD, seine Beziehung zur Opposition und seine Außenpolitik. Des Weiteren wird die Rolle der Medien in Schröders Regierungsstil beleuchtet.
Ein Schwerpunkt der Arbeit liegt auf der Analyse der Entscheidung von Schröder, im Jahr 2005 die Vertrauensfrage zu stellen. Dabei werden die verfassungsrechtlichen Aspekte des Art. 68 GG untersucht und Schröders Motive hinter dieser Entscheidung beleuchtet. Die Arbeit zeigt auf, welche Folgen Schröders Vorgehen für das politische System in Deutschland hatte.
Schlüsselwörter
Kanzlerdemokratie, Gerhard Schröder, Art. 68 GG, Vertrauensfrage, Machtverlust, Regierungsstil, Medien, Politikwissenschaft, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter dem Begriff „Kanzlerdemokratie“?
Der Begriff beschreibt ein Regierungssystem, in dem der Bundeskanzler eine herausragende Machtstellung gegenüber dem Kabinett, der eigenen Partei und dem Parlament einnimmt, wie es etwa bei Konrad Adenauer der Fall war.
Warum stellte Gerhard Schröder 2005 die Vertrauensfrage?
Nach einer schweren Wahlniederlage in NRW und schwindendem Rückhalt in den eigenen Reihen nutzte Schröder Art. 68 GG, um den Weg für vorgezogene Neuwahlen freizumachen und seine Machtbasis zu klären.
Was sind die Merkmale der Kanzlerdemokratie nach Niclauß?
Zu den Merkmalen gehören das Kanzlerprinzip (Richtlinienkompetenz), die Führungsrolle in der Kanzlerpartei, der Gegensatz zwischen Regierung und Opposition sowie eine starke mediale Personalisierung.
Galt Gerhard Schröder als „Medienkanzler“?
Ja, Schröder setzte stark auf eine mediale Inszenierung und Personalisierung seiner Politik, was ein wesentlicher Bestandteil seines Regierungsstils und seines Machtmanagements war.
Was ist die „Erosion der Macht“ im Kontext der Regierungszeit Schröders?
Damit ist der schleichende Verlust an politischem Einfluss und Handlungsfähigkeit gemeint, der insbesondere in Schröders zweiter Amtszeit durch interne Parteikonflikte und Wahlniederlagen eintrat.
- Citation du texte
- Hubertus Heuser (Auteur), 2009, Die Erosion der Macht - Kanzlerdemokratie bei Gerhard Schröder 2002-2005, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/156131