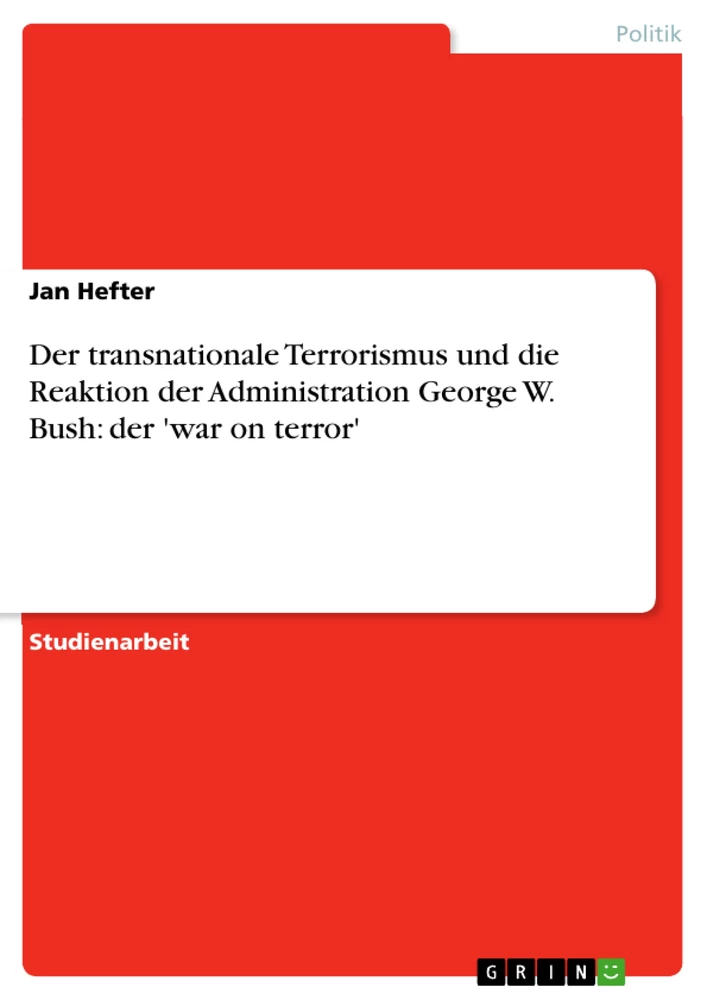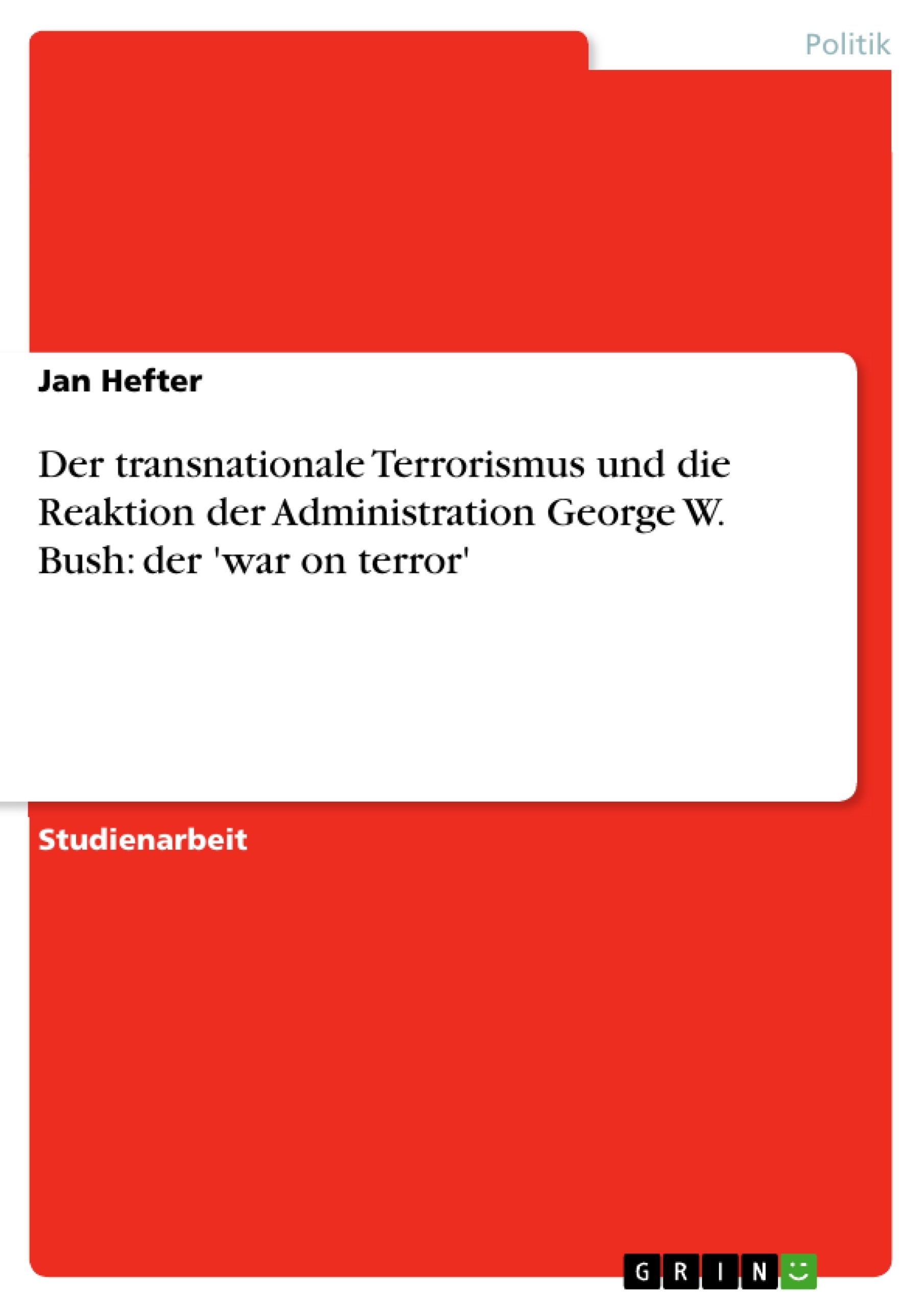[...] Dies änderte sich schlagartig am 11.September 2001. Als Terroristen an jenem Tag Flugzeuge kaperten und diese, zu Projektilen umfunktioniert, gegen das World Trade Center und das Pentagon richteten, wurde der Welt – insbesondere dem Westen - unmittelbar klar gemacht, dass die Sicherheit, in der sie sich wog, nur eine Illusion war. Mit 9/11 fand ein Paradigmenwechsel statt: Die größte Bedrohung, der es nun zu trotzen galt, war der transnationale Terrorismus. So wenig dies zu Beginn seiner Amtszeit von Relevanz war, so nachdrücklich stellte sich George W. Bush diesem Problem und focht nach 9/11 seinen war on terror.
Im Rahmen dieser Facharbeit möchte ich auf genau diesen Kampf gegen den Terror eingehen. In einem ersten Schritt werde ich zunächst mit dem transnationalen Terrorismus eine Beschreibung des Problems geben. Dazu werde ich nach einer Abgrenzung des Terrorismus von anderen Formen nichtstaatlicher Gewalt die Entstehungsgründe und Typen sowie Kalkül und die Methodik des Terrorismus beleuchten. Daraufhin konzentriere ich mich auf die Charakteristika des transnationalen Terrorismus, ohne davor seine notwendigen Vorstufen – den ‚nationalen‘ bzw. den ‚international agierenden‘ Terrorismus zu vergessen. In einem zweiten Schritt werde ich die wichtigsten Punkte der Strategie der Bush-Administration im Kampf gegen den transnationalen Terrorismus untersuchen. Nachdem ich kurz die innenpolitische Ausgangssituation für George W. Bush skizziert habe, werde ich anhand von programmatischen Reden und Dokumenten – wie zum Beispiel der National Security Strategy – die Verbreitung freiheitlich-demokratischer Werte als die allgemeine Ziele der Regierung behandeln und bewerten, um daraufhin auf die konkreten Objektive des war on terror einzugehen. Ein weiterer Fokus wird auf der in der NSS neu definierten Taktik der Präemption mit ihren Implikationen für den Kampf gegen den Terrorismus liegen. Schließlich werde ich noch einen Überblick über die operative Umsetzung der Agenda in Afghanistan und insbesondere im Irak geben, um im Schlusspart mit den gewonnen Erkenntnissen George W. Bushs war on terror einer abschließenden Bewertung zu unterziehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der transnationale Terrorismus
- Abgrenzung des Terrorismus gegenüber anderen Formen nichtstaatlicher Gewalt
- Entstehungsgründe und Typen des Terrorismus
- Terroristisches Kalkül – Methodik und Terrorismus als‚Kommunikationsstrategie‘
- Der „nationale“ und „international agierende‘ Terrorismus als Vorstufen
- Anatomie des transnationalen Terrorismus
- Die Reaktion der Bush-Administration: der,war on terror‘
- Die amerikanische Nation nach 9/11: Schock und rallye around the flagʻ
- Agenda des, war on terror
- Allgemein: Verbreitung freiheitlich-demokratischer Werte
- Kampf gegen den transnationalen Terrorismus als neue Bedrohung der Welt
- Präemption als adäquates Mittel der Wahl?
- Afghanistan und Irak: der, war on terror in der operativen Umsetzung
- Synthese
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem transnationalen Terrorismus und der Reaktion der Bush-Administration auf die Bedrohung durch diese neue Form von Gewalt. Im Zentrum steht die Analyse des „war on terror“, seiner Ziele und Strategien sowie dessen Implikationen für die globale Sicherheitspolitik.
- Abgrenzung und Definition des transnationalen Terrorismus
- Entstehungsgründe und Motivationen des Terrorismus
- Strategien und Methoden des transnationalen Terrorismus
- Die Reaktion der Bush-Administration auf den 11. September 2001
- Analyse der „war on terror“-Strategie und deren Umsetzung in Afghanistan und Irak
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die Bedeutung des Themas im Kontext der amerikanischen Politik und skizziert den historischen Wandel in der Wahrnehmung des Terrorismus. Kapitel 2 fokussiert auf die Charakteristika des transnationalen Terrorismus, einschließlich seiner Abgrenzung von anderen Formen nichtstaatlicher Gewalt, seiner Entstehungsgründe, Typen und Strategien. Kapitel 3 untersucht die Reaktion der Bush-Administration auf die Ereignisse vom 11. September, insbesondere die Agenda des „war on terror“, die Rolle der Präemption und die operative Umsetzung in Afghanistan und Irak.
Schlüsselwörter
Transnationaler Terrorismus, War on Terror, Bush-Administration, 9/11, Präemption, Afghanistan, Irak, nichtstaatliche Gewalt, Sicherheitspolitik, Freiheitlich-demokratische Werte.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter dem „war on terror“?
Dies bezeichnet die globale Militär- und Sicherheitsstrategie der Bush-Administration als Reaktion auf die Terroranschläge vom 11. September 2001.
Wie unterscheidet sich transnationaler Terrorismus von nationalem Terrorismus?
Transnationaler Terrorismus agiert über Staatsgrenzen hinweg, nutzt globale Netzwerke und richtet sich oft gegen internationale Symbole oder Wertegemeinschaften.
Was beinhaltet die Strategie der Präemption in der National Security Strategy (NSS)?
Präemption bedeutet das Recht auf militärische Erstschläge gegen potenzielle Bedrohungen, bevor diese einen Angriff ausführen können, um die nationale Sicherheit zu gewährleisten.
Welche Rolle spielten Afghanistan und der Irak im Kampf gegen den Terror?
Diese Länder waren die Hauptschauplätze der operativen Umsetzung des „war on terror“, mit dem Ziel, terroristische Regime zu stürzen und demokratische Werte zu verbreiten.
Was ist das „terroristische Kalkül“?
Es beschreibt Terrorismus als Kommunikationsstrategie, die darauf abzielt, durch psychologische Wirkung und Angst politische Veränderungen zu erzwingen.
- Citar trabajo
- Jan Hefter (Autor), 2010, Der transnationale Terrorismus und die Reaktion der Administration George W. Bush: der 'war on terror', Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/156164