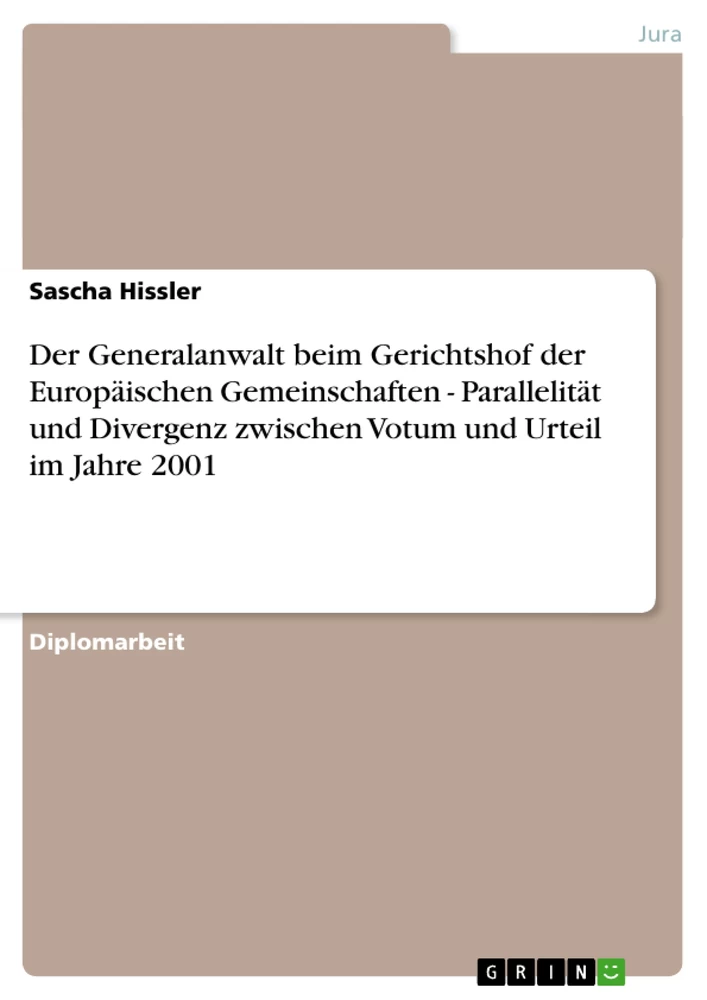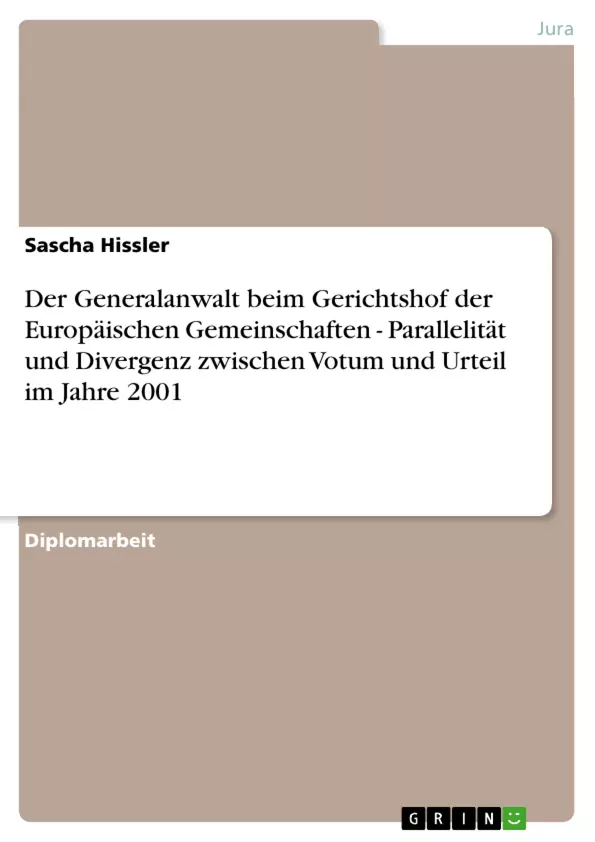Das erste Kapitel rekonstruiert die Entstehung des Gerichtshofes von seinen Anfängen 1952 als Gerichtshof der EGKS bis hin zu seiner heutigen Gestalt als supranationales Gerichtssystem, bestehend aus dem Europäischen Gerichtshof und dem diesen beigeordneten Gericht erster Instanz - beide zuständig für die 15 Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Der dominante Einfluss des französischen Rechtskreises auf die Geburt des Gerichtshofes wird besonders bei der Einrichtung der Institution des Generalanwaltes deutlich, dessen Entwicklung vom Ursprung bis zum gegenwärtigen Stand der Dinge nachgezeichnet wird.
Im Sinne eines systematischen Aufbaus ist es unerlässlich, die Quellen des Gemeinschaftsrechts zu erforschen, bevor im zweiten Kapitel die unterschiedlichen Verfahrensarten vor dem EuGH erörtert werden. Nach einem Exkurs über die Sprachenregelung am Gerichtshof, die in naher Zukunft „babylonische Ausmaße“ anzunehmen scheint, schließen sich die Ausführungen zum Generalanwalt, dem Untersuchungsgegenstand dieser Diplomarbeit, an.
Seine Rechtsstellung, Aufgaben, Befugnisse und Funktionen werden im dritten Kapitel umfassend beleuchtet und Abgrenzungen zu den europäischen Richtern, denen die Generalanwälte zuarbeiten, vorgenommen.
Die dem Generalanwalt obliegende Amtspflicht, das Verfassen und Vortragen der Schlussanträge, wird ausführlich im vierten Kapitel beschrieben. Sodann werden die Schlussanträge den ergangenen Urteilen gegenübergestellt. Die verschiedenen Methoden der Rechtsauslegung erläutert das Ende des vierten Kapitels, unter besonderer Berücksichtigung der für das Europarecht spezifischen finalen Auslegungsmethode.
Ein ausführlicher Vergleich zwischen allen Urteilen des Jahres 2001 und den dazugehörigen Schlussanträgen findet sich im Anhang der Diplomarbeit. Hieraus erklärt sich der gewählte Untertitel für die vorliegende Arbeit: „Parallelität und Divergenz zwischen Votum und Urteil“.
Die Frage, ob und in welchem Ausmaß der Gerichtshof dem Schlussantrag des Generalanwaltes folgt, wird im fünften Kapitel beantwortet.
Im letzten findet sich das exklusive Interview mit dem deutschen Generalanwalt am EuGH Siegbert Alber, der nicht nur aus seiner Arbeitspraxis erzählt, sondern auch seine ganz persönliche Sicht auf das Amt des Generalanwaltes und des Gerichtshofes erläutert.
Inhaltsverzeichnis
- I. Inhaltsverzeichnis
- II. Abkürzungsverzeichnis
- III. Einleitung
- IV. Hauptteil
- 1. Der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften
- 1.1. Entstehung des Gerichtshofes
- 1.2. Ursprung des Generalanwaltes
- 1.3. Numerische Entwicklung der Richter und Generalanwälte
- 1.4. Quellen des Gemeinschaftsrechts
- 2. Die Verfahrensarten vor dem Europäischen Gerichtshof
- 2.1. Vorabentscheidungsverfahren
- 2.2. Nichtigkeitsklage
- 2.3. Untätigkeitsklage
- 2.4. Vertragsverletzungsverfahren
- 2.5. Rechtsmittelverfahren
- 2.6. Schiedsverfahren
- 2.7. Sonstige Verfahrensarten
- 2.8. Die Sprachenregelung
- 3. Der Generalanwalt
- 3.1. Personalstruktur und Rechtsstellung
- 3.2. Ernennung der Richter und Generalanwälte
- 3.3. Aufgaben und Befugnisse des Generalanwaltes
- 3.4. Der Generalanwalt in der Verfahrensordnung des EuGH
- 3.5. Der Generalanwalt in der mündlichen Verhandlung
- 4. Die Dokumente der Rechtsprechung
- 4.1. Der Schlussantrag
- 4.1.1. Verfassen des Schlussantrages
- 4.1.2. Vortrag des Schlussantrages
- 4.1.3. Einreichung einer Stellungnahme zu dem Schlussantrag
- 4.2. Das Urteil
- 4.3. Methoden der Rechtsauslegung
- 4.1. Der Schlussantrag
- 5. Vergleich zwischen Schlussanträgen und Urteilen
- 5.1. Überblick über die Rechtsprechungstätigkeit
- 5.2. Analyse der Urteile und Schlussanträge
- 5.3. Fazit
- 6. Selbstverständnis eines Generalanwaltes
- 1. Der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften
- V. Schlussworte
- VI. Literaturverzeichnis
- VII. Kommentare und Sammelbände
- VIII. Zeitungsartikel
- IX. Zeitschriftenverzeichnis
- X. Rechtsquellen
- XI. Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Parallelität und Divergenz zwischen den Schlussanträgen des Generalanwalts und den Urteilen des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften im Jahr 2001. Ziel ist es, die Rolle des Generalanwalts im europäischen Rechtsraum zu beleuchten und das Verhältnis seiner Schlussanträge zu den nachfolgenden Urteilen zu analysieren.
- Rolle des Generalanwalts beim Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften
- Vergleichende Analyse von Schlussanträgen und Urteilen
- Methoden der Rechtsauslegung im europäischen Kontext
- Einfluss des Generalanwalts auf die Rechtsprechung
- Verfahrensabläufe vor dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften
Zusammenfassung der Kapitel
1. Der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften: Dieses Kapitel beschreibt die Entstehung und Entwicklung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften, einschließlich der historischen Entwicklung des Amtes des Generalanwalts und der numerischen Entwicklung von Richtern und Generalanwälten. Es beleuchtet die institutionellen Grundlagen des Gerichtshofs und die Quellen des Gemeinschaftsrechts, die seine Entscheidungen beeinflussen. Die historische Perspektive liefert einen wichtigen Kontext für das Verständnis der heutigen Rolle des Gerichtshofs und des Generalanwalts. Die Diskussion der Quellen des Gemeinschaftsrechts unterstreicht die Komplexität der Rechtslage, innerhalb derer der Generalanwalt seine Schlussanträge formuliert.
2. Die Verfahrensarten vor dem Europäischen Gerichtshof: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über die verschiedenen Verfahrensarten vor dem Europäischen Gerichtshof. Von Vorabentscheidungsverfahren bis hin zu Vertragsverletzungsverfahren werden die unterschiedlichen Verfahren detailliert beschrieben. Die Einbeziehung von Rechtsmittelverfahren und der Sprachenregelung verdeutlicht die Komplexität des europäischen Rechtssystems und die Herausforderungen, vor denen der Generalanwalt steht, wenn er Schlussanträge in diesen unterschiedlichen Verfahren erstellt. Die Betrachtung der Verfahren liefert wichtige Erkenntnisse über den Kontext, in dem der Generalanwalt tätig wird und wie dieser Kontext seine Schlussanträge beeinflusst.
3. Der Generalanwalt: Das Kapitel konzentriert sich auf die Rolle, die Aufgaben und die Befugnisse des Generalanwalts. Es werden die Personalstruktur, die Ernennungsprozesse und der Stellenwert des Generalanwalts innerhalb der Verfahrensordnung des EuGH untersucht. Die Analyse der Aufgaben und Befugnisse beleuchtet die Bedeutung des Generalanwalts im Verfahren und wie er seine Rolle in der mündlichen Verhandlung ausübt. Die Untersuchung der rechtlichen und institutionellen Grundlagen seiner Tätigkeit liefert den Rahmen für die spätere Vergleichsanalyse von Schlussanträgen und Urteilen.
4. Die Dokumente der Rechtsprechung: Hier werden die Schlussanträge des Generalanwalts und die Urteile des Gerichtshofs als zentrale Dokumente der europäischen Rechtsprechung vorgestellt. Der Prozess des Verfassens und Vortragens der Schlussanträge wird ebenso detailliert beschrieben wie die Erstellung der Urteile. Die Erörterung der Methoden der Rechtsauslegung liefert ein tieferes Verständnis der juristischen Herangehensweise beider Akteure und legt die Grundlage für einen systematischen Vergleich.
5. Vergleich zwischen Schlussanträgen und Urteilen: In diesem Kapitel wird eine eingehende Analyse der Parallelitäten und Divergenzen zwischen den Schlussanträgen des Generalanwalts und den Urteilen des Gerichtshofs im Jahr 2001 vorgenommen. Anhand konkreter Fallstudien werden die Übereinstimmungen und Abweichungen zwischen beiden Dokumenten untersucht. Die Analyse legt den Fokus auf die Gründe für die Übereinstimmungen und Abweichungen, um ein umfassendes Bild des Verhältnisses zwischen Schlussantrag und Urteil zu erstellen und die Einflüsse zu beleuchten, welche die Entscheidungen des Gerichtshofs mitbestimmen.
Schlüsselwörter
Europäischer Gerichtshof, Generalanwalt, Schlussantrag, Urteil, Gemeinschaftsrecht, Rechtsprechung, Verfahrensarten, Rechtsauslegung, Parallelität, Divergenz, Rechtsvergleich.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Schlussanträge des Generalanwalts und Urteile des EuGH
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht die Übereinstimmung und die Unterschiede zwischen den Schlussanträgen des Generalanwalts und den Urteilen des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften (EuGH) im Jahr 2001. Sie analysiert die Rolle des Generalanwalts im europäischen Rechtssystem und das Verhältnis seiner Schlussanträge zu den darauf folgenden Urteilen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: die Rolle des Generalanwalts beim EuGH, einen Vergleich zwischen Schlussanträgen und Urteilen, Methoden der Rechtsauslegung im europäischen Kontext, den Einfluss des Generalanwalts auf die Rechtsprechung und die Verfahrensabläufe vor dem EuGH. Die Arbeit beinhaltet auch eine detaillierte Beschreibung der Entstehung und Entwicklung des EuGH, der verschiedenen Verfahrensarten vor dem Gericht und der Aufgaben und Befugnisse des Generalanwalts.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Inhaltsverzeichnis, Abkürzungsverzeichnis, Einleitung, Hauptteil (mit Unterkapiteln zu EuGH, Verfahrensarten, Generalanwalt, Rechtsprechungsdokumenten, Vergleich von Schlussanträgen und Urteilen und dem Selbstverständnis eines Generalanwalts), Schlussworte, Literaturverzeichnis, Kommentare und Sammelbände, Zeitungsartikel, Zeitschriftenverzeichnis, Rechtsquellen und Anhang.
Wie wird der Vergleich zwischen Schlussanträgen und Urteilen durchgeführt?
Der Vergleich zwischen Schlussanträgen und Urteilen erfolgt anhand einer eingehenden Analyse der Parallelitäten und Divergenzen im Jahr 2001. Konkrete Fallstudien werden verwendet, um Übereinstimmungen und Abweichungen zu untersuchen und die Gründe hierfür zu beleuchten. Die Analyse zielt darauf ab, ein umfassendes Bild des Verhältnisses zwischen Schlussantrag und Urteil zu erstellen und die Einflüsse auf die Entscheidungen des Gerichtshofs zu verdeutlichen.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit bezieht sich auf verschiedene Quellen, darunter Literaturverzeichnis, Kommentare und Sammelbände, Zeitungsartikel, Zeitschriften und Rechtsquellen. Die genaue Auflistung dieser Quellen findet sich im entsprechenden Abschnitt der Arbeit.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Europäischer Gerichtshof, Generalanwalt, Schlussantrag, Urteil, Gemeinschaftsrecht, Rechtsprechung, Verfahrensarten, Rechtsauslegung, Parallelität, Divergenz, Rechtsvergleich.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, die Rolle des Generalanwalts im europäischen Rechtsraum zu beleuchten und das Verhältnis seiner Schlussanträge zu den nachfolgenden Urteilen zu analysieren. Die Arbeit soll ein besseres Verständnis für die Funktionsweise des EuGH und den Einfluss des Generalanwalts auf die Rechtsprechung liefern.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für akademische Zwecke gedacht und dient der Analyse von Themen im europäischen Recht. Sie richtet sich an Personen, die sich für die Funktionsweise des EuGH, die Rolle des Generalanwalts und die europäische Rechtsprechung interessieren.
- Quote paper
- Diplom-Staatswissenschaftler (univ.) Sascha Hissler (Author), 2003, Der Generalanwalt beim Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften - Parallelität und Divergenz zwischen Votum und Urteil im Jahre 2001, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/15619