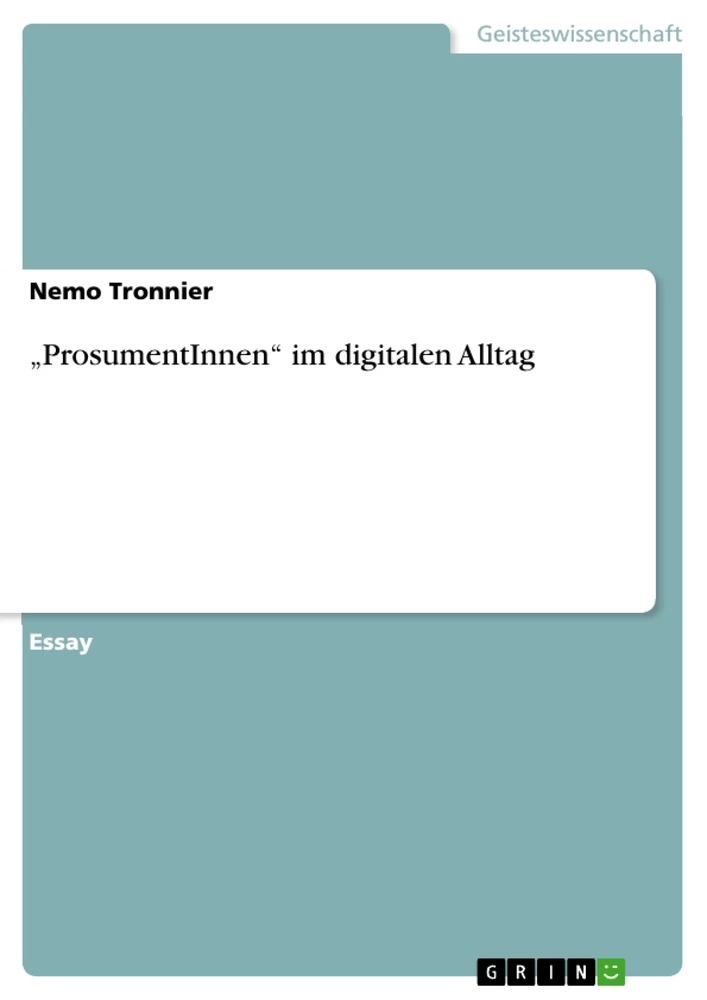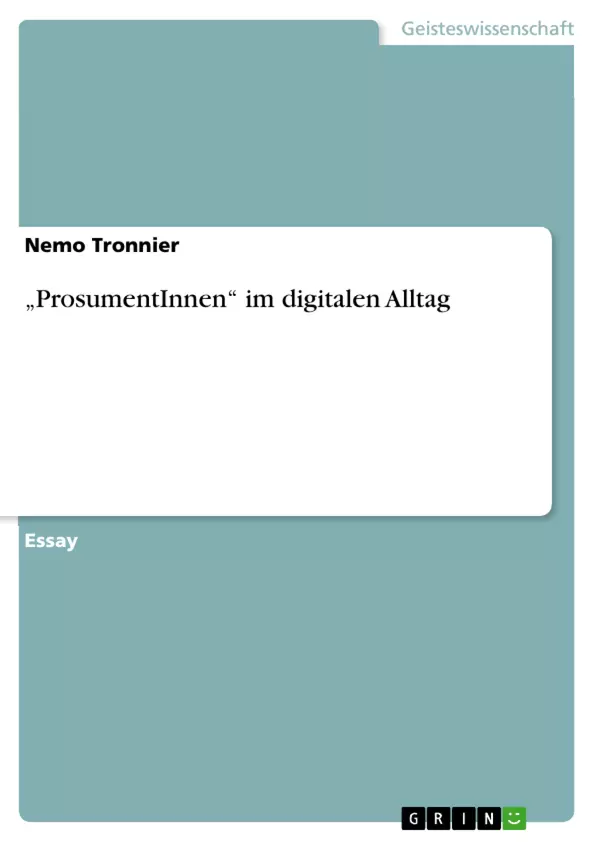Durch eine Reihe neu erschienener Texte findet das Phänomen Prosuming im akademischen Diskurs aktuell breite Aufmerksamkeit. Doch was bedeutet dieser Begriff überhaupt? Das Wort „Prosument“ ist eine begriffliche Neuschöpfung, ein Kofferwort, bestehend aus den Begriffen Produzent und Konsument. Seinen Ursprung nahm die Diskussion um dieses Phänomen in dem 1981 erschienenen Buch von Alvin Toffler: „Die Dritte Welle“ .
„ProsumentInnen“ im digitalen Alltag
Durch eine Reihe neu erschienener Texte findet das Phänomen Prosuming im akademischen Diskurs aktuell breite Aufmerksamkeit. Doch was bedeutet dieser Begriff überhaupt? Das Wort „Prosument“ ist eine begriffliche Neuschöpfung, ein Kofferwort, bestehend aus den Begriffen Produzent und Konsument. Seinen Ursprung nahm die Diskussion um dieses Phänomen in dem 1981 erschienenen Buch von Alvin Toffler: „Die Dritte Welle“[1]. In dem Kapitel: „Der Aufstieg des Prosumenten“ beschreibt Toffler eine neue Art von Konsumtion anhand des heute eher profan wirkenden Beispiels eines Schwangerschaftstests:
„ Winzige Veränderungen im Alltagsverhalten symbolisieren mitunter gewaltige historische Umbrüche. Eine solche Veränderung, deren Bedeutung fast niemandem auffiel, ereignete sich in den frühen siebziger Jahren, als in den Apotheken Frankreichs, Englands, Hollands und anderer europäischer Länder ein neues Produkt eingeführt wurde. Es handelt sich dabei um Schwangerschaftstests zur Selbstuntersuchung “(Toffler, 1980, S.272).
Was Toffler anhand des „Schwangerschaftstest zur Selbstuntersuchung“ zeigen wollte ist, dass Tätigkeiten welche bisher durch Experten, Angestellte oder Arbeiter übernommen wurden nun (wieder) von den Individuen selbst durchgeführt werden. Weitere Beispiele für diese Entwicklung bei Toffler sind Selbsthilfegruppen, die Do-It-Yourself-Bewegung, Selbstzapfen an Tankstellen, Selbstbedienung in der Bank oder dem Supermarkt und Kundenhotlines. Diese Beispiele mögen uns heute als selbstverständlich erscheinen, doch bieten sie einen Blick auf für unsere heutigen Augen verborgene Vorgänge die von einer Selbstverständlichkeit bestimmter Tätigkeiten ausgehen. Wie und wo überall Arbeit „ausgelagert“ wird, bleibt den Menschen meist verborgen. So hat eines der Ursprungsbeispiele des Lehrforschungsprojekts; das Tablett bei MacDonalds selbstständig wegzubringen, vielen Teilnehmern des Lehrforschungsprojektes erstmals die Augen für die Einbeziehung des Kunden in bestimmte Arbeitsprozesse geöffnet. George Ritzer beschreibt in seinem Buch „The McDonaldization of Society“ diese Praxis als eines der Erfolgsgeheimnisse des standardisierten Geschäftsmodells McDonalds[2].
Im weiteren Verlauf des Kapitels: „Der Aufstieg des Prosumenten“ führt Toffler eine historische Einordnung verschiedener Stadien der menschlichen Ökonomie durch. In der von ihm so bezeichneten „Ersten Welle“ seien die Menschen schon einmal Prosumenten gewesen; sie konsumierten, was sie selbst produzierten. Die industrielle Revolution trennte diese beiden Tätigkeiten, was zur Ausbreitung des Marktes führte. Die „Zweite Welle“ umfasste aber selbstverständlich nicht die Trennung aller Tätigkeiten zwischen Produktion und Konsumtion, weshalb es nach Toffler sinnvoll sei von zwei verschiedenen Sektoren der Wirtschaft auszugehen. Sektor A umfasse die unbezahlte Arbeit, wohingegen Sektor B die marktförmige Vermittlung von Gütern und Dienstleistungen beinhalte. Sektor A, heute auch oftmals Schattenwirtschaft oder informelle Ökonomie genannt[3] ist bei der „Ersten Welle“ besonders groß, während Sektor B in der „Zweiten Welle“ den größten Anteil hat. Sektor A zu ignorieren sei einer der größten Fehler des Industriezeitalters gewesen. Aktuell sei ein Wiedererstarken des Prosumenten zu konstatieren. Mit der Renaissance des Prosumenten verbindet Toffler Hoffnungen auf eine Transformation des Marktes mit emanzipatorischem Potential für die involvierten Individuen:
[...]
[1] Toffler, Alvin; 1980; Die dritte Welle, Zukunftschance: Perspektiven für die Gesellschaft des 21. Jahrhunderts; München: Bertelsmann Verlag.
[2] Ritzer, George; 2007; The McDonaldization of society 5; Pine Forge Press.
Häufig gestellte Fragen zu "ProsumentInnen" im digitalen Alltag
Was bedeutet der Begriff "Prosument"?
Der Begriff "Prosument" ist eine Wortneuschöpfung, ein Kofferwort, bestehend aus den Begriffen Produzent und Konsument. Er beschreibt Individuen, die sowohl konsumieren als auch produzieren.
Woher stammt der Begriff "Prosument"?
Die Diskussion um das Phänomen Prosuming nahm ihren Ursprung in dem 1981 erschienenen Buch "Die Dritte Welle" von Alvin Toffler.
Was wollte Toffler anhand des Beispiels "Schwangerschaftstest zur Selbstuntersuchung" zeigen?
Toffler wollte zeigen, dass Tätigkeiten, die bisher von Experten, Angestellten oder Arbeitern übernommen wurden, nun (wieder) von den Individuen selbst durchgeführt werden.
Welche weiteren Beispiele für Prosuming nennt Toffler?
Weitere Beispiele sind Selbsthilfegruppen, die Do-It-Yourself-Bewegung, Selbstzapfen an Tankstellen, Selbstbedienung in der Bank oder im Supermarkt und Kundenhotlines.
Wie ordnet Toffler die verschiedenen Stadien der menschlichen Ökonomie historisch ein?
Toffler unterscheidet drei Wellen: In der "Ersten Welle" waren die Menschen Prosumenten, da sie konsumierten, was sie selbst produzierten. Die industrielle Revolution (die "Zweite Welle") trennte diese beiden Tätigkeiten. Aktuell sieht er ein Wiedererstarken des Prosumenten (die "Dritte Welle").
Was sind Sektor A und Sektor B in Tofflers Modell?
Sektor A umfasst die unbezahlte Arbeit (Schattenwirtschaft oder informelle Ökonomie), während Sektor B die marktförmige Vermittlung von Gütern und Dienstleistungen beinhaltet.
Wie beschreibt George Ritzer die Einbeziehung des Kunden in Arbeitsprozesse bei McDonalds?
George Ritzer beschreibt in seinem Buch "The McDonaldization of Society" diese Praxis als eines der Erfolgsgeheimnisse des standardisierten Geschäftsmodells McDonalds.
- Quote paper
- Nemo Tronnier (Author), 2009, „ProsumentInnen“ im digitalen Alltag, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/156222