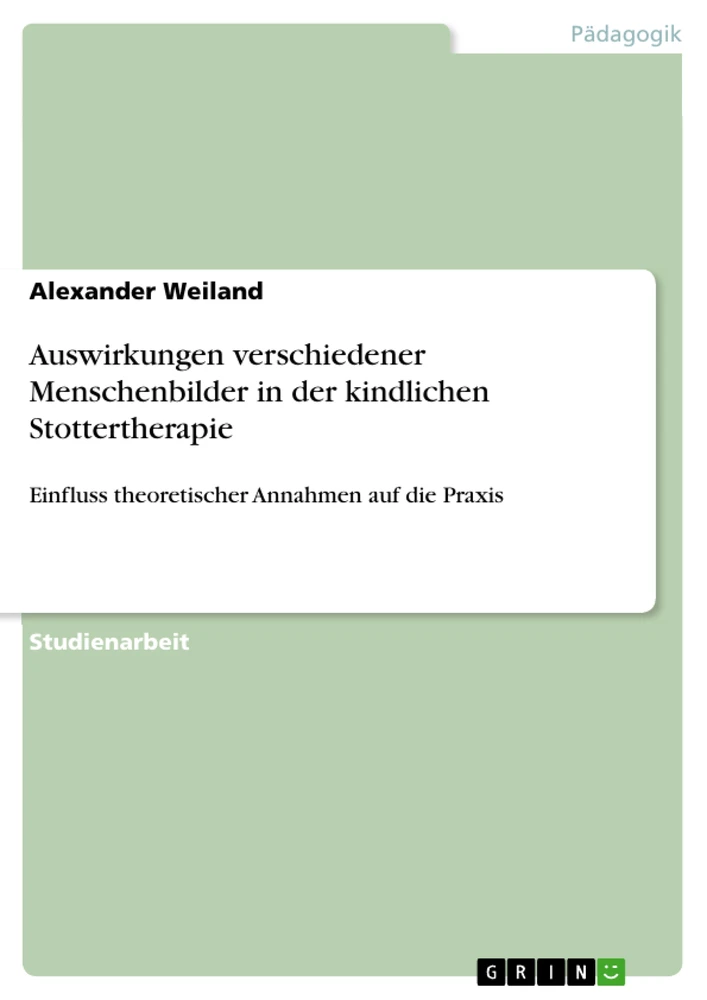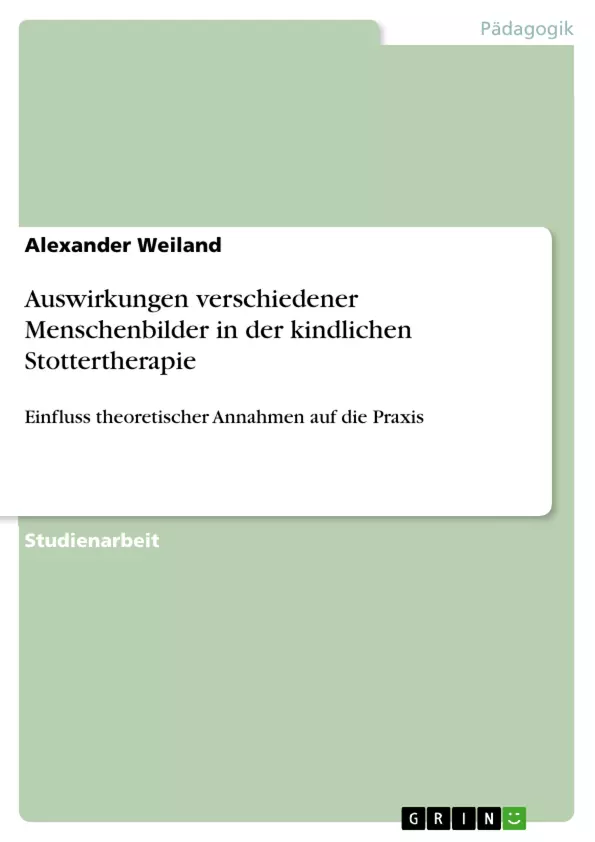Eine vollständige Erfassung des Phänomens „Stottern“ ist unter anderem aufgrund ungeklärter Hypothesen zur Entstehung und der Vielseitigkeit des Auftretens, nicht möglich. Um dennoch theoretisches und praktisches Vorgehen zu ermöglichen, wurden Theorien über den Gegenstand des Stotterns entwickelt, beispielsweise über seine Ursachen, seine Verbreitung oder über Möglichkeiten das Phänomen zu verändern. Letztere Theorien, die das Stottern zu verändern versuchen, unterscheiden sich in der Literatur durch ihre Sicht auf das Phänomen, sowie ihre formulierten Ziele und Abläufe. Dadurch entstanden Fragen bezüglich der theoretischen Fundierung verschiedener Therapieformen sowie deren praktischer Ausgestaltung. [...]
Die theoretischen Hintergründe einer Therapie, und vor allem ihre konkreten Auswirkungen, sollen im Verlauf der Arbeit verdeutlicht und bewertet werden. Dazu sollen zunächst die Begrifflichkeiten des kindlichen Stotterns und des Menschenbildes geklärt werden, bevor die Darstellung zweier unterschiedlicher Therapieformen folgt. Abschließend wird versucht, die Frage nach den Auswirkungen theoretischer Annahmen in der Praxis der kindlichen Stottertherapie zu klären.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffliche Klärung
- Stottern - eine Sprechstörung
- Kindliches Stottern
- Annahmen über den Menschen
- Theorie und Menschenbild
- Der handelnde Mensch
- Der Mensch als Objekt seiner Umwelt
- Darstellung zweier Stottertherapien
- Stottertherapie
- Der lokale Ansatz - Stottermodifikation
- Der globale Ansatz - Fluency Shaping
- Das Menschenbild und seine Auswirkungen
- Der Mensch in der Praxis der lokalen Stottertherapie
- Voraussetzungen des Patienten
- Therapeut-Patienten Verhältnis
- Therapeutische Mittel
- Bewertung des lokalen Ansatzes hinsichtlich seines Menschenbildes
- Der Mensch in der Praxis der globalen Stottertherapie
- Voraussetzungen des Patienten
- Therapeut-Patienten Verhältnis
- Therapeutische Mittel
- Bewertung des globalen Ansatzes hinsichtlich seines Menschenbildes
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen verschiedenen Menschenbildern und deren Auswirkungen auf die Praxis der kindlichen Stottertherapie. Ziel ist es, die theoretischen Grundlagen unterschiedlicher Therapieformen zu beleuchten und deren praktische Ausgestaltung zu analysieren. Der Fokus liegt dabei auf der Bedeutung des Menschenbildes für die Therapiewahl und deren Umsetzung.
- Begriffliche Klärung von Stottern und unterschiedlichen Menschenbildern
- Analyse zweier gegensätzlicher Stottertherapien (lokaler und globaler Ansatz)
- Untersuchung des Einflusses des Menschenbildes auf die therapeutische Praxis
- Bewertung der jeweiligen Therapieansätze im Hinblick auf ihre theoretischen Grundlagen
- Verknüpfung von Theorie und Praxis in der kindlichen Stottertherapie
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und begründet die Relevanz der Untersuchung des Zusammenhangs zwischen theoretischen Annahmen über den Menschen und der praktischen Anwendung in der kindlichen Stottertherapie. Sie hebt die Schwierigkeit einer vollständigen Erfassung des Phänomens "Stottern" hervor und argumentiert für die Notwendigkeit einer kritischen Auseinandersetzung mit den theoretischen Grundlagen verschiedener Therapieformen. Der Fokus liegt auf dem Einfluss des Menschenbildes und dessen Bedeutung für ein selbstständiges und verantwortungsvolles Handeln in der therapeutischen Praxis.
Begriffliche Klärung: Dieses Kapitel klärt die Begrifflichkeiten von Stottern und verschiedenen Menschenbildern. Es präsentiert unterschiedliche Definitionen von Stottern, wobei der Schwerpunkt auf einer deskriptiven Beschreibung der Symptome liegt, ohne die Ursachen zu spezifizieren. Der Fokus liegt auf der Unterscheidung zwischen kindlichem Stottern und anderen Sprech- oder Sprachstörungen. Das Kapitel bereitet den Boden für die spätere Analyse der therapeutischen Ansätze, indem es die verschiedenen theoretischen Perspektiven auf den Menschen einführt. Die Vielschichtigkeit des Stotterns wird betont, und es wird auf die Schwierigkeiten hingewiesen, eine allgemeingültige Definition zu formulieren.
Darstellung zweier Stottertherapien: Dieses Kapitel beschreibt zwei gegensätzliche Ansätze in der Stottertherapie: den lokalen Ansatz (Stottermodifikation) und den globalen Ansatz (Fluency Shaping). Es skizziert die grundlegenden Prinzipien beider Methoden, ohne in detaillierte Therapieverfahren einzugehen. Der Fokus liegt auf der Darstellung der jeweiligen Herangehensweisen an das Problem des Stotters und deren unterschiedliche Zielsetzungen. Die unterschiedlichen therapeutischen Strategien werden kurz dargestellt und bilden den Ausgangspunkt für die anschließende Analyse des Menschenbildes in beiden Therapieformen.
Das Menschenbild und seine Auswirkungen: Dieses Kapitel analysiert die Auswirkungen der jeweiligen Menschenbilder auf die Praxis der lokalen und globalen Stottertherapie. Es untersucht die Rolle des Patienten, die Beziehung zwischen Therapeut und Patient und die eingesetzten therapeutischen Mittel im Kontext der jeweiligen theoretischen Grundlagen. Es wird detailliert auf die Voraussetzungen des Patienten, das Therapeut-Patienten-Verhältnis und die therapeutischen Mittel eingegangen. Die Kapitel analysieren kritisch die jeweiligen Therapieansätze und deren Implikationen für das Verständnis des Menschen und dessen Rolle im therapeutischen Prozess.
Schlüsselwörter
Kindliches Stottern, Stottertherapie, Menschenbild, lokaler Ansatz, globaler Ansatz, Stottermodifikation, Fluency Shaping, Theorie, Praxis, Therapeut-Patienten-Beziehung, therapeutische Mittel, Sprechflüssigkeit.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Fokus der Arbeit "Inhaltsverzeichnis"?
Die Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen verschiedenen Menschenbildern und deren Auswirkungen auf die Praxis der kindlichen Stottertherapie. Ziel ist es, die theoretischen Grundlagen unterschiedlicher Therapieformen zu beleuchten und deren praktische Ausgestaltung zu analysieren. Der Fokus liegt dabei auf der Bedeutung des Menschenbildes für die Therapiewahl und deren Umsetzung.
Welche Themenschwerpunkte werden in der Arbeit behandelt?
Die Themenschwerpunkte umfassen die begriffliche Klärung von Stottern und unterschiedlichen Menschenbildern, die Analyse zweier gegensätzlicher Stottertherapien (lokaler und globaler Ansatz), die Untersuchung des Einflusses des Menschenbildes auf die therapeutische Praxis, die Bewertung der jeweiligen Therapieansätze im Hinblick auf ihre theoretischen Grundlagen und die Verknüpfung von Theorie und Praxis in der kindlichen Stottertherapie.
Was ist der lokale Ansatz (Stottermodifikation) in der Stottertherapie?
Der lokale Ansatz (Stottermodifikation) ist eine Methode der Stottertherapie, die sich darauf konzentriert, das Stottern selbst zu verändern. Ziel ist es, die Art und Weise, wie gestottert wird, zu modifizieren, um das Stottern kontrollierbarer und weniger anstrengend zu machen.
Was ist der globale Ansatz (Fluency Shaping) in der Stottertherapie?
Der globale Ansatz (Fluency Shaping) ist eine Methode der Stottertherapie, die darauf abzielt, eine flüssige Sprechweise zu erlernen. Dabei werden Techniken eingesetzt, um die Sprechweise insgesamt zu verändern und das Stottern zu vermeiden.
Welche Rolle spielt das Menschenbild in der Stottertherapie?
Das Menschenbild spielt eine zentrale Rolle in der Stottertherapie, da es die theoretischen Grundlagen der Therapieform prägt und somit die praktische Ausgestaltung beeinflusst. Es bestimmt, wie der Patient gesehen wird, welche Voraussetzungen er mitbringen soll, wie die Therapeut-Patienten-Beziehung gestaltet wird und welche therapeutischen Mittel eingesetzt werden.
Welche Schlüsselwörter sind für diese Arbeit relevant?
Relevante Schlüsselwörter sind: Kindliches Stottern, Stottertherapie, Menschenbild, lokaler Ansatz, globaler Ansatz, Stottermodifikation, Fluency Shaping, Theorie, Praxis, Therapeut-Patienten-Beziehung, therapeutische Mittel, Sprechflüssigkeit.
Was wird in der Einleitung der Arbeit behandelt?
Die Einleitung führt in das Thema ein und begründet die Relevanz der Untersuchung des Zusammenhangs zwischen theoretischen Annahmen über den Menschen und der praktischen Anwendung in der kindlichen Stottertherapie. Sie hebt die Schwierigkeit einer vollständigen Erfassung des Phänomens "Stottern" hervor und argumentiert für die Notwendigkeit einer kritischen Auseinandersetzung mit den theoretischen Grundlagen verschiedener Therapieformen.
Was wird im Kapitel "Begriffliche Klärung" behandelt?
Dieses Kapitel klärt die Begrifflichkeiten von Stottern und verschiedenen Menschenbildern. Es präsentiert unterschiedliche Definitionen von Stottern, wobei der Schwerpunkt auf einer deskriptiven Beschreibung der Symptome liegt, ohne die Ursachen zu spezifizieren. Der Fokus liegt auf der Unterscheidung zwischen kindlichem Stottern und anderen Sprech- oder Sprachstörungen.
Was wird im Kapitel "Darstellung zweier Stottertherapien" behandelt?
Dieses Kapitel beschreibt zwei gegensätzliche Ansätze in der Stottertherapie: den lokalen Ansatz (Stottermodifikation) und den globalen Ansatz (Fluency Shaping). Es skizziert die grundlegenden Prinzipien beider Methoden, ohne in detaillierte Therapieverfahren einzugehen. Der Fokus liegt auf der Darstellung der jeweiligen Herangehensweisen an das Problem des Stotterns und deren unterschiedliche Zielsetzungen.
Was wird im Kapitel "Das Menschenbild und seine Auswirkungen" behandelt?
Dieses Kapitel analysiert die Auswirkungen der jeweiligen Menschenbilder auf die Praxis der lokalen und globalen Stottertherapie. Es untersucht die Rolle des Patienten, die Beziehung zwischen Therapeut und Patient und die eingesetzten therapeutischen Mittel im Kontext der jeweiligen theoretischen Grundlagen. Es wird detailliert auf die Voraussetzungen des Patienten, das Therapeut-Patienten-Verhältnis und die therapeutischen Mittel eingegangen.
- Arbeit zitieren
- Alexander Weiland (Autor:in), 2014, Auswirkungen verschiedener Menschenbilder in der kindlichen Stottertherapie, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1563425