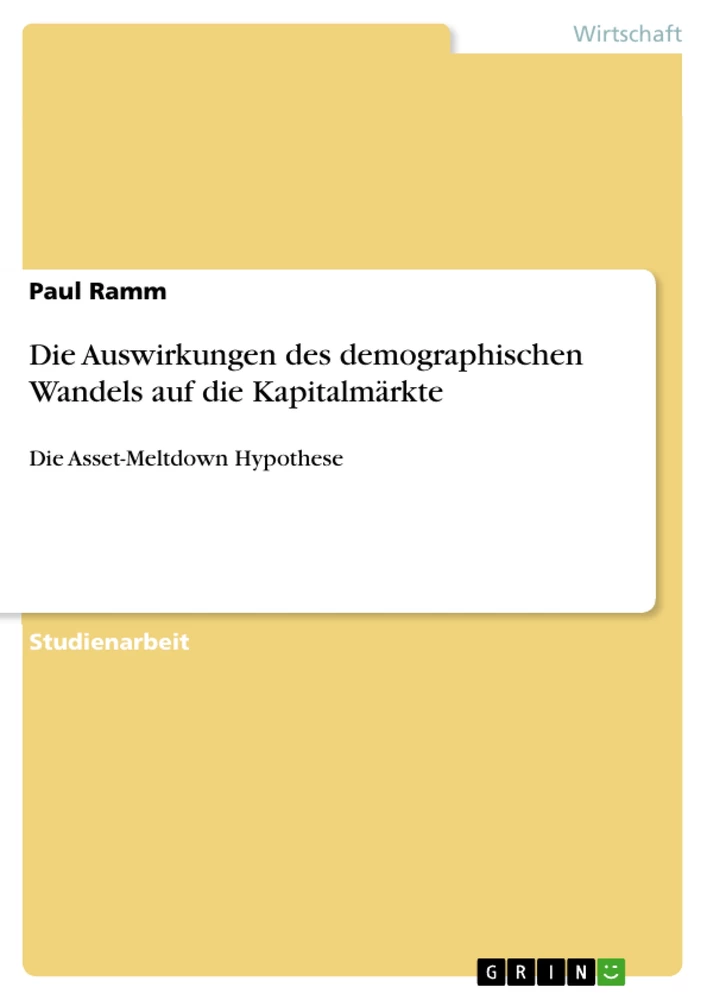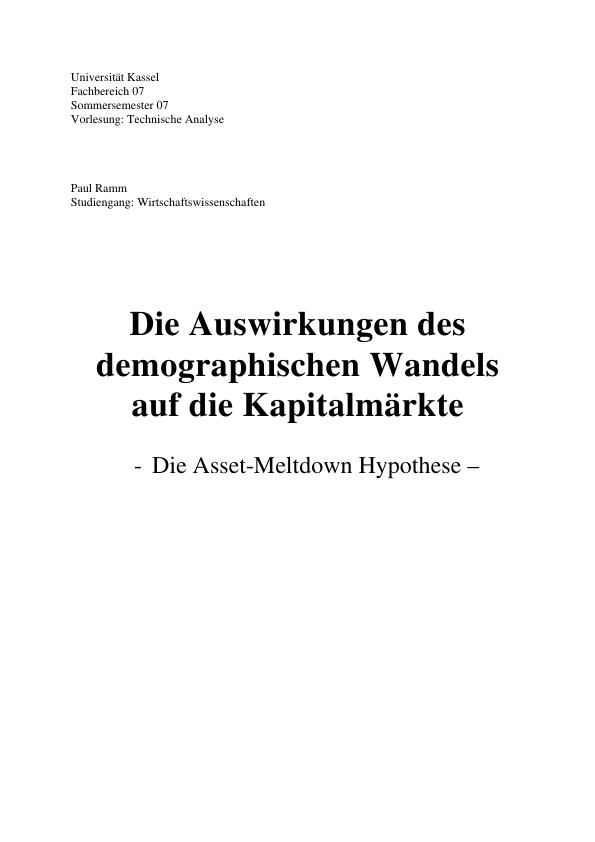Kassel, Frühjahr 2030. Michael Schmidt, jung und arbeitstätig, sitzt an seinem freien Tag vor dem Computer und wählt sich bei seinem Online-Broker ein. Nun versucht er schon seit einigen Tagen die von ihm vor Jahren gekauften Aktien der Volkswagen AG an der Global Stock Exchange zu verkaufen. Die Performance ist erschreckend und es zeichnet sich auch keine Trendwende ab. Nach dem erfolgreichen Einloggen ist ihm die Enttäuschung anzusehen. Die am Tag zuvor aufgegebene Verkaufsorder der kompletten Volkswagen-Aktien mit einem Limit von 20 € ist mal wieder nicht ausgeführt worden. Es gibt zwar viele Anbieter, aber keine Nachfrager, und so fällt der Aktienkurs immer weiter. Vor 15 Jahren noch hätten seine Aktien in kürzester Zeit den Eigentümer gewechselt.
Was sich wie ein unvorstellbares und zugleich überzogenes Zukunftsszenario anhört, könnte schon in einigen Jahren Realität sein. Denn wenn die geburtenstarken Jahrgänge, die so genannten „Baby-Boomer“, in den Ruhestand gehen, wird dies nicht nur Auswirkungen auf die sozialen Sicherungssysteme, sondern auch auf die internationalen Kapitalmärkte haben. Doch nicht nur Deutschland ist von der demographischen Alterung und Bevölkerungsschrumpfung betroffen, was ein Blick ins Ausland zeigt. Denn nahezu alle OECD-Länder sind aufgrund von sinkenden Geburtenraten und gleichzeitig steigender Lebenserwartung von dem demographischen Wandel gefangen. Vor diesem Hintergrund wird heute oft die von Mankiw und Weil erstmals 1989 in den USA bekannt gemachte „Asset-Meltdown“-Hypothese kontrovers diskutiert. Diese besagt, dass „in den dreißiger Jahren dieses Jahrhunderts die Nachfrage der Haushalte nach Finanzanlagen massiv zurückgehen wird, die Vermögen dramatisch abschmelzen und daher die Kapitalrenditen stark sinken“ werden, weil die geburtenstarken Jahrgänge nach und nach in das Rentenalter eintreten und ihr Vermögen von risikoreichen in sichere Anlagen umschichten werden.
Der vorliegende Aufsatz gibt zuerst die Ursachen und das Ausmaß des demographischen Wandels wieder. Unter den Kapiteln 4 und 5 wird auf die möglichen Auswirkungen der globalen Alterung auf die internationalen Finanzmärkte eingegangen. Dabei soll unter dem Gesichtspunkt der Ersparnisbildung der Haushalte (Kapitel 3) erörtert werden, wie sich die Kapitalmarktrenditen, die Portfolio-Allokationen und die Kapitalbewegungen aller Wahrscheinlichkeit nach in der näheren Zukunft entwickeln werden. Im letzten Kapitel wird ein Fazit gezogen und ein Ausblick gewagt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ursachen und Bedeutung der alternden Bevölkerung
- Ersparnisbildung der Haushalte im Lebenszyklus
- Die Entwicklung der Kapitalmarktrenditen
- Allgemeintheoretischer Ansatz
- Die Renditeentwicklung von Aktien, Anleihen & Co. und die individuelle Portfolio-Allokation der Risikobereitschaft
- Ausmaß der internationalen Kapitalströme: „Emerging Markets“ als Gewinner der Alterung der Industrieländer?
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Aufsatz untersucht die Auswirkungen des demographischen Wandels, insbesondere die Alterung der Bevölkerung, auf die internationalen Kapitalmärkte. Dabei wird die „Asset-Meltdown“-Hypothese von Mankiw und Weil (1989) beleuchtet, welche eine deutliche Rückgang der Kapitalrenditen prognostiziert, wenn die geburtenstarken Jahrgänge in den Ruhestand gehen und ihr Vermögen umstrukturieren.
- Ursachen und Ausmaß des demographischen Wandels
- Entwicklung der Ersparnisbildung im Lebenszyklus
- Potenzielle Auswirkungen auf Kapitalmarktrenditen
- Einfluss auf Portfolio-Allokationen und Kapitalbewegungen
- Das Phänomen der „Emerging Markets“ im Kontext der Alterung der Industrieländer
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die „Asset-Meltdown“-Hypothese vor und erläutert, wie die Alterung der Bevölkerung die internationalen Kapitalmärkte beeinflussen könnte. Kapitel 2 untersucht die Ursachen und das Ausmaß des demographischen Wandels in Deutschland und weltweit, wobei die Unterschiede in der Altersstruktur verschiedener Industrienationen herausgestellt werden.
Kapitel 3 befasst sich mit der Ersparnisbildung der Haushalte im Lebenszyklus. Kapitel 4 widmet sich der Entwicklung der Kapitalmarktrenditen und analysiert die möglichen Auswirkungen der globalen Alterung auf die Renditeentwicklung von Aktien, Anleihen und anderen Anlageformen. Dabei wird auch die Bedeutung der individuellen Portfolio-Allokation der Risikobereitschaft im Kontext des demographischen Wandels beleuchtet.
Kapitel 5 untersucht das Ausmaß der internationalen Kapitalströme und betrachtet die Rolle der „Emerging Markets“ als potenzielle Gewinner der Alterung der Industrieländer.
Schlüsselwörter
Demographischer Wandel, Alterung, „Baby-Boomer“, Kapitalmärkte, Asset-Meltdown-Hypothese, Ersparnisbildung, Portfolio-Allokation, Risikobereitschaft, Kapitalströme, „Emerging Markets“, Lebenserwartung, Geburtenrate, Alterskoeffizient.
Häufig gestellte Fragen
Was besagt die „Asset-Meltdown“-Hypothese?
Die Hypothese prognostiziert, dass die Preise für Finanzanlagen massiv fallen könnten, wenn die geburtenstarken Jahrgänge (Baby-Boomer) in Rente gehen und ihr Vermögen zeitgleich verkaufen.
Wie beeinflusst der demographische Wandel die Ersparnisbildung?
Gemäß der Lebenszyklushypothese sparen Menschen während ihrer Erwerbsphase und entsparen (verbrauchen Vermögen) im Ruhestand, was die Kapitalströme weltweit verändert.
Welche Auswirkungen hat die Alterung auf die Portfolio-Allokation?
Ältere Anleger schichten ihr Vermögen oft von risikoreichen Anlagen (Aktien) in sicherere Anlagen (Anleihen) um, was die Nachfrage und Renditen am Kapitalmarkt beeinflusst.
Können „Emerging Markets“ den demographischen Wandel der Industrieländer ausgleichen?
Es wird diskutiert, ob Kapitalexporte in jüngere Schwellenländer helfen können, die Renditen für die alternden Gesellschaften der OECD-Staaten stabil zu halten.
Was sind die Hauptursachen für die Alterung der Bevölkerung?
Die Kombination aus sinkenden Geburtenraten und einer gleichzeitig steigenden Lebenserwartung führt zu einer Verschiebung des Alterskoeffizienten.
- Quote paper
- Diplom-Ökonom Paul Ramm (Author), 2007, Die Auswirkungen des demographischen Wandels auf die Kapitalmärkte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/156360