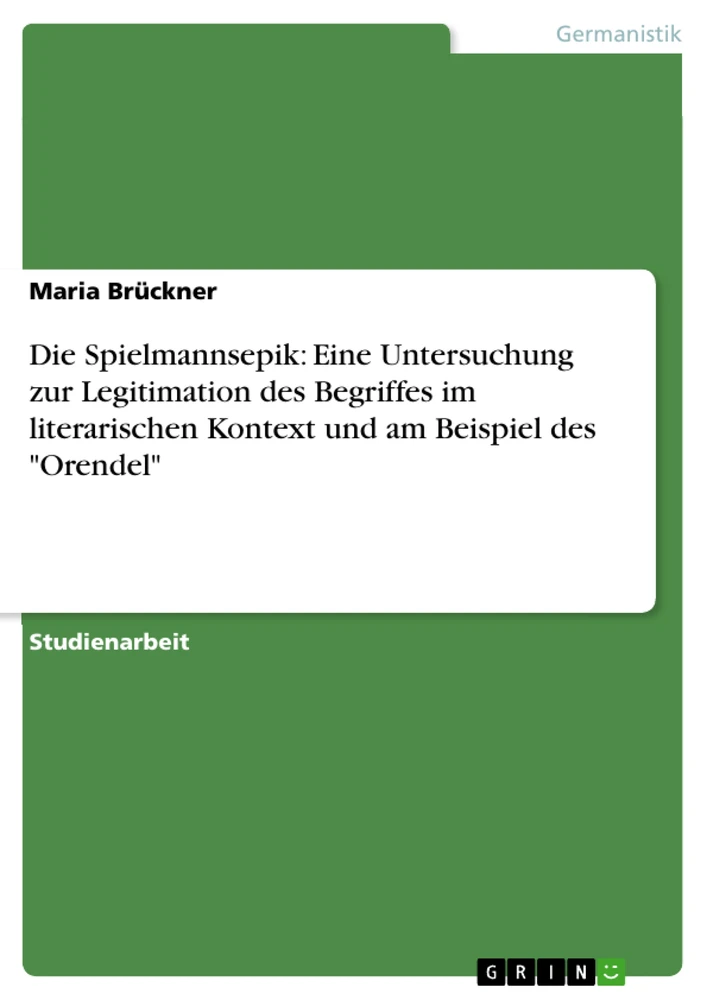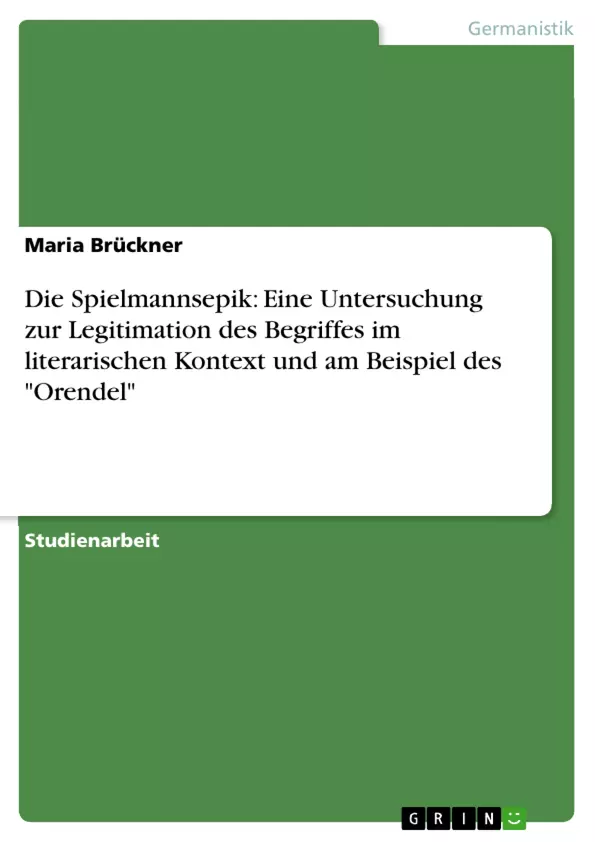Inhaltsverzeichnis
1. Hinführung zum Thema ...................................... 3
2. Die Begriffsproblematik ................................... 4
2.1. Der Spielmann ....................................... 4
2.2. Die Spielmannsdichtung .............................. 6
2.3. Merkmale ............................................ 7
2.3.1. Die Sprache ................................ 7
2.3.2. Erzählweise und Struktur ................... 8
2.3.3. Der Verfasser .............................. 8
2.3.4. Motive und Quellen ......................... 9
2.4. Kritische Prüfung der Aspekte ....................... 10
3. Zum Spielmannsepos „Orendel“ .............................. 12
3.1. Kritik am „Orendel“ – Rezension der Forschung ....... 17
4. Lösungsmöglichkeiten und Alternativen innerhalb der Begriffsproblematik .......................................... 18
1. Hinführung zum Thema
Der Ausdruck Spielmannsdichtung oder Spielmannsepik ist die traditionelle Bezeichnung für eine kleine Gruppe mittelalterlicher Erzähldichtungen. Dazu gehören ,Herzog Ernst’, ,König Rother’, ,Salman und Morolf’, ,St. Oswald’ und der in dieser Arbeit noch zu untersuchende ,Orendel’. Mit dem Begriff der Spielmannsdichtung sind viele, noch offene Fragen in der Forschung verbunden. Dies begründet sich in der umstrittenen Frage nach der Korrektheit des Terminus. Er wird als unzutreffend für die fünf genannten Werke empfunden. Die Gattungsbezeichnung, ihr Stellenwert und die damit verbundene Legitimation des Begriffes werden in Frage gestellt.
In dieser Arbeit gilt es, gefestigte Forschungsmeinungen bezüglich dieser Problematik darzustellen. Dabei erfolgt eine Darstellung wesentlicher Ergebnisse innerhalb der Forschung, welche im Anschluss zum Teil kritisch betrachtet und widerlegt werden. Fragen zur Legitimation und Korrektheit des Terminus finden eine Antwort. Das komplexe Feld des Begriffes wird aufgezeigt. Erläuterte Aspekte und Ansätze werden im weiteren Verlauf der Arbeit am Beispiel des ,Orendel’ veranschaulicht und hinterfragt. Ziel dieser Analyse ist die Positionierung des Werkes innerhalb der erläuterten Problematik. Mögliche Lösungsansätze bzw. Alternativen werden im letzten Kapitel dargestellt. Dieses ist als zusammenfassendes und bewertendes Resümee zu verstehen. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Hinführung zum Thema
- Die Begriffsproblematik
- Der Spielmann
- Die Spielmannsdichtung
- Merkmale
- Die Sprache
- Motive und Quellen
- Kritische Prüfung der Aspekte
- Zum Spielmannsepos „Orendel“
- Kritik am „Orendel“ – Rezension der Forschung
- Lösungsmöglichkeiten und Alternativen innerhalb der Begriffsproblematik
- Quellen- und Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Spielmannsepik und untersucht die Legitimität des Begriffs im literarischen Kontext, insbesondere am Beispiel des "Orendel". Sie analysiert die verschiedenen Forschungsansätze und stellt die Problematik des Begriffs "Spielmannsepik" in den Vordergrund.
- Definition und Legitimität des Begriffs "Spielmannsepik"
- Die Rolle des Spielmanns in der mittelalterlichen Literatur
- Merkmale und Charakteristika der Spielmannsdichtung
- Analyse des "Orendel" im Kontext der Spielmannsepik
- Kritik und Rezeption des "Orendel" in der Forschung
Zusammenfassung der Kapitel
- Hinführung zum Thema: Dieses Kapitel stellt die traditionelle Bezeichnung "Spielmannsdichtung" für eine Gruppe mittelalterlicher Erzähldichtungen vor und erläutert die umstrittene Frage nach der Korrektheit des Terminus. Es werden die Forschungsmeinungen zu dieser Problematik dargestellt und der Fokus auf die Legitimation des Begriffs gelegt.
- Die Begriffsproblematik: Das Kapitel beschäftigt sich mit der komplexen und zwiespältigen Frage nach der Verfasserschaft und den Merkmalen der Spielmannsepik. Es werden verschiedene Thesen zu den Gebieten Spielmann, Spielmannsepik und Merkmalen vorgestellt, inklusive eines kurzen Abrisses der Forschungsgeschichte.
- Zum Spielmannsepos „Orendel“: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Kritik am "Orendel" und die Rezeption des Werkes in der Forschung. Es analysiert die Positionierung des "Orendel" innerhalb der diskutierten Problematik der Spielmannsepik.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit zentralen Themen wie Spielmannsepik, Spielmann, Spielmannsdichtung, "Orendel", mittelalterliche Erzähldichtungen, Legitimität des Begriffs, Forschungsgeschichte, Kritik und Rezeption.
Häufig gestellte Fragen zur Spielmannsepik
Was versteht man unter dem Begriff „Spielmannsepik“?
Es ist eine traditionelle Gattungsbezeichnung für eine Gruppe mittelhochdeutscher Erzähldichtungen, zu denen Werke wie „König Rother“, „Herzog Ernst“ und „Orendel“ gehören.
Warum ist der Begriff „Spielmannsdichtung“ in der Forschung umstritten?
Die Forschung bezweifelt die Korrektheit des Terminus, da unklar ist, ob diese Werke tatsächlich von Spielleuten verfasst wurden oder ob die Bezeichnung der literarischen Qualität gerecht wird.
Welche Merkmale zeichnen die Spielmannsepik aus?
Typische Merkmale sind eine spezifische Sprache, eine formelhafte Erzählweise, bestimmte Motive (wie die Brautwerbung) und eine lockere Struktur.
Welche Rolle spielt das Werk „Orendel“ in diesem Kontext?
Der „Orendel“ dient als Beispiel, um die Legitimität des Gattungsbegriffs zu prüfen und die Positionierung eines einzelnen Werkes innerhalb dieser problematischen Kategorie zu analysieren.
Gibt es Alternativen zum Begriff Spielmannsepik?
Die Arbeit untersucht im letzten Kapitel verschiedene Lösungsmöglichkeiten und alternative Gattungsbezeichnungen, die in der Mediävistik diskutiert werden.
- Quote paper
- Maria Brückner (Author), 2007, Die Spielmannsepik: Eine Untersuchung zur Legitimation des Begriffes im literarischen Kontext und am Beispiel des "Orendel", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/156407