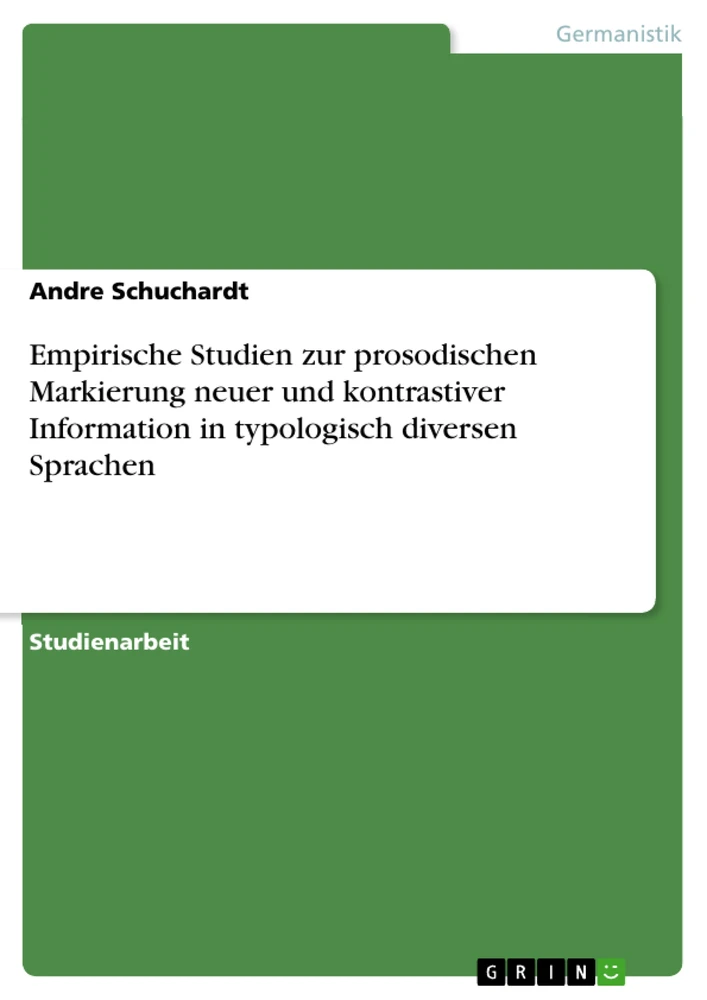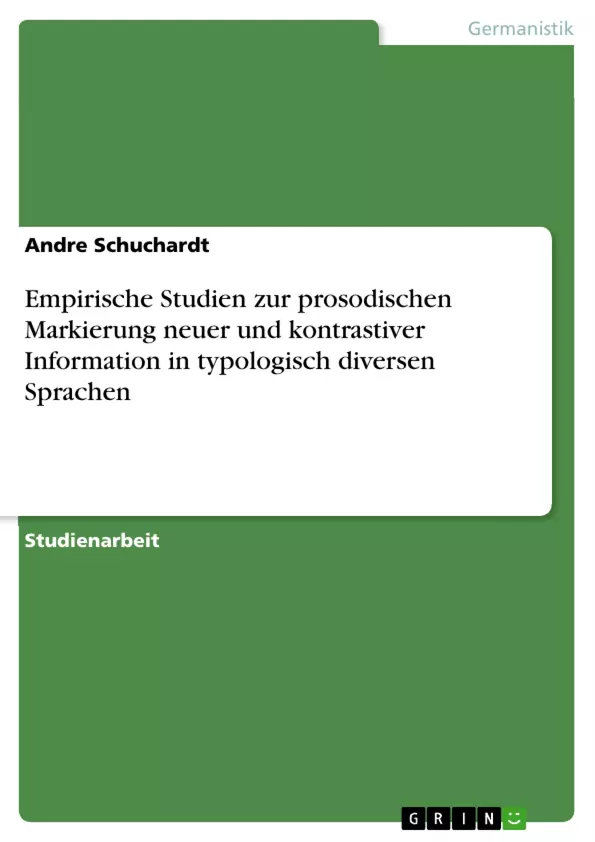Jede Sprache drückt pragmatische Feinheiten und eine Informationsstruktur aus. Viele besitzen spezielle morphosyntaktische Mittel. Diese Arbeit untersucht, ob einige Sprachen dieser Art auch Prosodie nutzen um Topik und Fokus zu markieren. Das Ergebnis lautet, dass die meisten Sprachen Prosodie nutzen, selbst einige Tonsprachen – doch nicht alle. Doch diese Fälle müssen weiter untersucht werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Topik, Fokus und Kontrast
- 2.1. Prosodischer Fokus, Kontrast und Topik
- 2.2. Morphosyntaktische Möglichkeiten
- 3. Die Studien
- 3.1. Griechisch
- 3.2. Georgisch: Flexible Wortreihenfolge
- 3.3. Morphosyntaktische Marker: Japanisch
- 3.4. Mandarin: Prosodie in der Tonsprache
- 3.5. Hausa: Ton und Syntax - Keine Prosodie?
- 4. Diskussion und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Rolle der Prosodie bei der Markierung von Topik, Fokus und Kontrast in verschiedenen Sprachen. Das Hauptziel besteht darin, die Prominenz der Prosodie im Vergleich zu morphosyntaktischen Mitteln zur Informationsstrukturierung zu ermitteln. Die Studie analysiert psycholinguistische Studien zu verschiedenen Sprachen, um zu überprüfen, ob und wie Prosodie in verschiedenen Sprachtypen eingesetzt wird.
- Die Rolle der Prosodie in der Markierung von Topik, Fokus und Kontrast.
- Vergleich der Prosodie mit morphosyntaktischen Mitteln zur Informationsstrukturierung.
- Untersuchung der Universalität der Prosodienutzung in verschiedenen Sprachfamilien.
- Analyse der prosodischen Markierung in tonal und nicht-tonalen Sprachen.
- Auswertung von psycholinguistischen Studien zu verschiedenen Sprachen.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der pragmatischen Funktionen von Fokus, Topik und Kontrast ein und erläutert die Forschungsfrage nach der Prominenz der Prosodie gegenüber morphosyntaktischen Mitteln bei der Realisierung dieser Funktionen. Die Hypothese besagt, dass Prosodie selbst in tonal und morphosyntaktisch reichen Sprachen eine wichtige Rolle spielt. Die Gliederung der Arbeit und die Herangehensweise an die Forschungsfrage werden dargelegt.
2. Topik, Fokus und Kontrast: Dieses Kapitel definiert die Begriffe Topik, Fokus und Kontrast und diskutiert verschiedene Möglichkeiten ihrer Realisierung in Sprachen, beispielsweise durch Kasus, semantische Rollen und morphosyntaktische Formen. Es wird betont, dass die Definitionen oft unscharf sind und diese Arbeit von einer Unterscheidung zwischen verwandten Subkategorien ausgeht. Der Abschnitt beleuchtet die unterschiedlichen Definitionen und Ansichten von Fokus und Topik, z.B. ob sie als Gegensätze oder als überlappende Kategorien zu verstehen sind.
3. Die Studien: Dieses Kapitel präsentiert eine Auswahl von Studien zu verschiedenen Sprachen, die die Nutzung von Prosodie zur Markierung von Fokus und Topik untersuchen. Die Studien beleuchten die prosodischen Muster in unterschiedlichen Sprachtypen und analysieren die Ergebnisse der Produktionsexperimente. Es wird auf die Ergebnisse der Einzelstudien eingegangen, die jeweils unterschiedliche Methoden zur Datengewinnung und –analyse genutzt haben.
Schlüsselwörter
Prosodie, Topik, Fokus, Kontrast, Informationsstruktur, Morphosyntax, Psycholinguistik, Tonsprachen, Akzent, Intonation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument: Prosodie und Informationsstruktur
Was ist das Thema des Dokuments?
Das Dokument untersucht die Rolle der Prosodie bei der Markierung von Topik, Fokus und Kontrast in verschiedenen Sprachen. Es vergleicht die Bedeutung der Prosodie mit morphosyntaktischen Mitteln zur Informationsstrukturierung und analysiert psycholinguistische Studien zu diesem Thema.
Welche Sprachen werden im Dokument untersucht?
Das Dokument analysiert Studien zu verschiedenen Sprachen, darunter Griechisch, Georgisch, Japanisch, Mandarin und Hausa. Der Fokus liegt auf dem Vergleich von tonal und nicht-tonalen Sprachen und der Variation in der Wortreihenfolge.
Welche Forschungsfragen werden behandelt?
Die zentrale Forschungsfrage ist, wie prominent Prosodie im Vergleich zu morphosyntaktischen Mitteln bei der Informationsstrukturierung ist. Weitere Fragen untersuchen die Universalität der Prosodienutzung in verschiedenen Sprachfamilien und die prosodische Markierung in tonal und nicht-tonalen Sprachen.
Welche Methoden werden verwendet?
Das Dokument analysiert existierende psycholinguistische Studien zu verschiedenen Sprachen. Diese Studien verwenden unterschiedliche Methoden zur Datengewinnung und -analyse, die im Dokument erläutert werden.
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument enthält eine Einleitung, ein Kapitel zur Definition von Topik, Fokus und Kontrast, ein Kapitel mit der Zusammenfassung verschiedener Studien zu verschiedenen Sprachen, und abschließend eine Diskussion und ein Fazit.
Was sind die wichtigsten Ergebnisse?
Die konkreten Ergebnisse der einzelnen Studien werden im Kapitel "Die Studien" detailliert vorgestellt. Die Hauptthese ist, dass Prosodie selbst in tonal und morphosyntaktisch reichen Sprachen eine wichtige Rolle bei der Markierung von Topik, Fokus und Kontrast spielt.
Welche Schlüsselbegriffe werden im Dokument verwendet?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind Prosodie, Topik, Fokus, Kontrast, Informationsstruktur, Morphosyntax, Psycholinguistik, Tonsprachen, Akzent und Intonation.
Wie sind Topik, Fokus und Kontrast definiert?
Das Dokument definiert die Begriffe Topik, Fokus und Kontrast und diskutiert verschiedene Möglichkeiten ihrer Realisierung in Sprachen. Es wird darauf hingewiesen, dass die Definitionen oft unscharf sind und das Dokument von einer Unterscheidung zwischen verwandten Subkategorien ausgeht.
Welche Hypothese wird aufgestellt?
Die Hypothese besagt, dass Prosodie selbst in tonal und morphosyntaktisch reichen Sprachen eine wichtige Rolle spielt bei der Markierung von Topik, Fokus und Kontrast.
Für wen ist dieses Dokument relevant?
Dieses Dokument ist relevant für Linguisten, Sprachwissenschaftler, und alle, die sich für die Themen Prosodie, Informationsstruktur und die Funktionsweise von Sprache interessieren.
- Quote paper
- Andre Schuchardt (Author), 2010, Empirische Studien zur prosodischen Markierung neuer und kontrastiver Information in typologisch diversen Sprachen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/156411