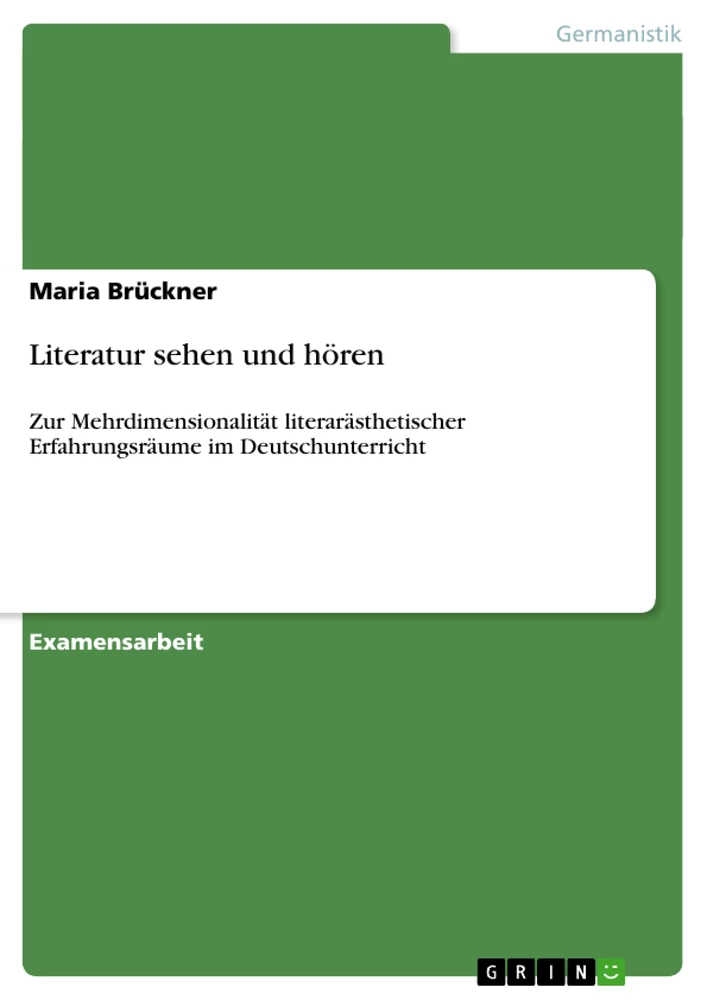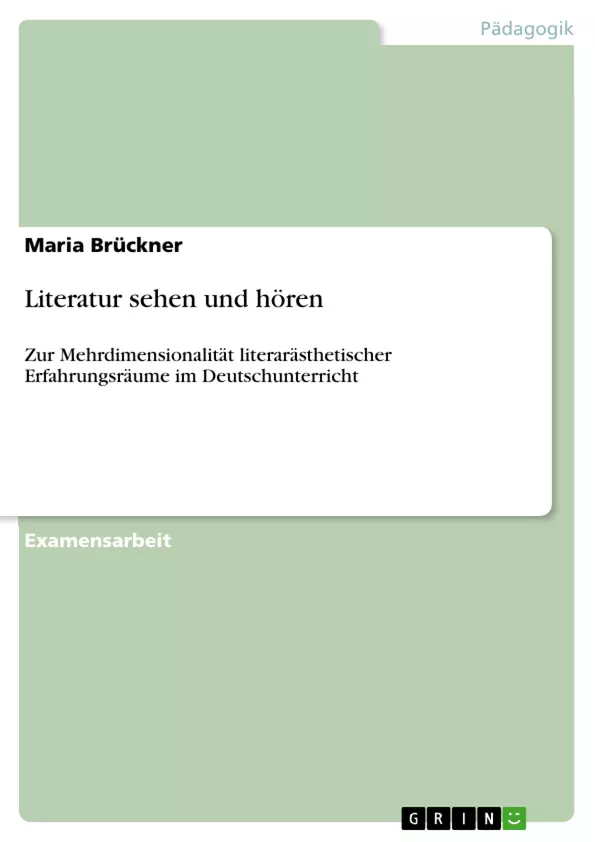Bereits 1975 stellte der deutsche Pädagoge HARTMUT VON HENTIG fest, dass Kindheit zu einer „Fernsehkindheit“1 geworden sei.
Diese Aussage skizziert die soziokulturelle, gesellschaftliche und individuelle Perspektive der Medialisierung, unter welcher man die zunehmende Durchdringung der Lebenswelt mittels visueller, audiovisueller und anderer spezifischer Medien versteht.2 Die prägende Kraft von Medien ist dabei elementarer Einfluss- und Triebfaktor. Im Zuge der medialen Entwicklungen ist das Aufwachsen in einer Multimedia-Umwelt für die heutigen Jugendlichen zu einer Selbstverständlichkeit geworden.3 Medien dienen den Jugendlichen unter anderem zur „Information, Orientierung, Lebensbewältigung [...] und Identitätsbildung“4. Jederzeit verfügbar wirken die medialen Angebote sozialisierend, sinnprägend und präferenzbildend auf die Heranwachsenden.
[...]
Literatur sehen ...
Unter dieser Thematik erfolgt die Betrachtung der ,Literaturverfilmung’ als potentielle literarästhetische Erfahrungsquelle bezüglich einer erweiterten Medienorientierung im Deutschunterricht.42 Thematisch leitende Bestandteile bilden eine grundlegende Begriffsbestimmung, die Herausstellung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden zum Text bzw. Buch hinsichtlich rezeptionsspezifischen und strukturellen Aspekten als auch die konkrete Aufzeigung unterrichtlicher Leistungsfähigkeit und Funktionalität.
(Audio)visuelle43 Literaturadaptionen bilden eine Entwicklungslinie in der Geschichte des Films. Sie sind beinahe genauso alt wie dieser und das Kino. So lassen sich beispielsweise bereits 1896 Filmmotive von Luis Lumiere nach Goethes Faust auf der Leinwand wieder finden.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Anlass und Ablauf der Arbeit
- Problemaufriss
- Kulturpessimismus
- Standortbestimmung des Deutschunterrichts
- Deutschunterricht und mediale Wirklichkeit
- Literatur sehen
- Begriffsbestimmung
- Zur Begriffsproblematik
- Spezifika
- Film und Buch - Sehen und Lesen
- Zur Rezeption von ‚Verfilmungen‘
- Rezeption im medialen Verbund
- Zur Rezeption von ‚Verfilmungen‘
- Deutschunterricht und ‚Verfilmung‘
- Zur Stellung der ‚Verfilmung‘ im Lehrplan
- Die ‚Verfilmung‘ in der Praxis
- Konkrete unterrichtliche Realisierungsmöglichkeiten
- Ein Exkurs zur Qualitätsfrage
- Begriffsbestimmung
- Literatur hören
- Zur Begriffsbestimmung
- Eine Standortbestimmung
- Spezifika
- Hörbuch und Buch - Hören und Lesen
- Zur Rezeption von Hörbüchern
- Deutschunterricht und Hörbuch
- Zur Stellung des Hörbuches im Lehrplan
- Das Hörbuch in der Praxis
- Anforderungen an den Hörer
- Konkrete unterrichtliche Realisierungsmöglichkeiten
- Ein Exkurs zur Qualitätsfrage
- Zur Begriffsbestimmung
- Mehrdimensionale Erweiterungsansprüche
- Zur Negation kulturpessimistischer Tendenzen
- Ergänzung statt Verdrängung
- Leselust
- Erweiterung des Textbegriffes
- Zur Negation kulturpessimistischer Tendenzen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der zunehmenden medialen Durchdringung der Lebenswelt von Jugendlichen und ihren Auswirkungen auf den Deutschunterricht. Sie analysiert die Bedeutung von Film und Hörbuch im Kontext der Literaturvermittlung und untersucht, wie diese Medien den Deutschunterricht bereichern und erweitern können.
- Die Auswirkungen des Kulturpessimismus auf den Deutschunterricht
- Die Rolle von Film und Hörbuch als Ergänzung zum Buch im Deutschunterricht
- Die Bedeutung von medialen Verbünden für die Literaturrezeption
- Die Herausforderungen und Chancen der Integration von Film und Hörbuch in den Deutschunterricht
- Die Erweiterung des Textbegriffes durch die Einbeziehung von audiovisuellen und akustischen Medien
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 beleuchtet den Ausgangspunkt der Arbeit: die zunehmende Medialisierung der Lebenswelt und die damit einhergehenden Veränderungen im Deutschunterricht. Kapitel 2 setzt sich mit dem Kulturpessimismus auseinander, der die Verdrängung des Buches durch neue Medien befürchtet. Kapitel 3 widmet sich dem Thema ‚Literatur sehen‘, analysiert die Rezeption von Verfilmungen und diskutiert die Möglichkeiten der Integration von Filmen in den Deutschunterricht. Kapitel 4 befasst sich mit ‚Literatur hören‘, untersucht die Rezeption von Hörbüchern und beleuchtet die Rolle des Hörbuches im Unterricht. Kapitel 5 erörtert schließlich die Chancen und Herausforderungen, die sich aus der Integration von Film und Hörbuch für den Deutschunterricht ergeben.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Themen Medien, Deutschunterricht, Literaturvermittlung, Film, Hörbuch, Kulturpessimismus, Textbegriff, medialer Verbund und Rezeption.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet "Medialisierung" im Deutschunterricht?
Es beschreibt die zunehmende Durchdringung der Lebenswelt durch visuelle und audiovisuelle Medien, die auch den Literaturunterricht beeinflussen.
Sind Literaturverfilmungen eine Konkurrenz zum Buch?
Die Arbeit argumentiert gegen kulturpessimistische Tendenzen und sieht Verfilmungen eher als Ergänzung und literarästhetische Erfahrungsquelle.
Welche Rolle spielen Hörbücher im Unterricht?
Hörbücher erweitern den Textbegriff und bieten neue Möglichkeiten der Literaturrezeption, besonders für auditiv orientierte Lerner.
Wie verändert sich der Textbegriff?
Der Textbegriff wird erweitert, indem auch audiovisuelle und akustische Adaptionen als gleichwertige Formen der Literaturvermittlung anerkannt werden.
Was ist das Ziel der Integration neuer Medien?
Ziel ist die Steigerung der Leselust und eine umfassende Medienorientierung der Jugendlichen.
- Citation du texte
- Maria Brückner (Auteur), 2010, Literatur sehen und hören, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/156412