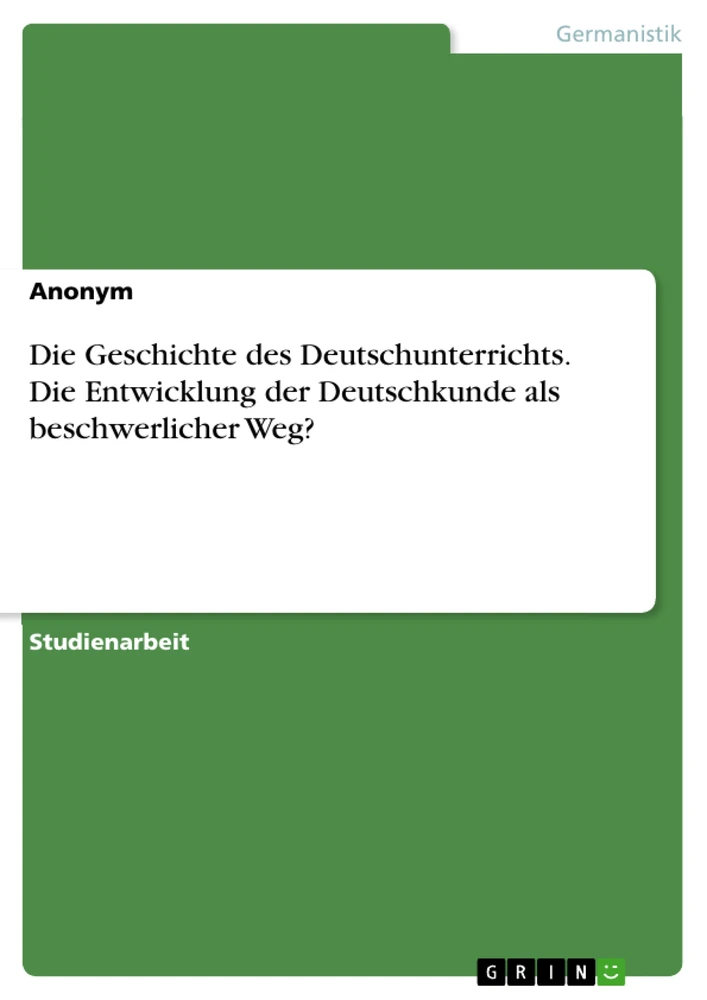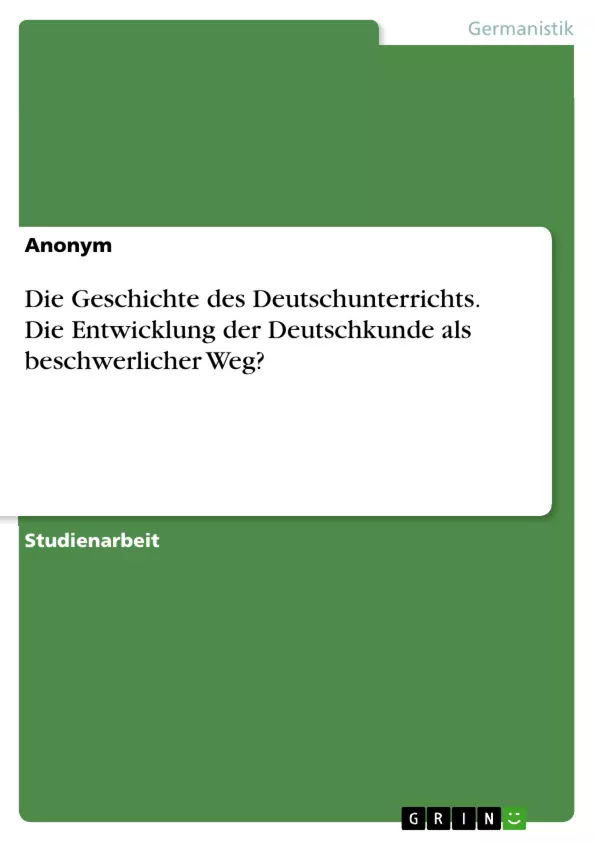Welche Ereignisse - wie Initiativen, Reformbewegungen und Proteste - trugen maßgeblich zur Etablierung der Deutschkunde als zentralen Unterrichtsgegenstand bei? Zur Beantwortung werden konkrete Akteure und ihre Auswirkungen betrachtet.
Vorab wird ein kurzer Überblick über ideologische Auffassungen in den Schulen der frühen Neuzeit und über die angewandte Methodik des Lernens gegeben, sowie eine Kurzdarstellung des frühen Schulsystems. Dazu soll auch der Exkurs im zweiten Kapitel dienen, durch den gezeigt wird, dass die Entwicklung an den Schulen und ihre Ausrichtung, je nach System nicht widerspruchsfrei war. Das dritte Kapitel soll sich dann noch einmal ausführlich mit der Kritik an den Unterrichtsmethoden beschäftigen, wobei insbesondere die von den Philologen Gesner und Ernesti vertretene Neukonzeption des philologischen Unterrichts im Fokus steht.
Im daran anschließenden Kapitel spiegelt sich dies zunächst auch in den philologischen Seminaren um 1800 wider. Warum sich das neue, von Gesner gestützte Leitbild, nicht auf Dauer und flächendeckend durchsetzen konnte, soll dabei ebenfalls deutlich werden. Wie sehr sich zu der Zeit die verschiedenen Haltungen und Ansprüche schieden und Schwierigkeiten bei der Umsetzung machten, wird auch in den weiteren Kapiteln noch deutlicher. Wobei sich das fünfte Kapitel primär auf den gymnasialen Unterricht konzentriert und das Sechste mit der Beschäftigung mit der Germanistik an den Universitäten.
Diese Differenzen der Akteure und die Unzufriedenheit der Fachvertreter gipfeln schließlich in der Schulkonferenz von 1890. Anhand ihrer Auswirkungen soll untersucht werden, inwiefern sie eine Wende darstellt. Das letzte Kapitel soll einen Ausblick auf den Beginn des 20. Jahrhunderts gewährleisten und untersuchen, welche historischen oder politischen Entwicklungen zu der endgültigen Auflösung des altsprachlichen Unterrichtsmonopols, welche Kopp für das 20. Jahrhundert feststellt, beigetragen haben.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Klassische Philologie, Lateinunterricht und Deutschunterricht bis 1800
- 2.1. Bedeutung des Lateinischen (als Distinktionsmerkmal)
- 2.2. Das Schulsystem der frühen Neuzeit und seine didaktischen Methoden
- 2.3. Folgen der Kritik der Reformdidaktiker: Bedeutungsaufschwung der Muttersprache?
- 3. Exkurs: die Etablierung von Elementarschulen und ihre Bedeutung
- 4. Gesner und Ernesti: eine Neukonzeption und ihre Auswirkung
- 5. Philologische Seminare um 1800: zwischen Reform und Tradition
- 6. Philologie und gymnasialer Unterricht im 18. und 19. Jahrhundert
- 6.1. Das neuhumanistische Bildungskonzept: Vorstellung und Realität
- 6.2. Deutsche Philologie und Deutschunterricht
- 7. Schulkonferenz 1890: eine Wende?
- 8. Ausblick: Beginn des 20. Jahrhunderts
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung des Deutschunterrichts als zentralen Unterrichtsgegenstand. Ziel ist es, die Ereignisse, Initiativen, Reformbewegungen und Proteste zu identifizieren, die maßgeblich zu seiner Etablierung beitrugen. Der Fokus liegt auf der Entwicklung im Kontext der klassischen Philologie und des Lateinunterrichts.
- Die Bedeutung des Lateinunterrichts und seine Rolle als Distinktionsmerkmal.
- Die Kritik an traditionellen Unterrichtsmethoden und der Aufstieg der Muttersprache.
- Die Rolle der Philologie und der philologischen Seminare in der Entwicklung des Deutschunterrichts.
- Der Konflikt zwischen universitärer Germanistik und den praktischen Anforderungen des Schulalltags.
- Die Bedeutung der Schulkonferenz von 1890 als möglicher Wendepunkt.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach den Ereignissen, die zur Etablierung der Deutschkunde als zentralen Unterrichtsgegenstand führten. Sie betont die Bedeutung der Fachgeschichte für die Literaturdidaktik und den politischen Einfluss auf den Literaturunterricht. Der Aufbau der Arbeit orientiert sich an Detlev Kopps Werk zur Wissenschaftsgeschichte der Germanistik, wobei der Fokus und das Quellenmaterial teilweise abweichen.
2. Klassische Philologie, Lateinunterricht und Deutschunterricht bis 1800: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die herausragende Bedeutung des Lateinischen bis 1800. Es beleuchtet die Rolle des Lateinischen in der öffentlichen Kommunikation, wer es sprach (Kirche, Klerus, weltliche Intelligenz), und wie das Schulsystem der frühen Neuzeit und seine didaktischen Methoden die Entwicklung beeinflussten. Es legt den Grundstein für das Verständnis der späteren Kritik an den traditionellen Unterrichtsmethoden und dem anschließenden Bedeutungsaufschwung der Muttersprache.
3. Exkurs: die Etablierung von Elementarschulen und ihre Bedeutung: (Dieser Abschnitt fehlt im bereitgestellten Text und müsste basierend auf weiterem Kontext erstellt werden)
4. Gesner und Ernesti: eine Neukonzeption und ihre Auswirkung: (Dieser Abschnitt fehlt im bereitgestellten Text und müsste basierend auf weiterem Kontext erstellt werden)
5. Philologische Seminare um 1800: zwischen Reform und Tradition: (Dieser Abschnitt fehlt im bereitgestellten Text und müsste basierend auf weiterem Kontext erstellt werden)
6. Philologie und gymnasialer Unterricht im 18. und 19. Jahrhundert: Dieses Kapitel konzentriert sich auf den gymnasialen Unterricht und die Entwicklung der Germanistik an den Universitäten. Es untersucht den Konflikt zwischen dem neuhumanistischen Bildungskonzept und der Praxis, sowie die Differenzen zwischen universitärer Germanistik und den Forderungen der Schulpraktiker. Der Konflikt wird exemplarisch am Fallbeispiel eines Gymnasiallehrers dargestellt.
7. Schulkonferenz 1890: eine Wende?: (Dieser Abschnitt fehlt im bereitgestellten Text und müsste basierend auf weiterem Kontext erstellt werden)
8. Ausblick: Beginn des 20. Jahrhunderts: (Dieser Abschnitt fehlt im bereitgestellten Text und müsste basierend auf weiterem Kontext erstellt werden)
Schlüsselwörter
Deutschunterricht, Klassische Philologie, Lateinunterricht, Muttersprache, Reformdidaktik, Neuhumanismus, Germanistik, Schulsystem, Schulkonferenz 1890, Institutionelle Konflikte.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Zweck dieser Arbeit über die Entwicklung des Deutschunterrichts?
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung des Deutschunterrichts als zentralen Unterrichtsgegenstand. Ziel ist es, die Ereignisse, Initiativen, Reformbewegungen und Proteste zu identifizieren, die maßgeblich zu seiner Etablierung beitrugen. Der Fokus liegt auf der Entwicklung im Kontext der klassischen Philologie und des Lateinunterrichts.
Welche Themenschwerpunkte werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf:
- Die Bedeutung des Lateinunterrichts und seine Rolle als Distinktionsmerkmal.
- Die Kritik an traditionellen Unterrichtsmethoden und der Aufstieg der Muttersprache.
- Die Rolle der Philologie und der philologischen Seminare in der Entwicklung des Deutschunterrichts.
- Der Konflikt zwischen universitärer Germanistik und den praktischen Anforderungen des Schulalltags.
- Die Bedeutung der Schulkonferenz von 1890 als möglicher Wendepunkt.
Was behandelt Kapitel 1 (Einleitung)?
Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach den Ereignissen, die zur Etablierung der Deutschkunde als zentralen Unterrichtsgegenstand führten. Sie betont die Bedeutung der Fachgeschichte für die Literaturdidaktik und den politischen Einfluss auf den Literaturunterricht. Der Aufbau der Arbeit orientiert sich an Detlev Kopps Werk zur Wissenschaftsgeschichte der Germanistik, wobei der Fokus und das Quellenmaterial teilweise abweichen.
Worum geht es in Kapitel 2 (Klassische Philologie, Lateinunterricht und Deutschunterricht bis 1800)?
Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die herausragende Bedeutung des Lateinischen bis 1800. Es beleuchtet die Rolle des Lateinischen in der öffentlichen Kommunikation, wer es sprach (Kirche, Klerus, weltliche Intelligenz), und wie das Schulsystem der frühen Neuzeit und seine didaktischen Methoden die Entwicklung beeinflussten. Es legt den Grundstein für das Verständnis der späteren Kritik an den traditionellen Unterrichtsmethoden und dem anschließenden Bedeutungsaufschwung der Muttersprache.
Was ist der Fokus von Kapitel 6 (Philologie und gymnasialer Unterricht im 18. und 19. Jahrhundert)?
Dieses Kapitel konzentriert sich auf den gymnasialen Unterricht und die Entwicklung der Germanistik an den Universitäten. Es untersucht den Konflikt zwischen dem neuhumanistischen Bildungskonzept und der Praxis, sowie die Differenzen zwischen universitärer Germanistik und den Forderungen der Schulpraktiker. Der Konflikt wird exemplarisch am Fallbeispiel eines Gymnasiallehrers dargestellt.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Deutschunterricht, Klassische Philologie, Lateinunterricht, Muttersprache, Reformdidaktik, Neuhumanismus, Germanistik, Schulsystem, Schulkonferenz 1890, Institutionelle Konflikte.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2025, Die Geschichte des Deutschunterrichts. Die Entwicklung der Deutschkunde als beschwerlicher Weg?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1564912