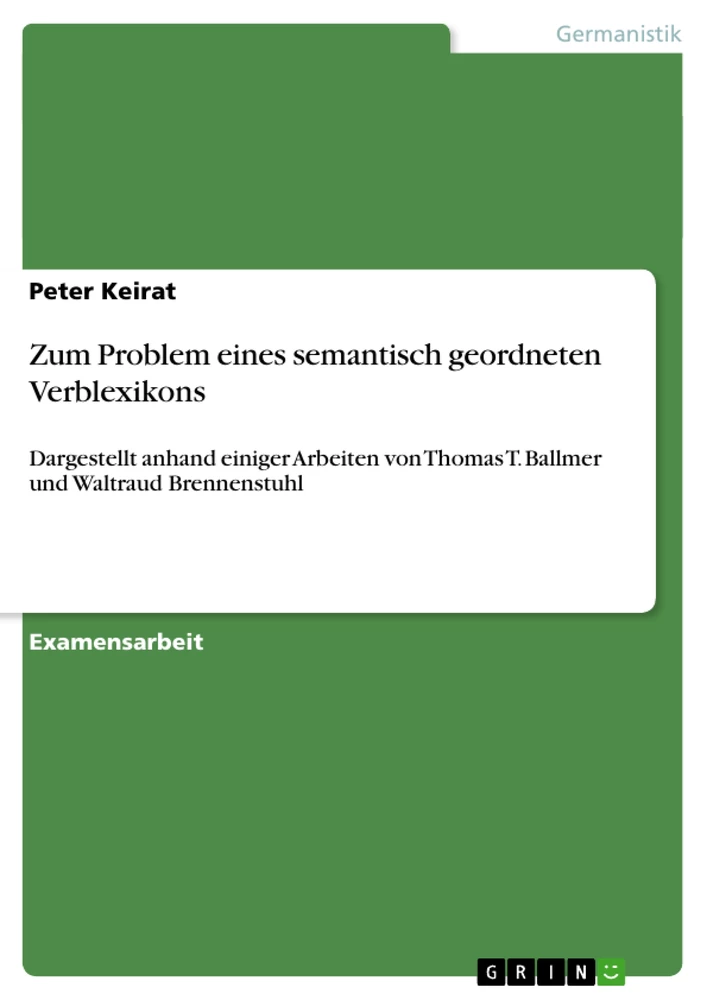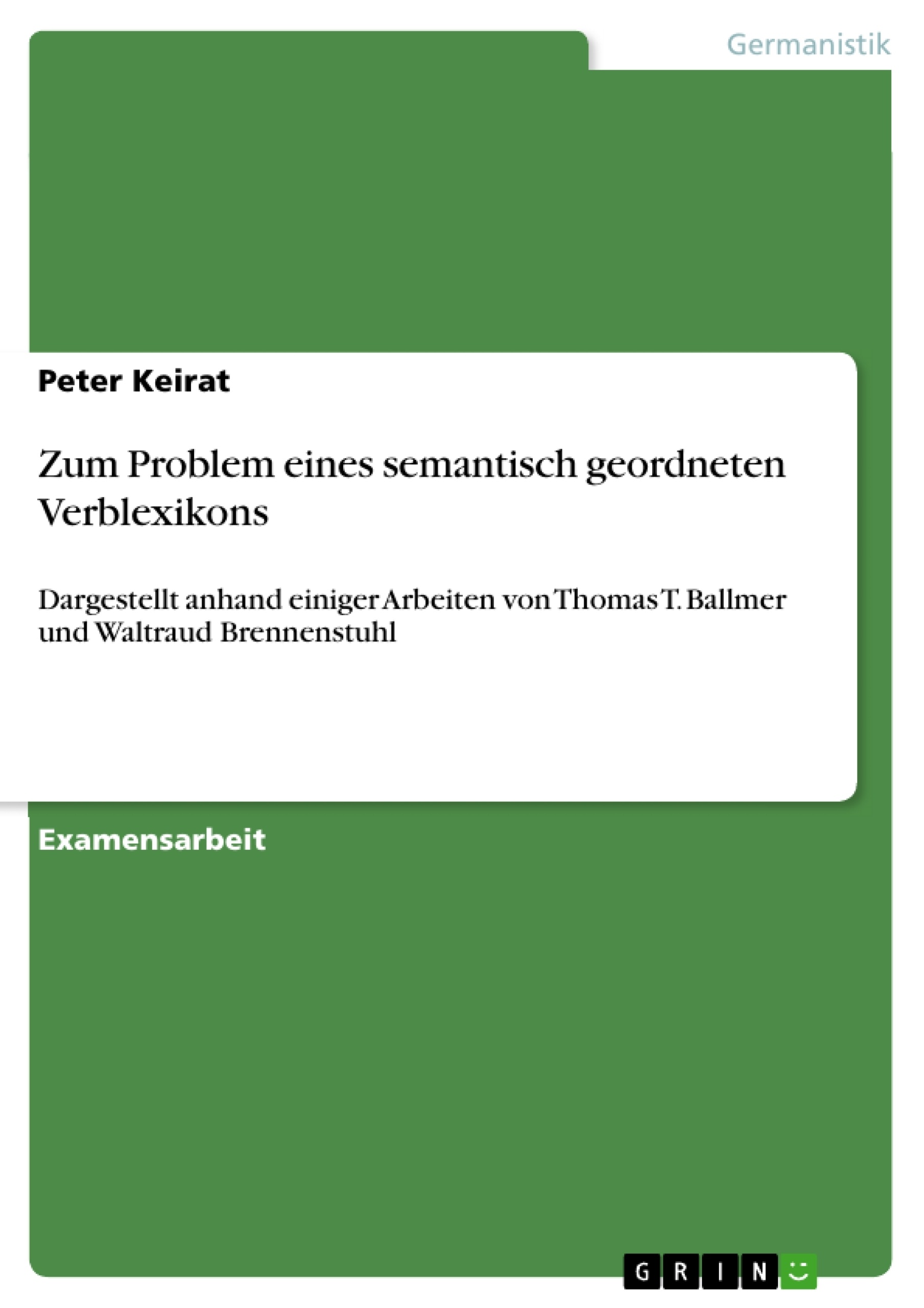Im Zentrum der Arbeit steht die Auseinandersetzung mit dem Problem des Aufbaus eines semantisch geordneten Verblexikons, wie es mit dem Werk "Deutsche Verben" 1985 von Thomas T. Ballmer und Waltraud Brennenstuhl vorgelegt wurde. Die beiden Autoren entwickelten hier eine neue Klassifikationsmethode, die den Anspruch erhob, eine Basis für ein komplettes Lexikon der (deutschen) Verben in Thesaurusform zu sein.
Gegenstand dieser Arbeit ist nun eine Darstellung und eine kritische Auseinandersetzung mit dieser Methode der Verbklassifikation. Die Methode der Autoren wird grundlegend erläutert und diskutiert. Es wird ein Vergleich mit anderen Typologien wie die von Vendler und von Wright gezogen.
Thomas T. Ballmer hat darüberhinaus auch theoretische Erweiterungen des Verbthesaurus in verschiedenen Veröffentlichungen vorgelegt: So wird in dieser Arbeit auch sein Konzept des "semantischen Raumes" erläutert und den alten Konzepten der Feldtheorie (Trier, Weisgerber) gegenübergestellt. Ebenfalls wird sein Begriff des "semantischen Archetypen" vorgestellt und mit dem Archetypenbegriff der Katastrophentheorie (Wolfgang Wildgen) verglichen.
Ballmer schlägt eine neue Konzeption des Begriffs Aktionsart vor, diese wird dargestellt und mit anderen Konzeptionen verglichen. Kurze Abschnitte beschäftigen sich mit den Versuchen Ballmers, eine prozessuale Kasustheorie aufzubauen und einen neuen semantischen Begriff von Transitivität zu begründen.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- 1. KAPITEL: die Methode der verbsemantischen Klassifiaktion
- 1.1 Zielsetzung
- 1.2 Das Ausgangsmaterial
- 1.3 Das Kategorisierungsschema (Übersicht)
- 1.4 Begriffsbestimmung: Kategorie und Modell
- 1.5 Phasen der Analysemethode
- 1.6 Die Grundverben
- 1.7 Der Aufbau von Modellen
- 1.8 Das System von Modellen
- 1.9 Die einzelnen Modelle und ihre inhaltliche Erläuterung
- 1.10 Die drei Verbtypen
- 1.11 Die Klassifikation der Sprechaktverben
- 1.12 Die Sprechaktverbmodelle und ihre inhaltliche Erläuterung
- 1.13 Eine erste Ausbaustufe des Verbthesaurus: Die Klassifikation der Adformen
- 2. KAPITEL: Erweiterungen und Folgerungen aus der Verbklassifiktion
- 2.1 Das Konzept des semantischen Raumes
- 2.2 Semantischer Raum und Feldbegriff
- 2.3 BALLMERs Konzeption eines Archetypen und sein Verhältnis zur Katastrophentheorie
- 2.4 Aktionsarten: eine neue lexikalisch fundierte Klassifikation
- 2.5 Der Aufbau einer prozessualen Kasustheorie
- 2.6 Das Konzept der Transitivitätsentfaltung
- 2.7 Folgerungen aus dem Verbthesaurus für die Syntax: BALLMERS Begriff der Metapraxes
- 3. KAPITEL: Zwei Auseinandersetzungen mit dem Verbthesaurus-Konzept: H.J. HERINGER und J. MEIBAUER
- 3.1 Die Kritik H.J. HERINGERS
- 3.2 Die Antwort BALLMER und BRENNENSTUHLS auf diese Kritik
- 3.3 Die Kritik J. MEIBAUERS
- 3.4 Die Antwort BALLMER und BRENNENSTUHLS auf diese Kritik
- 4. KAPITEL: Eine Diskussion des Verbthesaurus
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Darstellung und Auseinandersetzung mit der Methode der Verbklassifikation, die von Thomas T. BALLMER und Waltraud BRENNENSTUHL entwickelt wurde, um ein semantisch geordnetes Verblexikon zu erstellen.
- Die Entwicklung und Anwendung einer neuen Methode zur Klassifikation von Verben
- Die Anwendung dieser Methode zur Erstellung eines umfassenden Verblexikons
- Die theoretischen Erweiterungen und Folgerungen aus der Verbklassifikation für verschiedene Teilgebiete der Sprachwissenschaft
- Die Auseinandersetzung mit Kritik an der Verbklassifikation von Seiten anderer Sprachwissenschaftler
- Eine Diskussion der Bedeutung des Verbthesaurus für die Sprachwissenschaft
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Dieses Kapitel erläutert die Methode der Verbklassifikation, die von BALLMER und BRENNENSTUHL entwickelt wurde. Es stellt die Zielsetzung, das Ausgangsmaterial und das Kategorisierungsschema vor. Außerdem werden die Phasen der Analysemethode, die Grundverben, der Aufbau und das System der Modelle erläutert. Schließlich werden die einzelnen Modelle und ihre inhaltliche Erläuterung sowie die drei Verbtypen vorgestellt.
- Kapitel 2: Dieses Kapitel widmet sich den theoretischen Erweiterungen und Folgerungen aus der Verbklassifikation. Es behandelt das Konzept des semantischen Raumes und stellt es dem Feldbegriff gegenüber. Außerdem wird die Konzeption eines Archetypen von BALLMER erläutert und mit dem Archetypenbegriff der Katastrophentheorie verglichen. Weitere Abschnitte befassen sich mit der neu vorgeschlagenen Konzeption von Aktionsart und der Entwicklung einer prozessualen Kasustheorie.
- Kapitel 3: Dieses Kapitel behandelt die Kritik von H.J. HERINGER und J. MEIBAUER am Verbthesaurus-Konzept. Es stellt die Kritikpunkte der beiden Sprachwissenschaftler dar und gibt die Antworten von BALLMER und BRENNENSTUHL auf diese Kritik wieder.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Verbklassifikation, semantische Ordnung, Verbthesaurus, Sprechaktverben, semantischer Raum, Feldtheorie, Archetypen, Aktionsart, Kasustheorie und Transitivitätsentfaltung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel eines semantisch geordneten Verblexikons?
Ziel ist es, Verben nicht alphabetisch, sondern nach ihrer Bedeutung (Thesaurusform) zu klassifizieren, um sprachliche Strukturen besser abzubilden.
Wer entwickelte die Methode der "Deutschen Verben" 1985?
Die Methode wurde von Thomas T. Ballmer und Waltraud Brennenstuhl entwickelt.
Was versteht Ballmer unter dem "semantischen Raum"?
Es ist ein Konzept, das die Beziehungen zwischen Verben räumlich darstellt und den klassischen Feldbegriffen von Trier und Weisgerber gegenübergestellt wird.
Welche Rolle spielen "Sprechaktverben" in diesem Lexikon?
Sprechaktverben bilden eine eigene Kategorie innerhalb der Klassifikation, die die prozessuale Natur von Sprache verdeutlicht.
Wie unterscheidet sich Ballmers Aktionsart-Konzept von anderen?
Ballmer schlägt eine neue, lexikalisch fundierte Klassifikation der Aktionsarten vor, die eng mit seiner Modellbildung verknüpft ist.
- Citation du texte
- Peter Keirat (Auteur), 1990, Zum Problem eines semantisch geordneten Verblexikons, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/156523