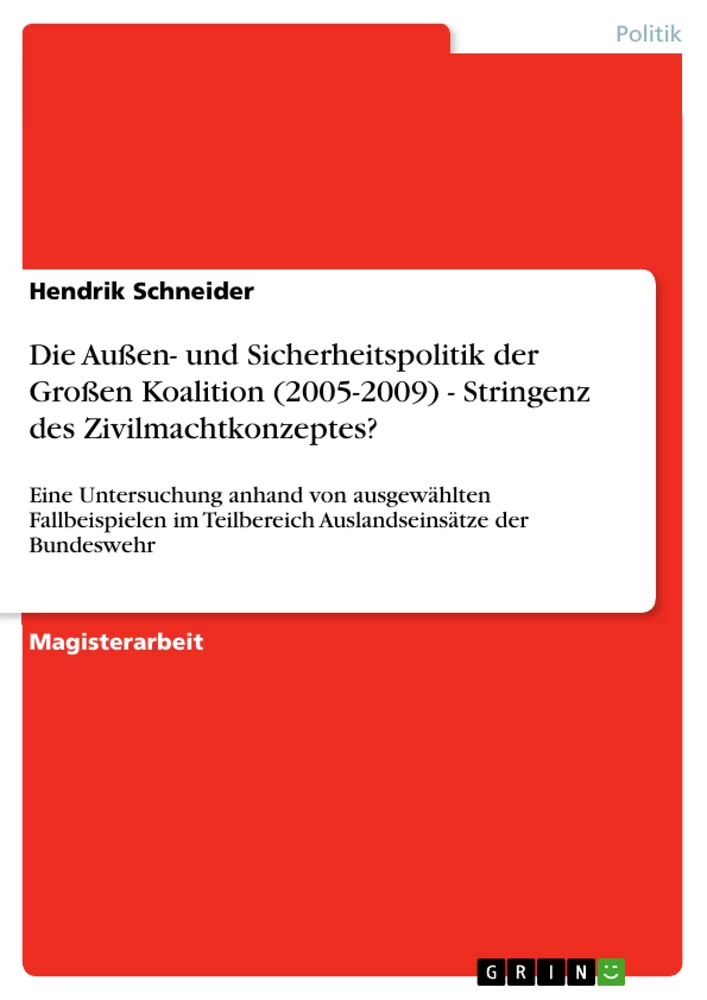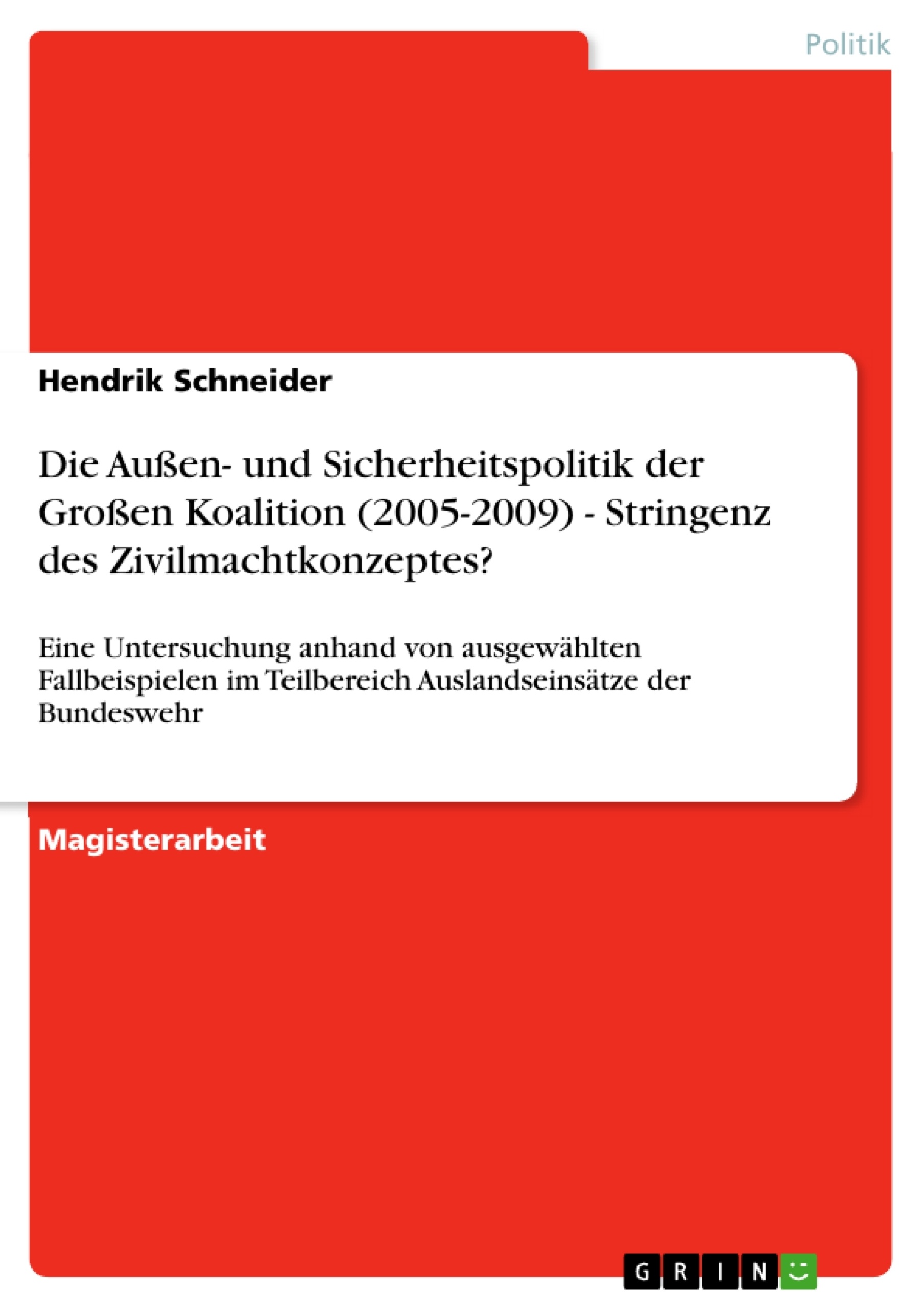Friedensmacht im Kampfeinsatz? Afghanistan, Kosovo, Libanon, Kongo - die Bundeswehr operierte im Untersuchungszeitraum (1990-2009) in zahlreichen Auslandseinsätzen - mit einer bis dahin ungewohnten Risikobereitschaft für die Soldaten. Führende Politologen und Analysten beschreiben die Stationierungs- und Madatierungspraxis der Bundesrepublik zunehmend als "Normalisierung", im Sinne einer zunehmenden Annäherung an das Selbstverständnis und die Verhaltensweisen der UN-Vetomächte.
Diese Arbeit wird sich den Transformationen im außen- und sicherheitspolitischen Gefüge der Bundesrepublik Deutschland und seinen inneren wie äußeren Rahmenbedigungen annehmen und die "Normalisierungsthese" kritisch hinsichtlich folgender Fragestellungen untersuchen:
Inwieweit sind die Einsatzpraxis und konzeptionellen Grundlagen der Auslandseinsätze der Bundeswehr innerhalb der
Amtsperiode der Großen Koalition von 2005-2009 noch mit den Prämissen und Grundprinzipien einer Zivilmacht begründbar – zeichnet sich der Ansatz also durch Kontinuität aus? Um diese Kontinuitätsthese belegen zu können, wird auch die Geschichte der BRD bis 2005 kritisch betrachtet. Die Argumentation folgt hierbei der These, dass sich das Verhalten der Bundesrepublik im Zusammenhang mit der Verwendung von Streitkräften „out-of-area“ in der Vergangenheit maßgeblich von anderen Ländern unterschied. Als Ursache für diese Diskrepanz wird der Einfluss einer spezifischen außenpolitischen Kultur vorausgesetzt, die sowohl handlungsleitend, als auch handlungshemmend auf die Akteure wirkte und auch noch weiter wirkt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische und historische Voraussetzungen
- Begriffsklärung
- Theorien der Internationalen Beziehungen - Ein Generationswechsel?
- Konstruktivismus und Rollentheorie
- Spezifizierung des Zivilmachtansatzes
- Grundprinzipien einer Zivilmacht
- Konstituierung der Zivilmacht Bundesrepublik Deutschland
- Sicherheitspolitische Herausforderungen und deren Einfluss auf strategische Grundlagen und Einsatzpraxis der Bundeswehr von 1989/90 bis 2005
- Auslandseinsätze der Bundeswehr im Zeitraum der Großen Koalition 2005-2009 im Kontext des Zivilmachtkonzeptes: Drei Fallbeispiele
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht die Außen- und Sicherheitspolitik der deutschen Großen Koalition (2005-2009) und analysiert, inwiefern das Konzept der Zivilmacht in der Praxis umgesetzt wurde. Die Arbeit konzentriert sich auf Auslandseinsätze der Bundeswehr als Fallbeispiele.
- Analyse der Stringenz des Zivilmachtkonzepts in der deutschen Außenpolitik
- Untersuchung der theoretischen Grundlagen des Zivilmachtansatzes
- Bewertung der Auslandseinsätze der Bundeswehr im Kontext des Zivilmachtkonzepts
- Analyse der parlamentarischen Debatten zu den Auslandseinsätzen
- Beurteilung des Einflusses sicherheitspolitischer Herausforderungen auf die Einsatzpraxis der Bundeswehr
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach der Stringenz des Zivilmachtkonzepts in der Außen- und Sicherheitspolitik der Großen Koalition (2005-2009) vor. Sie begründet die Relevanz der Fragestellung und skizziert den Aufbau, die Methodik und den Forschungsstand der Arbeit. Der Fokus liegt auf der Untersuchung der Auslandseinsätze der Bundeswehr als Indikatoren für die Umsetzung des Zivilmachtkonzepts.
Theoretische und historische Voraussetzungen: Dieses Kapitel klärt den Begriff der Zivilmacht und diskutiert relevante Theorien der Internationalen Beziehungen, insbesondere den Konstruktivismus und die Rollentheorie. Es spezifiziert den Zivilmachtansatz und beschreibt dessen Grundprinzipien (Gestaltungswille, Autonomieverzicht, Interessenunabhängige Normendurchsetzung). Schließlich wird die Konstituierung der Zivilmacht Bundesrepublik Deutschland im historischen Kontext beleuchtet, unter Berücksichtigung der politischen Kultur.
Sicherheitspolitische Herausforderungen und deren Einfluss auf strategische Grundlagen und Einsatzpraxis der Bundeswehr von 1989/90 bis 2005: Dieses Kapitel analysiert die sicherheitspolitischen Herausforderungen, denen sich Deutschland seit dem Ende des Kalten Krieges gegenüber sah. Es untersucht die Entwicklung der außenpolitischen Identität Deutschlands und die zunehmende Beteiligung der Bundeswehr an Auslandseinsätzen. Der Golfkrieg, der Bosnienkrieg, der Kosovokrieg, der Mazedonienkonflikt und der Irakkonflikt werden als Schlüsselereignisse betrachtet, die den Wandel der Einsatzpraxis der Bundeswehr und die Debatte um „Nie wieder Krieg“ prägten. Die Analyse untersucht, wie diese Ereignisse das Selbstverständnis Deutschlands und seine Rolle in der internationalen Sicherheitsarchitektur beeinflussten.
Auslandseinsätze der Bundeswehr im Zeitraum der Großen Koalition 2005-2009 im Kontext des Zivilmachtkonzeptes: Drei Fallbeispiele: Dieses Kapitel analysiert drei konkrete Auslandseinsätze der Bundeswehr während der Großen Koalition (2005-2009): den EUFOR RD Kongo-Einsatz, den UNIFIL-Einsatz und den ISAF Afghanistan-Einsatz. Für jeden Einsatz wird die Einsatzbeschreibung, die parlamentarische Auseinandersetzung und die Einsatzbilanz im Hinblick auf die Verhaltenskriterien des Zivilmachtkonzepts untersucht. Die Analyse bewertet, inwieweit die Einsätze mit den Prinzipien des Zivilmachtansatzes übereinstimmen und welche Herausforderungen und Konflikte sich daraus ergeben.
Schlüsselwörter
Zivilmacht, Außenpolitik, Sicherheitspolitik, Große Koalition, Bundeswehr, Auslandseinsätze, Internationales Engagement, Parlamentarische Debatte, Konstruktivismus, Rollentheorie, EU, UN, NATO, Fallbeispiele.
Häufig gestellte Fragen zur Magisterarbeit: Zivilmachtkonzept in der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik (2005-2009)
Was ist das zentrale Thema dieser Magisterarbeit?
Die Arbeit untersucht die Umsetzung des Zivilmachtkonzepts in der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik während der Großen Koalition von 2005 bis 2009. Der Fokus liegt dabei auf der Analyse von Auslandseinsätzen der Bundeswehr als Indikatoren für die praktische Anwendung des Konzepts.
Welche Forschungsfrage wird in der Arbeit behandelt?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Wie stringent wurde das Zivilmachtkonzept in der Außen- und Sicherheitspolitik der Großen Koalition (2005-2009) umgesetzt?
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf relevante Theorien der Internationalen Beziehungen, insbesondere den Konstruktivismus und die Rollentheorie. Der Zivilmachtansatz wird spezifiziert und seine Grundprinzipien (Gestaltungswille, Autonomieverzicht, Interessenunabhängige Normendurchsetzung) beschrieben.
Welche Fallbeispiele werden untersucht?
Die Arbeit analysiert drei Auslandseinsätze der Bundeswehr während der Großen Koalition: den EUFOR RD Kongo-Einsatz, den UNIFIL-Einsatz und den ISAF Afghanistan-Einsatz. Diese werden im Hinblick auf ihre Übereinstimmung mit den Prinzipien des Zivilmachtansatzes untersucht.
Wie werden die Fallbeispiele analysiert?
Für jeden Einsatz werden die Einsatzbeschreibung, die parlamentarische Auseinandersetzung und die Einsatzbilanz im Hinblick auf die Verhaltenskriterien des Zivilmachtkonzepts untersucht. Es wird bewertet, inwieweit die Einsätze mit den Prinzipien des Zivilmachtansatzes übereinstimmen und welche Herausforderungen und Konflikte sich daraus ergeben.
Welche weiteren Aspekte werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet auch die sicherheitspolitischen Herausforderungen seit dem Ende des Kalten Krieges, die Entwicklung der außenpolitischen Identität Deutschlands und den Einfluss dieser Entwicklungen auf die Einsatzpraxis der Bundeswehr. Die Rolle der parlamentarischen Debatten zu den Auslandseinsätzen wird ebenfalls analysiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Zivilmacht, Außenpolitik, Sicherheitspolitik, Große Koalition, Bundeswehr, Auslandseinsätze, Internationales Engagement, Parlamentarische Debatte, Konstruktivismus, Rollentheorie, EU, UN, NATO, Fallbeispiele.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu den theoretischen und historischen Voraussetzungen, ein Kapitel zu den sicherheitspolitischen Herausforderungen und deren Einfluss auf die Bundeswehr, und ein Kapitel zur Analyse der drei Fallbeispiele der Auslandseinsätze. Die Arbeit schließt mit einem Fazit und einem Literaturverzeichnis.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Stringenz des Zivilmachtkonzepts in der deutschen Außenpolitik zu analysieren und die Umsetzung dieses Konzepts in der Praxis zu bewerten. Sie untersucht, inwieweit die Auslandseinsätze der Bundeswehr als Indikatoren für die Anwendung des Zivilmachtkonzepts dienen.
- Arbeit zitieren
- Hendrik Schneider (Autor:in), 2010, Die Außen- und Sicherheitspolitik der Großen Koalition (2005-2009) - Stringenz des Zivilmachtkonzeptes?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/156634