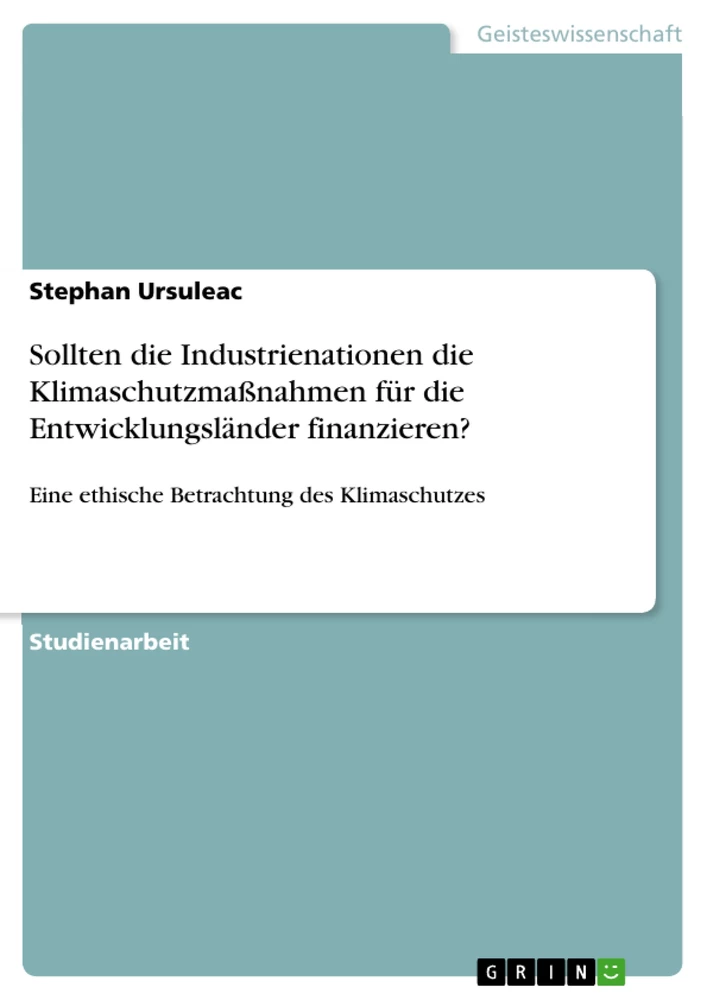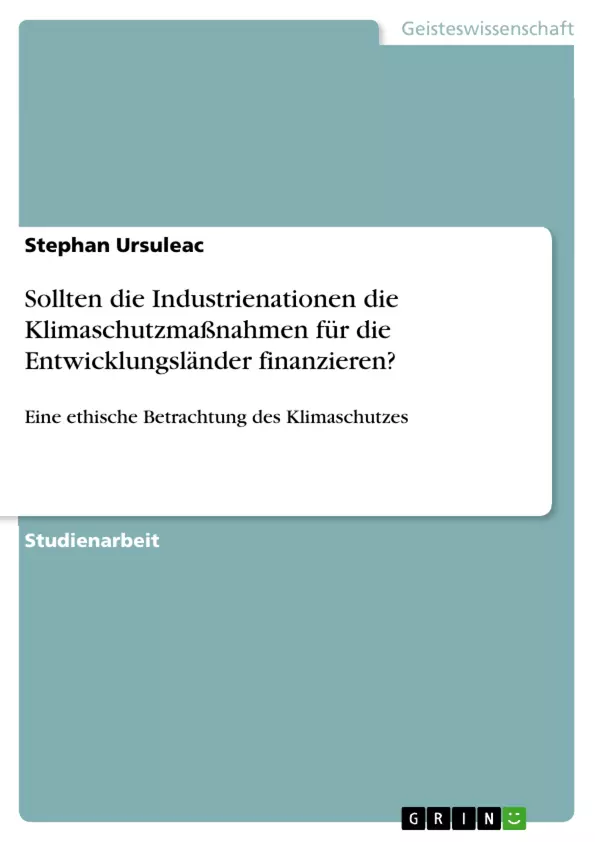1.Einleitung
Im Dezember 2009 fand in Kopenhagen die 12. Klimakonferenz nach dem für den Klimaschutz wegweisendem Gipfeltreffen in Kyoto 1997 statt. Die Umwelt- und Klimapolitik ist das derzeit am meisten institutionalisierte und frequentierte internationale Politikfeld. Der erste Umweltgipfel fand bereits 1972 in Stockholm statt.
Doch obwohl sich die internationale Staatengemeinschaft auf bereits mehrere hundert Abkommen zum Beispiel zum Thema Artenschutz oder den Schutz der Weltmeere geeinigt hat, steht die Welt vor enormen Herausforderungen.1 Es gilt, den drohenden Kollaps des Weltklimas aufzuhalten und die damit verbundene globale Erwärmung zu stoppen. Schon ein Anstieg um nur 1°C würde 30 – 40 % der bekannten Tierarten an den Rand des Aussterbens bringen. Eine weitere Erwärmung um 2°C würde die biologischen Systeme verändern und Millionen von Menschen durch Überflutungen bedrohen. Bei einem Anstieg um 3 - 4°C würde es zu einer massiven Austrocknung der Feuchtgebiete kommen, was mit einem Nahrungsmittelrückgang um über 30 %, einem Aussterben von mehr als 40 % der Tier- und Pflanzenarten und einem Anstieg des Meeresspiegels um vier bis fünf Meter verbunden wäre.2
Die Bewältigung des Klimawandels bedarf eines bis heute nicht gekannten Kraftaktes der internationalen Gemeinschaft in finanzieller, technologischer, struktureller und geistiger Hinsicht.
Die Industrienationen haben ein vitales Interesse an der Entwicklung der übrigen Welt. Ohne eine gerechte Weltwirtschaftsordnung wird es auf Dauer keinen Frieden geben. Die Vorteile der Industrienationen von heute könnten zu Nachteilen der folgenden Generationen werden. Vor allem im Bezug auf den Klimawandel ist es sinnvoller schon heute die Entwicklungsländer finanziell zu unterstützen. Je länger man mit der Hilfe wartet, umso teurer wird es für die Folgegenerationen. Vor allem aber sind weltweit Millionen von Menschen, hauptsächlich in den Entwicklungsländern, mit Leib und Leben durch den Klimawandel bedroht. Sie können sich aus eigener Kraft nicht helfen. Die Entwicklungsländer beim Kampf gegen den Klimawandel nicht zu unterstützen wäre also ethisch und moralisch verwerflich.
Daher müssen die Industrienationen den Entwicklungsländern aus ethischen und moralischen Aspekten heraus den Großteil der Kosten für den Klimawandel finanzieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Recht auf Entwicklung
- Werden die Entwicklungsländer in ihrer Entwicklung eingeschränkt?
- Haben die Industrienationen ein Interesse an der Entwicklung der Entwicklungsländer?
- Wie wurde bisher der globale Klimaschutz betrieben - von Kyoto bis Kopenhagen
- Welche Hilfen können die Industrieländer den Entwicklungsländern geben?
- Welchen Herausforderungen müssen sich die Entwicklungsländer stellen?
- Endbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, ob die Industrienationen aus ethischen Aspekten heraus einen Großteil der Finanzierung der Klimaschutzmaßnahmen für die Entwicklungsländer übernehmen sollten. Die Arbeit untersucht die Relevanz des Rechtes auf Entwicklung für die Entwicklungsländer und inwiefern diese in ihrer Entwicklung durch die Industrienationen eingeschränkt werden. Darüber hinaus werden die Interessen der Industrienationen an der Entwicklung der Entwicklungsländer analysiert. Die Arbeit beleuchtet den aktuellen Stand des globalen Klimaschutzes und diskutiert die Möglichkeiten der Industrienationen, die Entwicklungsländer bei der Bewältigung der Herausforderungen des Klimawandels zu unterstützen, insbesondere im Hinblick auf die Finanzierung von Schutzmaßnahmen. Schließlich werden die Herausforderungen und Aufgaben, die sich für die Entwicklungsländer selbst stellen, betrachtet.
- Das Recht auf Entwicklung
- Die Einschränkungen der Entwicklungsländer durch die Industrienationen
- Die Interessen der Industrienationen an der Entwicklung der Entwicklungsländer
- Der aktuelle Stand des globalen Klimaschutzes
- Die Möglichkeiten der Industrienationen, die Entwicklungsländer bei der Bewältigung des Klimawandels zu unterstützen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die Problematik des Klimawandels und die damit verbundenen Herausforderungen für die internationale Gemeinschaft dar. Es wird die Dringlichkeit des Handelns betont und die Bedeutung der finanziellen, technologischen, strukturellen und geistigen Zusammenarbeit hervorgehoben. Die Arbeit befasst sich mit der Frage, ob die Industrienationen aus ethischen Aspekten heraus einen Großteil der Finanzierung der Klimaschutzmaßnahmen für die Entwicklungsländer übernehmen sollten.
Das Recht auf Entwicklung
Dieses Kapitel behandelt das Recht auf Entwicklung, das als unveräußerliches Menschenrecht betrachtet wird. Es werden die verschiedenen Dimensionen des Rechtes auf Entwicklung erläutert, sowohl auf individueller als auch auf staatlicher Ebene. Zudem wird die Kritik an diesem Recht im Kontext der Rechtswissenschaft beleuchtet.
Wie wurde bisher der globale Klimaschutz betrieben - von Kyoto bis Kopenhagen
Dieses Kapitel beleuchtet die Geschichte des globalen Klimaschutzes und die Herausforderungen, die sich im Kontext des Kyoto-Protokolls und der Klimakonferenz in Kopenhagen ergeben haben. Es werden die Schwierigkeiten der internationalen Zusammenarbeit und die unterschiedlichen Interessenlagen der Industrieländer und Entwicklungsländer aufgezeigt.
Schlüsselwörter
Klimawandel, Klimaschutz, Entwicklungsländer, Industrienationen, Recht auf Entwicklung, internationale Zusammenarbeit, Finanzierung, Treibhausgase, Kyoto-Protokoll, Kopenhagen.
Häufig gestellte Fragen
Warum sollten Industrienationen Klimaschutz in Entwicklungsländern finanzieren?
Aus ethischen und moralischen Gründen, da Industrienationen historisch für den Großteil der Emissionen verantwortlich sind und Entwicklungsländer am stärksten unter den Folgen leiden.
Was ist das "Recht auf Entwicklung"?
Es ist ein unveräußerliches Menschenrecht, das besagt, dass jeder Mensch und jeder Staat das Recht hat, an wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Entwicklung teilzuhaben.
Welche Folgen hat ein Temperaturanstieg von 3-4°C?
Dies würde zu massiver Austrocknung, einem Nahrungsmittelrückgang um 30 %, dem Aussterben von 40 % der Arten und einem Anstieg des Meeresspiegels um mehrere Meter führen.
Was war das Ziel des Kyoto-Protokolls?
Es war ein wegweisendes internationales Abkommen zur verbindlichen Reduzierung von Treibhausgasemissionen durch die Industrieländer.
Können Entwicklungsländer den Klimawandel alleine bekämpfen?
Nein, sie verfügen oft nicht über die nötigen finanziellen und technologischen Ressourcen, um sich effektiv gegen die Folgen zu schützen oder Emissionen zu senken.
- Quote paper
- Stephan Ursuleac (Author), 2010, Sollten die Industrienationen die Klimaschutzmaßnahmen für die Entwicklungsländer finanzieren?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/156656