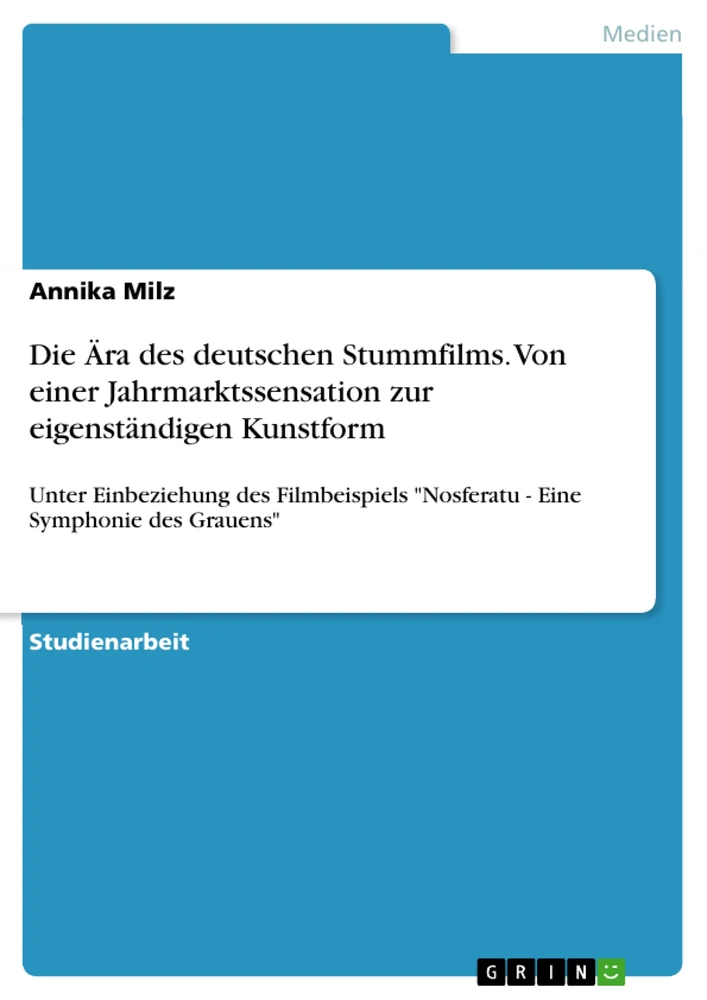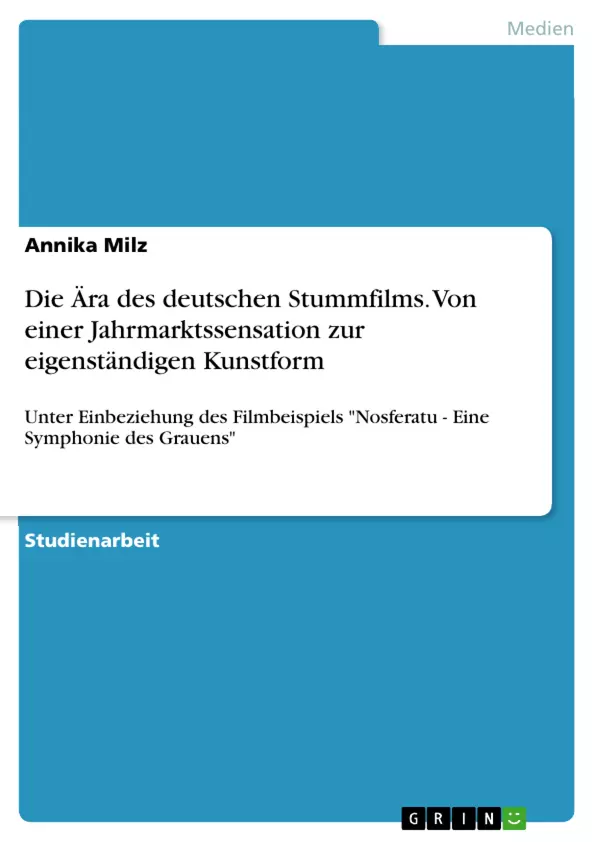Die Arbeit zeigt die Stationen des Stummfilms auf: Von seiner Erfindung 1895 über die Phase als Jahrmarkt- und Varieté-Attraktion hin zum künstlerisch ausgereiften Langfilm mit Genres wie dem Detektivfilm, dem Kammerspielfilm und dem expressionistischen Film. Neben diesem umfassenden Überblick über die Zeit und Entwicklung des Stummfilms befasst sich die vorliegende Arbeit mit Murnaus Adaption "Nosferatu - Eine Symphonie des Grauens", die - als einer der Höhepunkte stummfilmischen Schaffens - das junge Medium zur Kunstform erhob.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Die Pionierzeit des Stummfilms
- 2.1 Die Geburtsstunde des Films
- 2.2 Die Kinematographie als Jahrmarktsattraktion
- 2.3 Die Sesshaftwerdung des Films
- 3 Der Langfilm
- 3.1 Die Einführung des langen Spielfilms
- 3.2 Der Starfilm
- 3.3 Der Detektivfilm
- 3.4 Der Propagandafilm
- 3.5 Die Auswirkungen des Ersten Weltkriegs
- 3.6 Der Monumentalfilm
- 3.7 Der Expressionistische Film
- 3.8 Der Kammerspielfilm
- 3.9 Die Neue Sachlichkeit und der Querschnittsfilm
- 3.10 Das Ende des Stummfilms
- 4 „Nosferatu – Eine Symphonie des Grauens“
- 5 Fazit - Der Film als Kunstwerk
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit der Entstehung und Entwicklung des deutschen Stummfilms, indem sie dessen Weg von einer Jahrmarktssensation zu einer eigenständigen Kunstform beleuchtet. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Analyse des Stummfilms als Kunstwerk, wobei „Nosferatu – Eine Symphonie des Grauens“ von Friedrich Wilhelm Murnau als exemplarisches Beispiel dient.
- Die Anfänge des Stummfilms und seine Entwicklung als Massenmedium
- Die verschiedenen Genres und Strömungen im deutschen Stummfilm
- Der Einfluss von technischen und gesellschaftlichen Entwicklungen auf die Entwicklung des Stummfilms
- Die ästhetischen Besonderheiten und künstlerischen Ambitionen des Stummfilms
- Die Rolle des Stummfilms in der deutschen Kultur und Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und skizziert den Hintergrund des Stummfilms. Sie beleuchtet die Schwierigkeiten, die sich aus dem Verlust vieler Filme dieser Zeit ergeben, und stellt das Ziel der Arbeit vor, die Entwicklung des deutschen Stummfilms zu analysieren und „Nosferatu“ als exemplarisches Beispiel zu untersuchen.
Kapitel 2 widmet sich der Pionierzeit des Stummfilms und zeichnet die Geschichte seiner Entstehung nach, beginnend mit der Erfindung des Projektionsapparates und der frühen Filmvorführungen. Die Bedeutung der technischen Entwicklungen für den Erfolg des Mediums sowie der Übergang vom Jahrmarktsbetrieb zum sesshaften Kino werden erörtert.
Kapitel 3 befasst sich mit der Etablierung des Langfilms und den verschiedenen Genres, die sich im deutschen Stummfilm entwickelten, wie zum Beispiel der Starfilm, der Detektivfilm und der Propagandafilm. Die Auswirkungen des Ersten Weltkriegs auf die Filmindustrie werden ebenfalls beleuchtet, ebenso wie die Entstehung des Monumentalfilms, des Expressionistischen Films, des Kammerspielfilms und der Neuen Sachlichkeit.
Schlüsselwörter
Stummfilm, deutsche Filmgeschichte, Kinematographie, Jahrmarktsattraktion, Langfilm, Genres, Expressionismus, „Nosferatu – Eine Symphonie des Grauens“, Friedrich Wilhelm Murnau, Kunstwerk, Filmtheorie, ästhetische Analyse.
Häufig gestellte Fragen zur Ära des deutschen Stummfilms
Wie entwickelte sich der Stummfilm zur eigenständigen Kunstform?
Der Weg führte von der Erfindung 1895 über die Phase als Jahrmarktsattraktion bis hin zum künstlerisch ausgereiften Langfilm mit komplexer Ästhetik.
Welche Genres prägten den deutschen Stummfilm?
Zu den wichtigsten Genres gehörten der Detektivfilm, der Monumentalfilm, der Kammerspielfilm und der expressionistische Film.
Warum wird Murnaus "Nosferatu" besonders hervorgehoben?
"Nosferatu – Eine Symphonie des Grauens" gilt als einer der Höhepunkte des stummfilmischen Schaffens, der das Medium Film endgültig zur Kunst erhob.
Welchen Einfluss hatte der Erste Weltkrieg auf die Filmindustrie?
Der Krieg beeinflusste die Produktion stark, führte zur Entstehung von Propagandafilmen und veränderte die gesellschaftliche Wahrnehmung des Mediums.
Was kennzeichnet den expressionistischen Film?
Dieser Stil zeichnet sich durch seine besonderen ästhetischen Mittel, symbolhafte Bildgestaltung und die Darstellung innerer psychischer Zustände aus.
- Citation du texte
- Annika Milz (Auteur), 2005, Die Ära des deutschen Stummfilms. Von einer Jahrmarktssensation zur eigenständigen Kunstform, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/156661