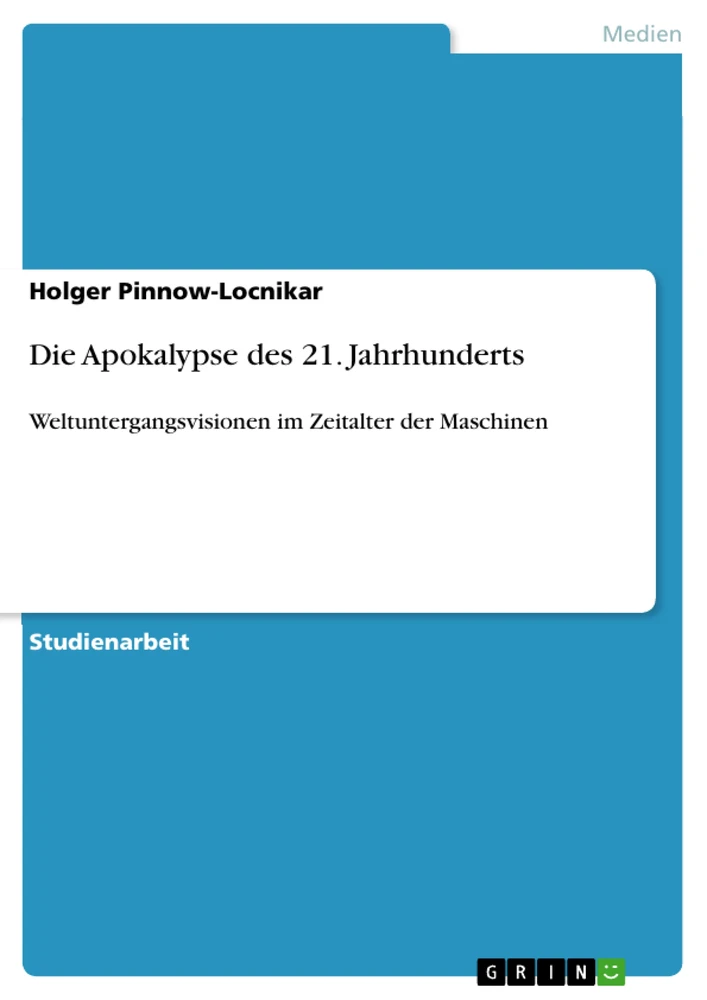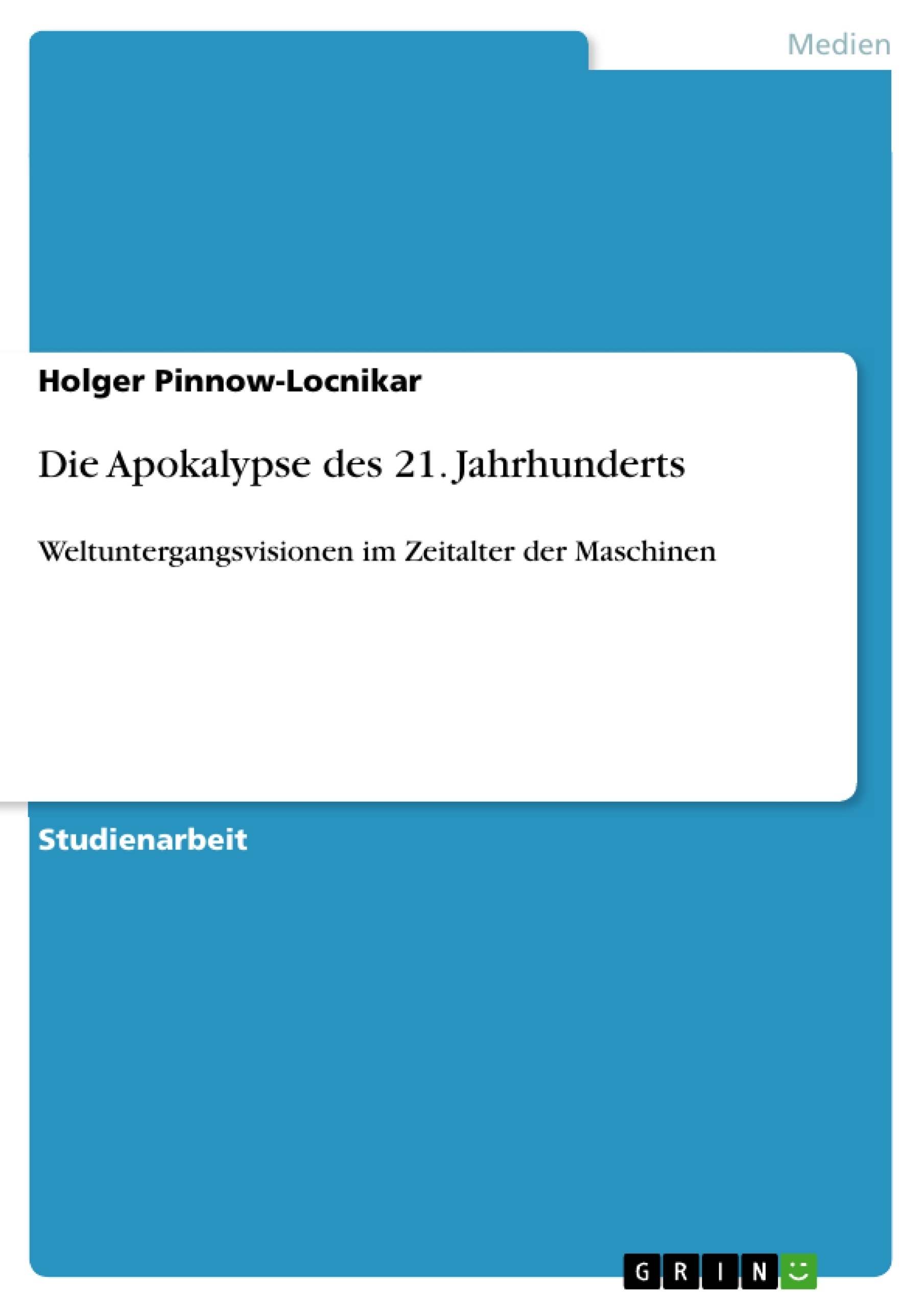Der Weltuntergang – das Drohgespinst am Horizont der menschlichen Entwicklung hat auch nach mehreren tausend Jahren nichts von seiner Aktualität eingebüßt. Nicht allein die Offenbarung des Johannes ist dabei der Ursprung der Weltuntergangserwartung, denn diese gibt es auch in anderen Kulturen. Was aber alle Untergangsvisionen auszeichnet, ist ihre Beziehung zu ihrer jeweiligen Entstehungszeit. Was in der Vorstellung der Menschen zur Ursache des Untergangs taugt, taucht in den verkündeten Visionen wieder auf.
"Die Vorstellung, das Scheinbare als das Reale gelten zu lassen, wird heute mit großem Enthusiasmus vorgetragen, sie nimmt den Status einer Offenbarung ein. Im Zentrum der Aufmerksamkeit ist eine von Menschenhand gefertigte und erdachte Maschine ..., die bereits den Auftrag hat, sich selbst zu zeugen. Dem Computer wird die Gottebenbürtigkeit aufgebürdet. Vordergründig avancierten die Techniker zu Göttern, nachhaltig wird die spirituelle Erlösung von der Maschine selbst erwartet. Der Kult um die Maschine als Leidens- und Imaginationswerkzeug hat gegen Ende des 20. Jahrhundert den Menschen völlig neu zu generieren, um den Traum Descartes’ wahr werden zu lassen: den Menschen als gut gehendes Uhrwerk zu verwirklichen. Mehr noch: Die Maschine hat die phantasmatische Macht erhalten, den Anthropos außer Kraft zu setzen, indem sie selbst mit den Insignien des Göttlichen beladen werden kann, denn Gott ist tot, hat Nietzsche uns wissen lassen. Der Cyborg nimmt Gestalt an und vertritt die Position der Engel: halb Maschine, halb Gott."
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Von der Apokalypse der Bibel zur Technik des 20. Jahrhunderts
- Maschinen: Definition
- Huldigung an die Maschine und an die Zukunft
- Untergang und Neuanfang
- Internet, Spiel und Wirklichkeit im Kalten Krieg
- Roboter, Androiden, Cyborgs
- Meine Freunde, die Roboter
- Meine Feinde, die Roboter
- Sendbote der Apokalypse
- Kleine Roboter bringen großes Verderben
- Das post-apokalyptische Leben in der Maschine
- Wissenschaftlicher Exkurs: Die Macht der Maschinen – was heute schon möglich ist
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Darstellung des Weltuntergangs in modernen, technikzentrierten Apokalypsen des 20. und frühen 21. Jahrhunderts. Sie analysiert, wie die Maschine als Symbol und Wegbereiter sowohl des Fortschritts als auch des Untergangs verstanden wird.
- Die Entwicklung des Apokalypse-Begriffs von der biblischen Offenbarung hin zu modernen Weltuntergangsvisionen.
- Die ambivalente Rolle der Maschine: Segen und Fluch der technologischen Entwicklung.
- Die Darstellung von Robotern, Androiden und Cyborgs in apokalyptischen Szenarien.
- Die Abhängigkeit der modernen Gesellschaft von Technologie und die damit verbundenen Ängste vor einem möglichen Systemkollaps.
- Die philosophischen und gesellschaftlichen Implikationen der Mensch-Maschine-Interaktion.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung klärt den vielschichtigen Begriff der „Apokalypse“ und stellt ihn in den Kontext der „Maschine“ als zentrales Element moderner Weltuntergangsvisionen. Es wird der Wandel der Bedeutung von „Apokalypse“ von der biblischen Offenbarung hin zum Synonym für den Weltuntergang erörtert und die Ambivalenz der Maschine als sowohl Fortschrittsbringer als auch potentielle Gefahrenquelle herausgestellt. Der Fokus liegt auf dem 20. und frühen 21. Jahrhundert und der damit verbundenen technischen Entwicklung, welche die Grundlage der modernen Apokalypse-Szenarien bildet. Die Einleitung legt die Grundlage für die weitere Auseinandersetzung mit dem Thema.
Von der Apokalypse der Bibel zur Technik des 20. Jahrhunderts: Dieses Kapitel verfolgt die Entwicklung des Apokalypse-Begriffs von seinen biblischen Ursprüngen bis zu seiner modernen Interpretation im Kontext der technischen Entwicklung des 20. Jahrhunderts. Es werden Parallelen zwischen der Verfolgung der frühen Christen und der heutigen Abhängigkeit von Technologie gezogen. Die zunehmende Automatisierung, die Massenproduktion und die damit verbundenen Gefahren wie Umweltverschmutzung und Arbeitslosigkeit werden als moderne Äquivalente zu den biblischen Plagen dargestellt. Das Kapitel betont den Wandel des Sinnbildes der Apokalypse von einer religiösen Offenbarung zu einem technisch induzierten Weltuntergang.
Maschinen: Definition: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition des Begriffs "Maschine" im Kontext der Arbeit. Es wird die Bedeutung der Maschine für die Industrialisierung und die moderne Gesellschaft hervorgehoben, sowie die ambivalenten Auswirkungen der fortschreitenden Automatisierung auf die Menschheit beleuchtet. Es werden verschiedene Perspektiven auf die Maschine präsentiert, von der Huldigung an den Fortschritt bis hin zur Angst vor der Entfremdung und der potenziellen Versklavung durch die Technik. Die Diskussion über Technikfeindlichkeit und die Dämonisierung der Technik bildet einen wichtigen Aspekt dieses Kapitels.
Huldigung an die Maschine und an die Zukunft: Dieses Kapitel untersucht die positive Wahrnehmung von Maschinen im Kontext des technischen Fortschritts und der Zukunft. Es analysiert, wie die Maschine als Symbol für Fortschritt, Effizienz und Modernität dient, und wie dieser Glaube an die positive Kraft der Maschine in der Gesellschaft verankert ist. Die Diskussion wird mit Blick auf die Auswirkungen dieser positiven Sichtweise auf die gesellschaftlichen Entwicklungen geführt, sowie auf die möglichen blinden Flecken dieser Perspektive.
Untergang und Neuanfang: Dieses Kapitel behandelt den Untergang und Neuanfang im Kontext der Apokalypse und der Rolle der Maschinen. Es thematisiert die Angst vor dem Untergang der Menschheit aufgrund von technologischen Entwicklungen, sowie die Hoffnung auf einen Neuanfang nach dem Ende der Welt. Die Betrachtung von verschiedenen dystopischen Zukunftsvisionen, die den Untergang durch die Maschine prophezeien, bildet den Schwerpunkt des Kapitels. Die unterschiedlichen Interpretationen von Untergang und Neuanfang, die sowohl Zerstörung als auch Erneuerung beinhalten können, werden diskutiert.
Schlüsselwörter
Apokalypse, Maschine, Technologie, Weltuntergang, Roboter, Androiden, Cyborgs, Industrialisierung, Automatisierung, Technikfeindlichkeit, dystopische Zukunftsvisionen, Mensch-Maschine-Interaktion.
Häufig gestellte Fragen zu: Moderne Technikzentrierte Apokalypsen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Darstellung des Weltuntergangs in modernen, technikzentrierten Apokalypsen des 20. und frühen 21. Jahrhunderts. Der Fokus liegt auf der Rolle der Maschine als Symbol und Wegbereiter sowohl des Fortschritts als auch des Untergangs.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung des Apokalypse-Begriffs von der biblischen Offenbarung bis zu modernen Weltuntergangsvisionen, die ambivalente Rolle der Maschine (Segen und Fluch der technologischen Entwicklung), die Darstellung von Robotern, Androiden und Cyborgs in apokalyptischen Szenarien, die Abhängigkeit der modernen Gesellschaft von Technologie und die damit verbundenen Ängste vor einem Systemkollaps, sowie die philosophischen und gesellschaftlichen Implikationen der Mensch-Maschine-Interaktion.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit beinhaltet Kapitel zu folgenden Themen: Einleitung, Von der Apokalypse der Bibel zur Technik des 20. Jahrhunderts, Maschinen: Definition, Huldigung an die Maschine und an die Zukunft, Untergang und Neuanfang, Internet, Spiel und Wirklichkeit im Kalten Krieg, Roboter, Androiden, Cyborgs, Meine Freunde, die Roboter, Meine Feinde, die Roboter, Sendbote der Apokalypse, Kleine Roboter bringen großes Verderben, Das post-apokalyptische Leben in der Maschine, Wissenschaftlicher Exkurs: Die Macht der Maschinen – was heute schon möglich ist, und Schlussbetrachtung.
Wie wird der Begriff "Apokalypse" definiert und behandelt?
Die Arbeit erörtert den Wandel der Bedeutung von „Apokalypse“ von der biblischen Offenbarung hin zum Synonym für den Weltuntergang. Sie untersucht die Parallelen zwischen der Verfolgung der frühen Christen und der heutigen Abhängigkeit von Technologie und stellt die zunehmende Automatisierung, Massenproduktion und deren Gefahren als moderne Äquivalente zu den biblischen Plagen dar.
Welche Rolle spielt die Maschine in der Arbeit?
Die Maschine wird als zentrales Element moderner Weltuntergangsvisionen betrachtet. Ihre ambivalente Rolle als sowohl Fortschrittsbringer als auch potentielle Gefahrenquelle wird umfassend analysiert, von der Huldigung an den Fortschritt bis hin zur Angst vor Entfremdung und Versklavung durch die Technik.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Apokalypse, Maschine, Technologie, Weltuntergang, Roboter, Androiden, Cyborgs, Industrialisierung, Automatisierung, Technikfeindlichkeit, dystopische Zukunftsvisionen, Mensch-Maschine-Interaktion.
Welche Zusammenfassung der Kapitel wird geboten?
Die Arbeit bietet Kapitelzusammenfassungen, die die zentralen Argumente und Themen jedes Kapitels kurz und prägnant beschreiben. Diese Zusammenfassungen geben einen Überblick über den Inhalt und den Fokus jedes Kapitels.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit ist für ein akademisches Publikum bestimmt, das sich mit den Themen Apokalypse, Technologie und Mensch-Maschine-Interaktion auseinandersetzt. Sie eignet sich für Studierende, Forschende und alle Interessierten, die sich für die Analyse von modernen Weltuntergangsvisionen interessieren.
- Quote paper
- Holger Pinnow-Locnikar (Author), 2003, Die Apokalypse des 21. Jahrhunderts, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/156753