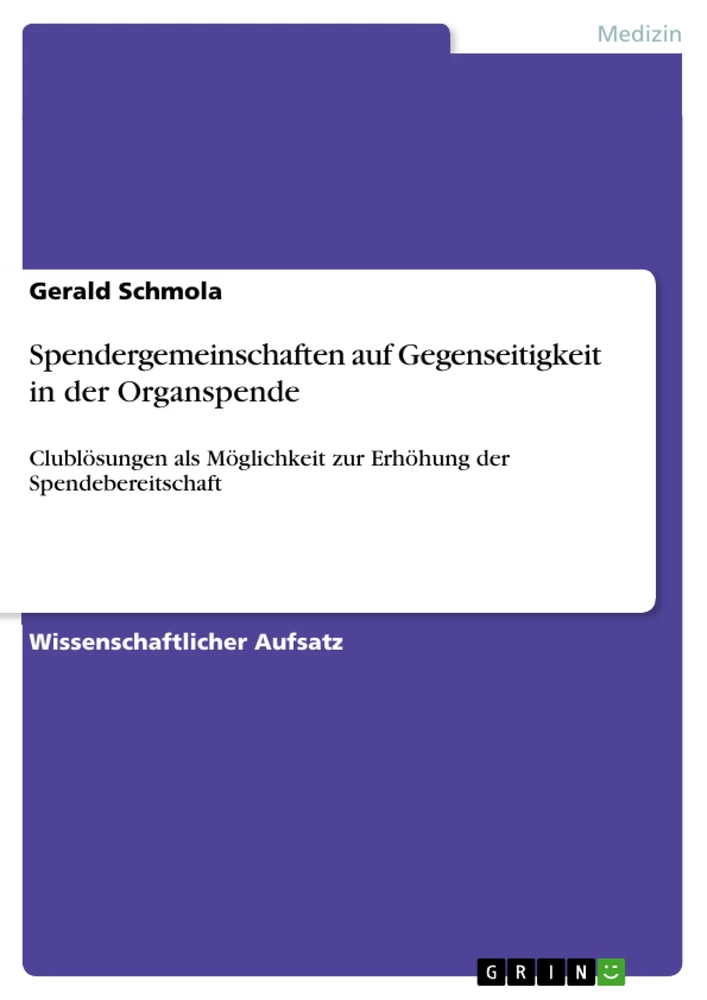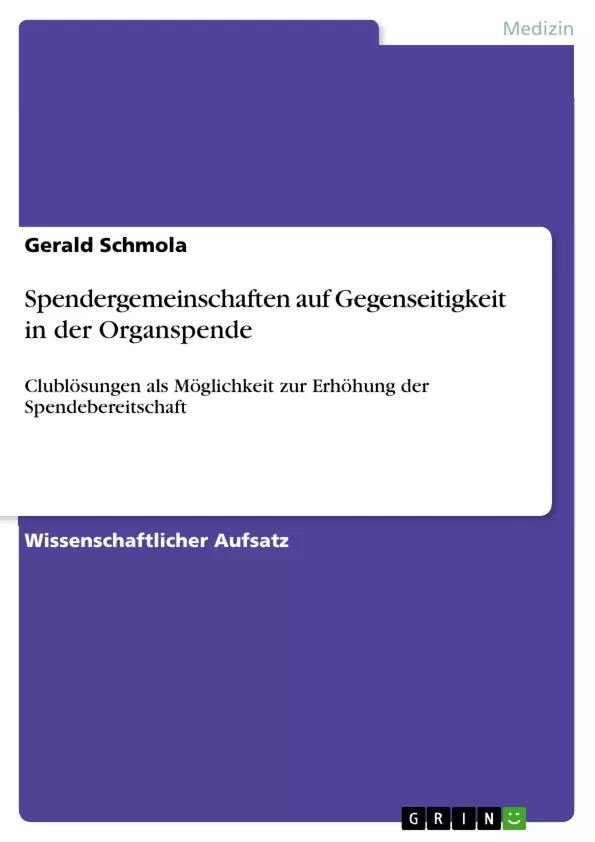Aufgrund der rasanten Fortschritte der Transplantationsmedizin stellt sich immer weniger die Frage, ob mit Hilfe einer Transplantation das Leben eines Patienten gerettet werden kann, vielmehr ist es fraglich, wer ein Organ erhalten kann. Derzeit warten in Deutschland etwa 12.000 Menschen auf ein Spenderorgan. Beispielsweise ist der Bedarf an Nieren etwa dreimal so hoch, wie derzeit Transplantate zur Verfügung stehen. Es gilt daher ein System zu finden, welches zur Erhöhung der Anzahl der Organe beiträgt, gleichzeitig aber auch individuelle Rechte möglichst gering einschränkt. In der Arbeit wird diskutiert, in wie weit Clublösungen diesen Anforderungen gerecht werden und welche Vor- und Nachteile durch solche Lösungen entstehen könnten. Zudem wird auf die ökonomischen Grundlagen der Clubtheorie eingegangen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Problemstellung
- 2. Die Theorie des Clubs
- 2.1. Entstehung
- 2.2. Kennzeichen von Clubs
- 2.3. Eigenschaften von Clubgütern
- 2.4. Probleme der Theorie ...
- 2.5. Zwischenfazit
- 3. Clublösungen in der Organspende
- 3.1. Begriff des Clubs
- 3.2. Vorteile der Alternativlösung.
- 3.3. Private Organisation von Spenderclubs
- 3.4. Problemfelder der Alternativlösung
- 3.4.1. Generationenkonflikt
- 3.4.2. Clubeinführung.
- 3.4.3. Kosten der Transplantation
- 3.4.4. Mangel und Überschuss an Organen
- 3.4.5. Weitere Defizite
- 3.4.6. Umsetzbarkeit der privaten Clublösung
- 3.5. Öffentlich-rechtlicher Club
- 3.6. Zwischenfazit
- 3.7. Club von Lebendspendern
- 4. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Möglichkeit von Clublösungen in der Organspende als Alternative zur derzeitigen Situation. Dabei werden die Theorie des Clubs und deren Anwendung in der Praxis analysiert, um die potentiellen Vorteile und Herausforderungen dieser Lösung zu bewerten. Die Arbeit strebt danach, ein besseres Verständnis der Herausforderungen im Bereich der Organspende zu gewinnen und einen Beitrag zur Diskussion um die Optimierung der Organvergabe zu leisten.
- Theorie des Clubs und deren Anwendung im Kontext der Organspende
- Vorteile und Nachteile von Clublösungen in der Organspende
- Problemfelder der Clublösung, wie Generationenkonflikt, Clubeinführung und Kosten der Transplantation
- Möglichkeiten und Herausforderungen der Implementierung von Clublösungen in der Organspende
- Potenzial von Clublösungen zur Erhöhung der Spendebereitschaft und Fairness in der Organvergabe
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Problemstellung
Dieses Kapitel beleuchtet die aktuelle Problematik der Organspende in Deutschland, die durch den Mangel an verfügbaren Organen gekennzeichnet ist. Der Mangel an Spenderorganen führt zu Wartelisten, die für viele Patienten bedrohlich lang sind. Die Arbeit stellt die Frage, ob und wie die eigene Spendebereitschaft in der Frage der Organverteilung berücksichtigt werden kann.
Kapitel 2: Die Theorie des Clubs
Dieses Kapitel erläutert die Theorie des Clubs und deren grundlegenden Prinzipien. Es werden die Kennzeichen und Eigenschaften von Clubs sowie die Eigenschaften von Clubgütern im Detail analysiert.
Kapitel 3: Clublösungen in der Organspende
Dieses Kapitel untersucht die Anwendung der Clubtheorie auf den Bereich der Organspende. Es werden die potentiellen Vorteile von Clublösungen, aber auch die damit verbundenen Problemfelder diskutiert, darunter der Generationenkonflikt, die Clubeinführung und die Kosten der Transplantation.
Schlüsselwörter
Organspende, Clubtheorie, Spendebereitschaft, Organvergabe, Fairness, Transplantationsgesetz, Clublösungen, Generationenkonflikt, Kosten der Transplantation, private Organisation, öffentlich-rechtlicher Club, Lebendspende.
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine Spendergemeinschaft auf Gegenseitigkeit (Clublösung)?
Ein System, bei dem Menschen, die bereit sind Organe zu spenden, im Bedarfsfall bevorzugt ein Organ erhalten (Reziprozitätsprinzip).
Was sind die Vorteile einer Clublösung in der Organspende?
Sie könnte die Spendebereitschaft erhöhen, die Fairness fördern und den massiven Mangel an verfügbaren Organen in Deutschland lindern.
Welche ökonomische Theorie liegt dem Konzept zugrunde?
Die Arbeit basiert auf der ökonomischen „Theorie des Clubs“, die Eigenschaften von Clubgütern und den Ausschluss von Nicht-Mitgliedern analysiert.
Welche Problemfelder gibt es bei der Einführung von Spenderclubs?
Genannt werden der Generationenkonflikt, hohe Kosten der Transplantation, ethische Bedenken beim Ausschluss von Nicht-Spendern und die rechtliche Umsetzbarkeit.
Wie viele Menschen warten in Deutschland aktuell auf ein Organ?
Laut Abstract warten derzeit etwa 12.000 Menschen auf ein Spenderorgan, wobei der Bedarf an Nieren dreimal so hoch ist wie das Angebot.
Was ist ein öffentlich-rechtlicher Club in diesem Kontext?
Eine staatlich organisierte Form der Spendergemeinschaft, die im Gegensatz zu privaten Clubs eine allgemeine rechtliche Grundlage für die Organvergabe schaffen würde.
- Quote paper
- Prof. Dr. Gerald Schmola (Author), 2010, Spendergemeinschaften auf Gegenseitigkeit in der Organspende, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/156756