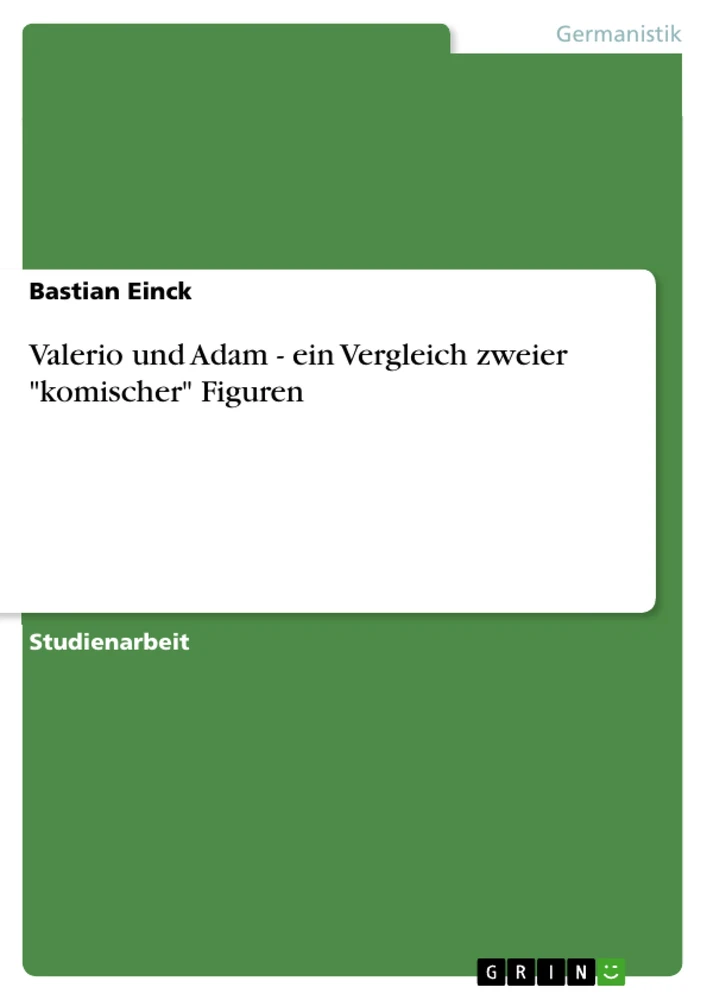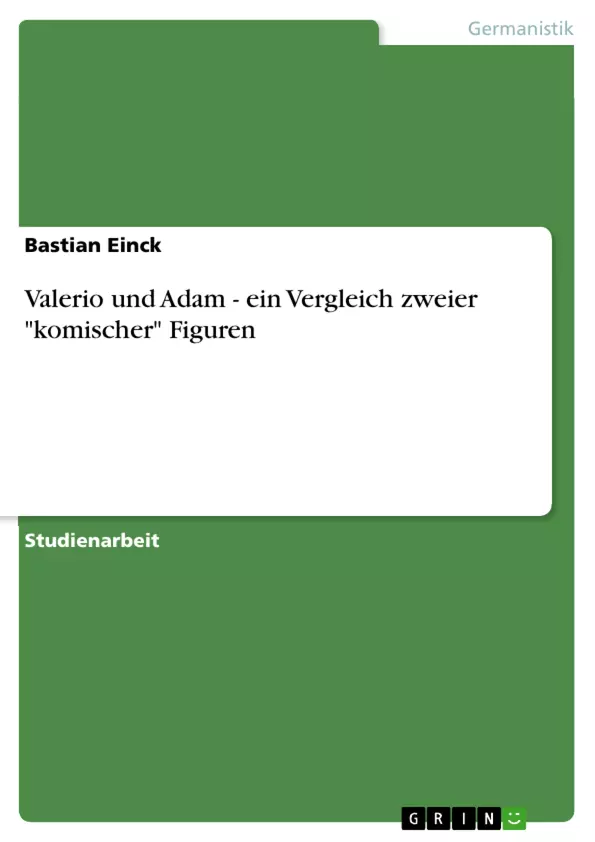In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstanden die zwei literarischen Werke von Georg Büchner und Heinrich von Kleist, denen die beiden Figuren entnommen sind, um die es in dieser Hausarbeit hauptsächlich geht. Büchners Leonce und Lena (um 18361) ist ebenso wie Kleists Der zerbrochne Krug (um 18062) als Lustspiel klassifiziert. Die beiden komischen Figuren Valerio
(Leonce und Lena) und Dorfrichter Adam (Der zerbrochne Krug) sind jedoch Grund verschieden.
Ich möchte herausarbeiten, in welchen Aspekten der Komik sich die beiden Figuren unterscheiden und herausfinden, ob vielleicht doch Gemeinsamkeiten bestehen.
Um das Phänomen Komik greifbarer zu machen, wird im zweiten Kapitel der Begriff näher definiert. Außerdem werden einige relevante Theorien zur Komik vorgestellt, die die Aussage des Hauptteils meiner Arbeit unterstützen sollen. Ein besonderes Augenmerk im theoretischen Teil gilt es auf die Figurenkomik zu legen, da diese besonders wichtig für die spätere Analyse ist.
Im dritten Kapitel werden Adam und Valerio anhand von ausgewählten Textbeispielen miteinander verglichen. Dieser Vergleich ist in sprachliche und formelle Verfahren der Komik unterteilt, um die Gegenüberstellung strukturierter darstellen zu können. Im ersten Teil werden Sprach- und Dialogkomik, Wortspiele, sowie der Gebrauch von Intertexten und Sprichwörtern analysiert. Im zweiten Teil beschäftige ich mich mit Verwechslungskomik, Situationskomik und abschließend mit Typenkomik.
Die beiden Figuren werden jeweils in den einzelnen Kategorien auf ihre komischen Merkmale analysiert und anschließend bilanzierend gegenübergestellt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Komik - Was ist das eigentlich?
- Von Aristoteles bis Freud - historische Theorien zur Komik
- Neuere Theorien zur Komik
- Figurenkomik
- Adam und Valerio - Zwei komische Figuren im Vergleich
- Sprachliche Verfahren der Komik
- Sprach- und Dialogkomik
- Wortspiele
- Intertexte und Sprichwörter
- Formelle Verfahren der Komik
- Verwechslungskomik
- Situationskomik
- Typenkomik
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert die komischen Figuren Valerio aus Georg Büchners "Leonce und Lena" und Dorfrichter Adam aus Heinrich von Kleists "Der zerbrochne Krug" und untersucht die Unterschiede und Gemeinsamkeiten in ihren komischen Aspekten. Die Arbeit beleuchtet die historische Entwicklung des Begriffs "Komik" und präsentiert relevante Theorien, die das Phänomen der Figurenkomik erklären.
- Historische und aktuelle Theorien zur Komik
- Analyse von Sprach- und Dialogkomik, Wortspielen und Intertexten
- Untersuchung von Verwechslungs-, Situations- und Typenkomik
- Vergleich der komischen Figuren Valerio und Adam anhand von ausgewählten Textbeispielen
- Definition und Erläuterung des Begriffs "Komik" im Kontext der Figurenanalyse
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in das Thema der Hausarbeit ein, indem sie die beiden literarischen Werke von Georg Büchner und Heinrich von Kleist vorstellt und die beiden Figuren Valerio und Adam als Ausgangspunkt der Analyse definiert. Sie erläutert die Zielsetzung der Arbeit, die darin besteht, die Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der Komik der beiden Figuren herauszuarbeiten.
Komik - Was ist das eigentlich?
Dieses Kapitel widmet sich der Definition des Begriffs "Komik" und seiner historischen Entwicklung. Es beleuchtet die Theorien von Aristoteles, Platon, M. Bachtin und anderen bedeutenden Denkern, die sich mit dem Phänomen des Komischen beschäftigt haben.
Adam und Valerio - Zwei komische Figuren im Vergleich
In diesem Kapitel erfolgt die Analyse der komischen Merkmale der beiden Figuren Valerio und Adam anhand von ausgewählten Textbeispielen. Die Analyse ist in sprachliche und formelle Verfahren der Komik unterteilt, um eine strukturierte Gegenüberstellung zu ermöglichen. Die sprachlichen Verfahren umfassen Sprach- und Dialogkomik, Wortspiele, Intertexte und Sprichwörter. Die formalen Verfahren beschäftigen sich mit Verwechslungskomik, Situationskomik und Typenkomik. Die Analyse zeigt die spezifischen komischen Merkmale der beiden Figuren in den verschiedenen Kategorien und stellt sie vergleichend gegenüber.
Schlüsselwörter
Komik, Figurenkomik, Sprachkomik, Dialogkomik, Wortspiel, Intertext, Sprichwort, Verwechslungskomik, Situationskomik, Typenkomik, Aristoteles, Baudelaire, Freud, Leonce und Lena, Der zerbrochne Krug, Valerio, Dorfrichter Adam
Häufig gestellte Fragen
Wer sind die komischen Figuren Valerio und Adam?
Valerio stammt aus Büchners "Leonce und Lena", Dorfrichter Adam aus Kleists "Der zerbrochne Krug". Beide sind zentrale Figuren in bedeutenden deutschen Lustspielen.
Was versteht man unter "Figurenkomik"?
Figurenkomik entsteht aus den spezifischen Charaktereigenschaften, dem Verhalten oder den körperlichen Merkmalen einer Person, die das Publikum zum Lachen bringen.
Wie unterscheiden sich die sprachlichen Verfahren der Komik bei beiden?
Die Arbeit analysiert Wortspiele, Dialogkomik und den Einsatz von Sprichwörtern sowie Intertexten, um die individuellen komischen Stile von Valerio und Adam aufzuzeigen.
Welche Rolle spielt die Situationskomik in den Werken?
Situationskomik entsteht durch Verwechslungen oder missliche Lagen, in die die Figuren geraten, was besonders bei Dorfrichter Adam ein zentrales Element ist.
Welche historischen Theorien zur Komik werden herangezogen?
Die Arbeit beleuchtet Ansätze von Aristoteles über Baudelaire bis hin zu Freud, um die Komik der Figuren theoretisch zu untermauern.
- Quote paper
- Bastian Einck (Author), 2007, Valerio und Adam - ein Vergleich zweier "komischer" Figuren, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/157127