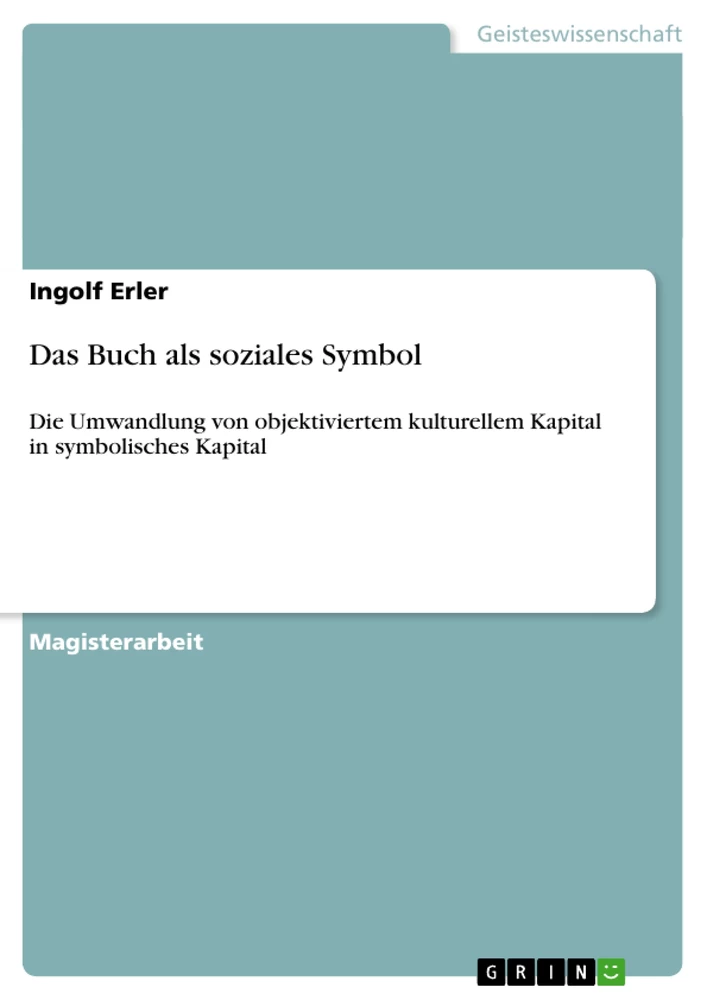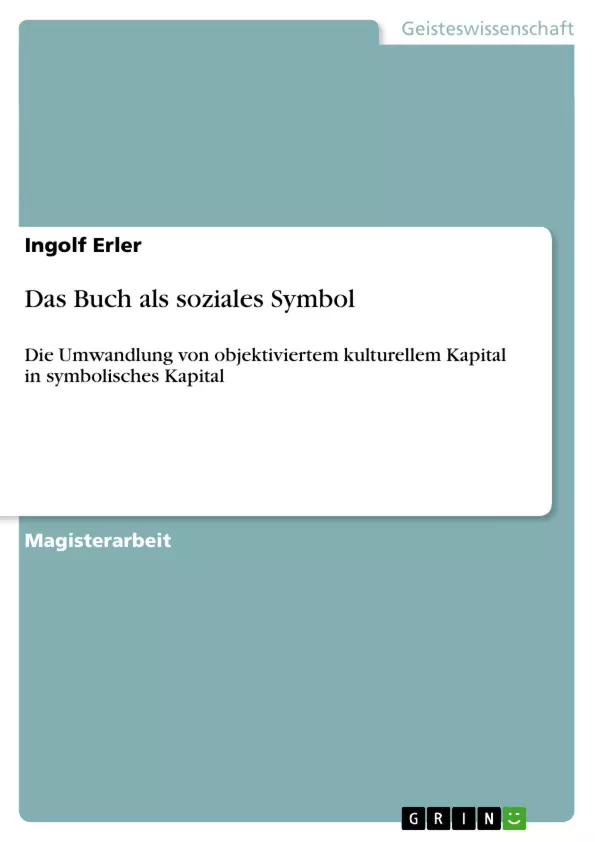Bücher sind fixer Bestandteil unserer Alltagswelt geworden. Dabei umgeben sie uns nicht einfach, wir schmücken uns vielmehr damit, stellen die Bücher in Regalen zur Schau und möchten damit wohl auch etwas aussagen. Das Thema dieses Diplomarbeitsprojekts am Institut für Soziologie der Universität Wien dreht sich um diesen Aspekt eines „demonstrativen Buchkonsums“.
Bücher als Kulturgüter besitzen einen Doppelcharakter. Neben der Funktion der Informationsspeicherung dienen sie als Inszenierungs-/Repräsentationsobjekt, deren Verwendung einen wie auch immer gearteten Profit bringen. Im Bewusstsein dieser Funktion werden Bücher strategisch in Szene gesetzt. Ob im Hintergrund von Fernsehinterviews, zur Verstärkung des ExpertInnencharakters von Interviewten, ob zur Unterstreichung des staatsmännischen Charakters eines Politikers in Pressekonferenzen oder auch zur Unterstreichung von Werbebotschaften. Bücher sind bedeutende Objekte in den zentralen Repräsentationsräumlichkeiten von Wohnungen und dienen unserer alltäglichen Darstellung zur Hervorhebung unseres Lebensstils. Dementsprechend orientieren sich BesucherInnen an den dargestellten Büchern, um sich ein Bild ihres Gegenübers zu machen.
Die Arbeit stützt sich vor allem auf die soziologischen Theorien von Thorstein Veblen, Erving Goffman sowie Pierre Bourdieu, wobei letztere den Schwerpunkt bildet. Darin anschließend wird über einen sozialhistorischen Rückblick die Verwendungs- und Inszenierungsgeschichte von Büchern nachgezeichnet. Anschließend findet sich eine Deutung von dieser Praktiken in unseren Gegenwartsgesellschaften. Hier findet sich auch ein Überblick über die Ergebnisse bisher in Österreich durchgeführter Studien der Buchmarkt- und Leseforschung. Im empirischen Teil wird mit Hilfe qualitativer Bildanalyse am Beispiel von Abbildungen in Printmedien bzw. Werbesujets nachvollzogen, ob und wie Bücher dazu beitragen sollen oder können, „symbolisches Kapital“ auf die den Büchern zugeschriebene(n) Person(en) oder Produkten zu übertragen.
Inhaltsverzeichnis
- VORWORT UND DANKSAGUNG
- EINLEITUNG
- Theoretischer Hintergrund
- Inhaltlicher Aufbau
- ERSTER ABSCHNITT: SOZIOLOGISCHE BASISTHEORIE
- Die Theorie des demonstrativen Konsums von Thorstein Veblen
- Leben und Werk
- Der demonstrative Konsum
- Anwendung auf die Forschungsfrage
- Der dramaturgische Ansatz bei Erving Goffman
- Leben und Werk
- Der „dramaturgische Ansatz“
- Anwendung auf die Forschungsfrage
- Die Theorie der sozialen Distinktion von Pierre Bourdieu
- Leben und Werk
- Eine Theorie zur Überwindung von Gegensätzen
- Der Habitus als Vermittler zwischen sozialem Raum und Lebensstilen
- Der Raum der sozialen Positionen und Lagen
- Die sozialen Felder
- Die Kapitaltheorie
- Kulturelles Kapital
- Anwendung auf die Forschungsfrage
- ZWEITER ABSCHNITT: ZUR BEDEUTUNG DES BUCHES ALS SYMBOL UND REPRÄSENTATIONSOBJEKT
- Begriffsdefinitionen: Das Buch als Symbol des kulturellen Kapitals
- Linguistische Herkunft:
- Medienwissenschaftliche Definitionen
- Geschichte der Buchkultur
- Die Frühgeschichte des Mediums Buch: Von der Rolle zum Kodex
- Die Buchrolle
- Bibliotheken
- Das Buch als Kodex
- Entwicklung in Asien und der arabischen Welt
- Das Buch im Mittelalter
- Förderer der christlichen Buchkultur
- Entwicklung vom Kult- zum Arbeitsgerät
- Handel
- Buchsammlungen und -inszenierungen
- Gutenberg und die Reformation (15.-17. Jahrhundert)
- Kritik an der Entwicklung
- Expansion des Buchaufkommens
- Das Buch in Christentum und Judentum
- Buchformen
- Buchbesitz in der Renaissance
- Bibliotheken
- Buchkultur zwischen Barock und Biedermeier (17. bis frühes 19. Jahrhundert)
- Buchsammlungen
- Die erste „Leserevolution“ im 18. Jahrhundert
- Bürgerliches Wohnen im Biedermeier
- Entwicklung eines Massenmarktes: Ende des 19. und 20. Jahrhundert
- Stichworte zur Situation im Nationalsozialismus
- Das Taschenbuch im 20. Jahrhundert
- Ikonographie des Lesers/der Leserin
- Buch und Geschlechterordnung im historischen Vergleich
- Zusammenfassung und Resümee des historischen Abriss
- Das Buch in der Gesellschaft
- Der soziale Zugang zum Buch in Österreich
- Buchbesitz, Medienreichweite
- Leseverhalten
- Der soziale Sinn für das Buch
- Die Einteilung von Büchern nach ihrem Verwendungszweck
- Das Buch als Wohnaccessoire
- Objektiviertes kulturelles Kapital als Ausdrucksmittel der Identität
- Bücher als Ausdrucksmittel der sozialen Integration
- „Potemkinsche Bibliotheken“
- Zusammenstellung legitimer Repräsentationswerke
- Varianten, mit Büchern „in Beziehung zu leben“
- Resümee
- Zusammenführung und Anwendung auf die Forschungsfrage
- Die Rolle des Buches als Repräsentationsobjekt
- Die soziale Bedeutung des Buches als Ausdruck von Status und Bildung
- Der Wandel des Buches vom exklusiven Gut zur Massenware
- Die Bedeutung des Buches für die Inszenierung von Identität und Lebensstil
- Die symbolische Gewalt, die mit der Verwendung des Buches verbunden sein kann
- Die Einleitung erläutert die Hypothese der Arbeit, dass Bücher in der Inszenierung von Menschen ein soziales Symbol darstellen. Dazu wird eine kurze Einführung in den Alltagsgebrauch von Büchern gegeben und die Bedeutung von Büchern für die Inszenierung von Identität und sozialem Status beschrieben.
- Der erste Abschnitt beschäftigt sich mit den soziologischen Basistheorien, die für die Untersuchung des Buches relevant sind. Dabei werden die Theorien des „demonstrativen Konsums“ von Thorstein Veblen, des „dramaturgischen Ansatzes“ von Erving Goffman und der „sozialen Distinktion“ von Pierre Bourdieu vorgestellt. Die Bedeutung dieser Theorien für die Forschungsfrage wird herausgestellt.
- Der zweite Abschnitt widmet sich der Bedeutung des Buches als Symbol und Repräsentationsobjekt. Es wird eine begriffliche Annäherung an das Buch unternommen, indem die linguistische Herkunft des Begriffs „Buch“ sowie medienwissenschaftliche Definitionen analysiert werden. Anschließend wird ein historischer Abriss über die Entwicklung des Buches von den Anfängen über die Buchrolle und den Kodex bis zur Erfindung des Buchdrucks durch Gutenberg und die Bedeutung des Buches im Laufe der Reformation beschrieben. Schließlich wird der Wandel des Buches vom exklusiven Gut der Herrscherhäuser zum Massenmedium im 20. Jahrhundert erläutert. Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei der Rolle des Buches als Repräsentationsobjekt und der Entwicklung von Bibliotheken in unterschiedlichen Kontexten.
- Der dritte Abschnitt widmet sich der empirischen Überprüfung der Forschungshypothese. Dazu werden die Grundlagen qualitativer Sozialforschung sowie die Methode der Foto- und Bildanalyse erläutert. Die konkrete Vorgehensweise der Bildanalyse wird anhand von fünf Beispielen aus Werbe- und Pressefotografien verdeutlicht. Es wird gezeigt, wie Bücher in der Inszenierung von Personen und Produkten symbolisches Kapital erzeugen und welche Bedeutung ihnen in der Gesellschaft zukommt.
- Der abschließende Abschnitt fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und beleuchtet die herausragende Bedeutung des Buches als Symbol in der Gesellschaft. Es wird verdeutlicht, dass das Buch trotz aller Medienkonkurrenz seine Funktion als Ausdruck von Wissen, Kultur und Bildung sowie als Symbol für einen bestimmten Lebensstil und Habitus bewahrt hat.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Verwendung des Buches als soziales Symbol. Sie analysiert, wie Menschen durch die Inszenierung von Büchern in ihrer Umgebung, als objektiviertes kulturelles Kapital, symbolisches Kapital gewinnen können. Der Fokus liegt dabei auf der Darstellung von Büchern als Ausdruck von Bildung, Kultur und Intellektualität.
Zusammenfassung der Kapitel
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit der Soziologie des Buches, der Symbolfunktion von Kulturgütern, dem Konzept des „objektivierten kulturellen Kapitals“, der Inszenierung von Identität und Lebensstil, der Rolle von Bildung und Wissen in der Gesellschaft, der Geschichte der Buchkultur und der Bedeutung des Buches als Repräsentationsobjekt. Es werden soziologische Theorien von Thorstein Veblen, Erving Goffman und Pierre Bourdieu herangezogen.
Häufig gestellte Fragen
Was wird unter dem Begriff „demonstrativer Buchkonsum“ verstanden?
Es handelt sich um die strategische Inszenierung von Büchern als Repräsentationsobjekte, um den eigenen sozialen Status, Bildung und kulturelles Kapital nach außen darzustellen.
Welche soziologischen Theorien bilden die Basis der Arbeit?
Die Arbeit stützt sich primär auf Pierre Bourdieus Theorie der sozialen Distinktion sowie auf Ansätze von Thorstein Veblen (demonstrativer Konsum) und Erving Goffman (dramaturgischer Ansatz).
Wie hat sich die Funktion des Buches historisch gewandelt?
Das Buch entwickelte sich vom exklusiven Kult- und Herrschaftsgut im Mittelalter über die Reformation und das Biedermeier bis hin zum Massenmedium des 20. Jahrhunderts.
Was ist „objektiviertes kulturelles Kapital“ im Zusammenhang mit Büchern?
Bücher als physische Objekte fungieren als sichtbarer Ausdruck von Bildung und Geschmack, die dem Besitzer symbolisches Kapital und soziale Anerkennung verschaffen.
Welche Rolle spielen Bücher heute als Wohnaccessoires?
Bücher dienen in modernen Wohnräumen oft zur Hervorhebung des Lebensstils und helfen Besuchern, sich ein Bild von der Identität und dem Intellekt des Gastgebers zu machen.
- Arbeit zitieren
- Ingolf Erler (Autor:in), 2005, Das Buch als soziales Symbol, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/157163