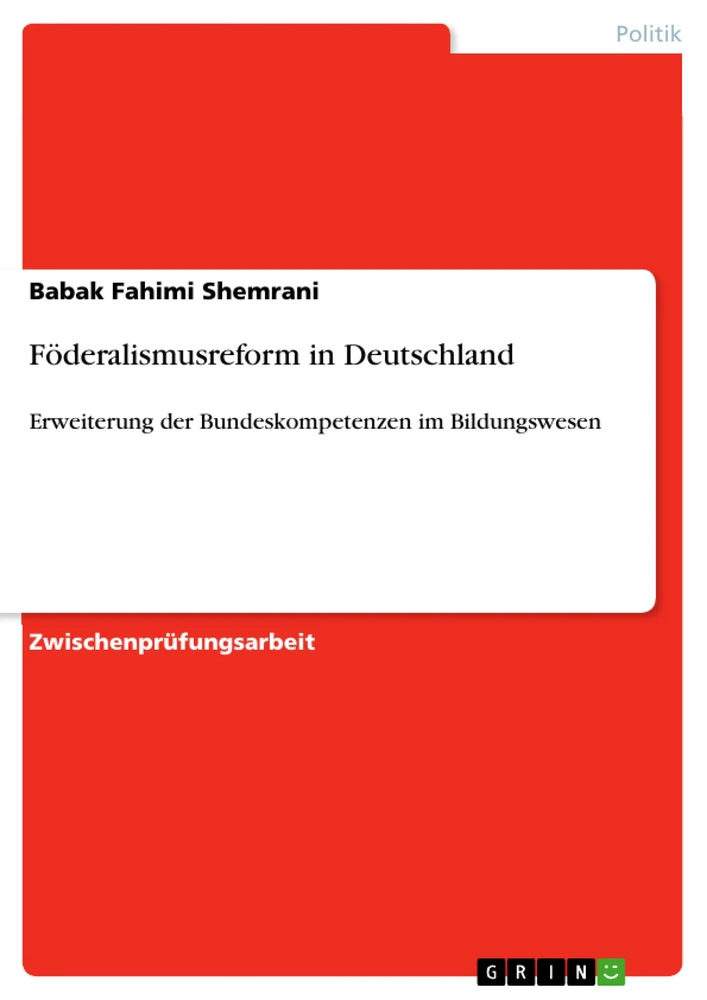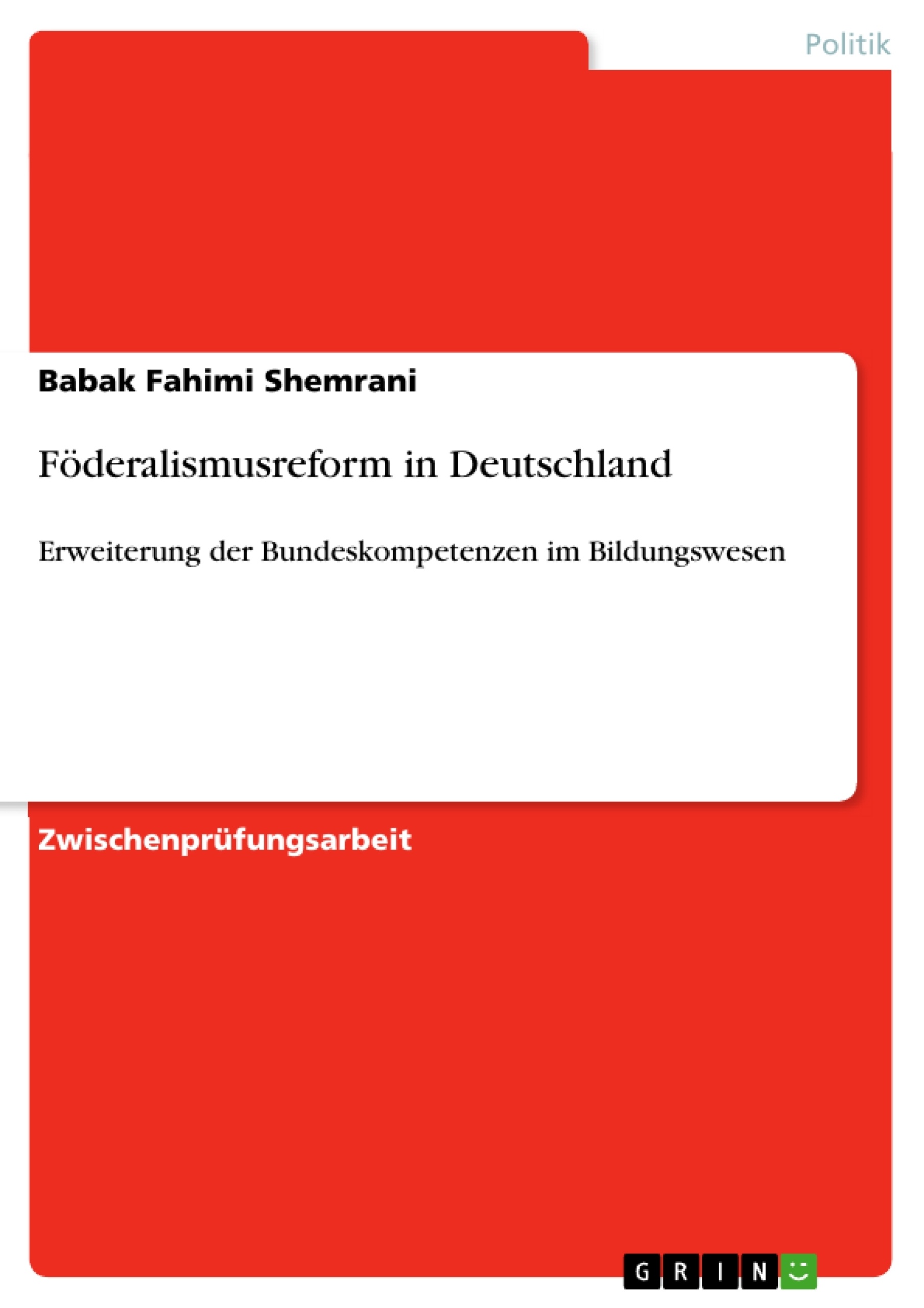Aufgrund der aktuellen Diskussionen und Beschlüssen der Bundesländer und der Bundesregierung, das föderale System der Bundesrepublik neu zuordnen, habe ich dieses Thema zum Gegenstand dieser Arbeit gemacht.
Bereits im 17. Jahrhundert wurde der Begriff „federalism“ auf Staatsverbindungen angewandt. Die heute gängige Bedeutung von Föderalismus, wurde jedoch erst während der amerikanischen Revolution geprägt.
Mit der U.S. Verfassung von 1787 wurde zum ersten mal ein föderales System real umgesetzt. Die durchaus historische Tradition der deutschen „Staatenbündnisse“ einzugehen, hat sich nach dem II. Weltkrieg fortgesetzt und modernisiert. So haben die Verfassungsgeber, in Zusammenarbeit mit den Besatzungsmächten, eine bundesstaatliche Ordnung für Deutschland gewählt. Um die föderale Ordnung vor grundsätzlichen Änderungen, durch zukünftige Generationen zu schützen, wurde Art. 79 Abs.32 eingeführt. Die Mitwirkungsrechte der Länder sollten dadurch sicher gestellt werden. Allerdings haben sich im internationalen Vergleich erhebliche Defizite im Bereich Bildungswesen aufgetan. Damit stellt sich die Frage, ob die absolute Kulturhoheit der Länder für das Auseinadergleiten des Bildungswesen, innerhalb des Bundesgebietes,
verantwortlich gemacht werden kann oder nicht?
Deshalb soll, im Rahmen dieser Arbeit, der Frage nachgegangen werden, ob der Bund vor dem Hintergrund der Föderalismusreform mehr inhaltliche Kompetenzen im Bildungswesen erwirken kann oder nicht und sind dafür grundlegende Verfassungsänderungen notwendig?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Föderalismus
- Eine Allgemeine Definition von Föderalismus
- Subsidiaritätsprinzip
- Föderalismus in Deutschland; Ein historischer Überblick
- Eine Allgemeine Definition von Föderalismus
- Politikverflechtung in der Bundesrepublik Deutschland
- Die administrative Verflechtung
- Kompetenzverflechtung von Bund und Ländern im Bereich Bildungswesen
- Kulturhoheit der Länder
- Die Modernisierung der bundesstaatlichen Ordnung
- Reformziele von Bund und Länder
- Der Bund
- Die Reformziele des Bundes im Bereich Hochschulwesen
- Länder
- Reformziele der Länder im Bereich Hochschulwesen
- Der Bund
- Reformziele von Bund und Länder
- Mehr Kompetenzrechte für den Bund im Bildungswesen
- Methodologie (Indikatoren)
- Die Ausgaben von Bund und Länder im Bereich Bildungswesen für das
- Ausgaben bundesweit
- Ausgaben der Länder
- Durchschnittliche Unterrichtsstunden
- Schüler- Lehrkräfte- Relation
- Ergebnisse der Vergleichsstudie PISA- E
- Die Mobilität der Studienanfänger und Studierenden in Deutschland im Jahr 2000
- Prozentuale Verteilung der Studierenden nach Bundesländer
- Sesshaftigkeit der deutschen Hochschulzugangsberechtigten
- Wanderung der Hochschulzugangsberechtigten zwischen den Ländern
- Das Geschlechterverhältnis an den deutschen Hochschulen
- Ausländische Studierende in Deutschland
- Die internationale Vergleichbarkeit der deutschen Abschlüsse im Tertiären Bereich
- Die Ausgaben von Bund und Länder im Bereich Bildungswesen für das
- Methodologie (Indikatoren)
- Ergebnisdarstellung
- Lösungsansatz
- Ist der hier vorgestellte Lösungsansatz mit dem Grundgesetz vereinbar?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die aktuelle Debatte um die Reform des föderalen Systems in Deutschland und konzentriert sich dabei auf die Frage, ob der Bund mehr Kompetenzen im Bildungswesen erlangen sollte. Die Arbeit beleuchtet historische Entwicklungen des Föderalismus in Deutschland und analysiert die aktuelle Situation der Politikverflechtung zwischen Bund und Ländern, insbesondere im Bereich Bildung.
- Entwicklung und Bedeutung des Föderalismus in Deutschland
- Die Rolle der Kulturhoheit der Länder im Bildungswesen
- Die Reformziele des Bundes und der Länder im Bereich Bildung
- Die Auswirkungen von Kompetenzen des Bundes auf die Qualität des Bildungswesens
- Die Vereinbarkeit eines erweiterten Bundeskompetenzbereichs mit dem Grundgesetz
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit setzt den Kontext für die Analyse und stellt die Forschungsfrage dar, ob der Bund mehr Kompetenzen im Bildungswesen erlangen sollte.
- Föderalismus: Dieses Kapitel liefert eine allgemeine Definition von Föderalismus und erläutert das Subsidiaritätsprinzip. Weiterhin wird ein historischer Überblick über den Föderalismus in Deutschland gegeben.
- Politikverflechtung in der Bundesrepublik Deutschland: Dieses Kapitel beschreibt die Prozesse der Politikverflechtung zwischen Bund und Ländern, insbesondere in Bezug auf die Finanzverfassung.
- Kulturhoheit der Länder: Dieses Kapitel beleuchtet die Bedeutung der Kulturhoheit der Länder im Bildungswesen und diskutiert die Herausforderungen, die sich aus der dezentralen Struktur ergeben.
- Die Modernisierung der bundesstaatlichen Ordnung: Dieses Kapitel befasst sich mit den Reformzielen des Bundes und der Länder im Bereich Bildung und analysiert die aktuelle Situation im Hochschulwesen.
- Mehr Kompetenzrechte für den Bund im Bildungswesen: Dieses Kapitel diskutiert die Frage, ob der Bund mehr Kompetenzrechte im Bildungswesen erhalten sollte. Es werden verschiedene Indikatoren und Daten zur Analyse der Bildungssituation in Deutschland herangezogen.
- Ergebnisdarstellung: Dieses Kapitel stellt die Ergebnisse der Analyse dar und zeigt die Auswirkungen von mehr Bundeskompetenzen auf das Bildungswesen auf.
- Lösungsansatz: Dieses Kapitel präsentiert einen Lösungsansatz für die Herausforderungen im Bildungswesen und diskutiert die Möglichkeiten für eine effizientere Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern.
- Ist der hier vorgestellte Lösungsansatz mit dem Grundgesetz vereinbar?: Dieses Kapitel untersucht die rechtlichen Rahmenbedingungen für eine Erweiterung der Bundeskompetenzen im Bildungswesen und die Vereinbarkeit mit dem Grundgesetz.
Schlüsselwörter
Föderalismus, Bildungswesen, Kulturhoheit, Kompetenzverflechtung, Politikverflechtung, Grundgesetz, Hochschulwesen, Reform, Subsidiaritätsprinzip, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der Föderalismusreform in Bezug auf das Bildungswesen?
Die Reform hinterfragt, ob die absolute Kulturhoheit der Länder zu einem Auseinanderdriften der Bildungsqualität führt und ob der Bund mehr inhaltliche Kompetenzen erhalten sollte, um die Vergleichbarkeit zu sichern.
Was bedeutet "Kulturhoheit der Länder"?
Die Kulturhoheit ist die primäre Zuständigkeit der deutschen Bundesländer für Gesetzgebung und Verwaltung im Bereich Bildung, Erziehung und Kultur, die durch das Grundgesetz geschützt ist.
Welche Rolle spielt das Subsidiaritätsprinzip im Föderalismus?
Das Subsidiaritätsprinzip besagt, dass Aufgaben nach Möglichkeit von der kleinsten bzw. untersten Einheit (z.B. den Ländern) übernommen werden sollten, bevor die übergeordnete Ebene (der Bund) eingreift.
Warum werden Verfassungsänderungen für eine Bildungsreform diskutiert?
Da die Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern in Art. 79 Abs. 3 GG verankert ist, benötigen grundlegende Verschiebungen der Zuständigkeiten im Bildungswesen eine Änderung des Grundgesetzes.
Wie beeinflussen PISA-Studien die Debatte um den Föderalismus?
Ergebnisse von Vergleichsstudien wie PISA-E decken Defizite im Bildungswesen auf und dienen als Indikator dafür, ob die föderale Struktur die Bildungsqualität fördert oder behindert.
- Arbeit zitieren
- Babak Fahimi Shemrani (Autor:in), 2005, Föderalismusreform in Deutschland, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/157225