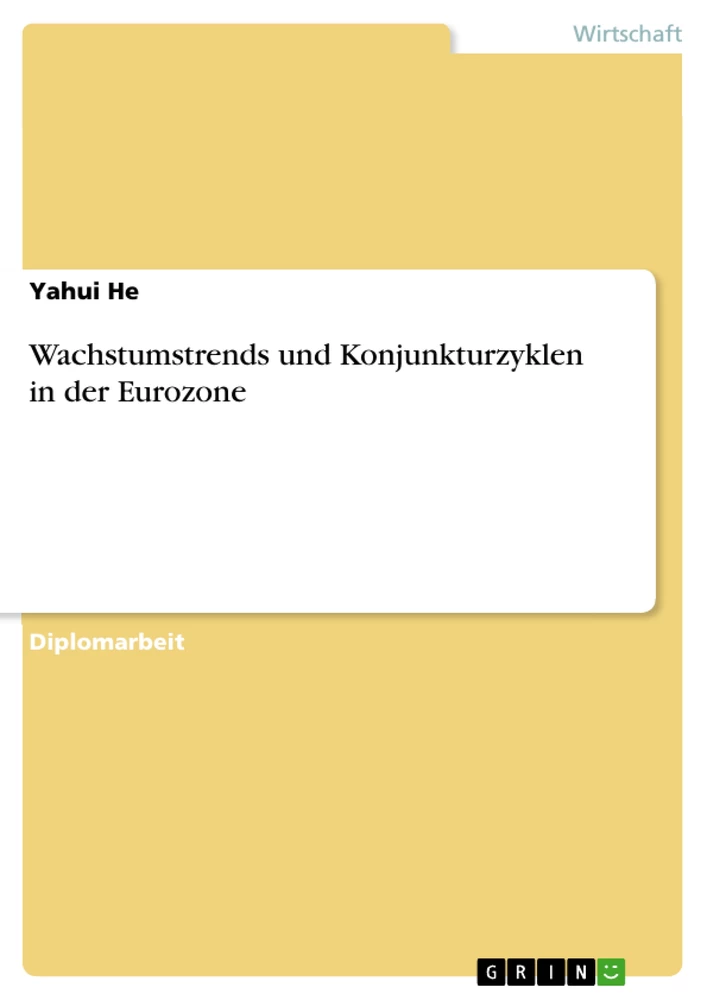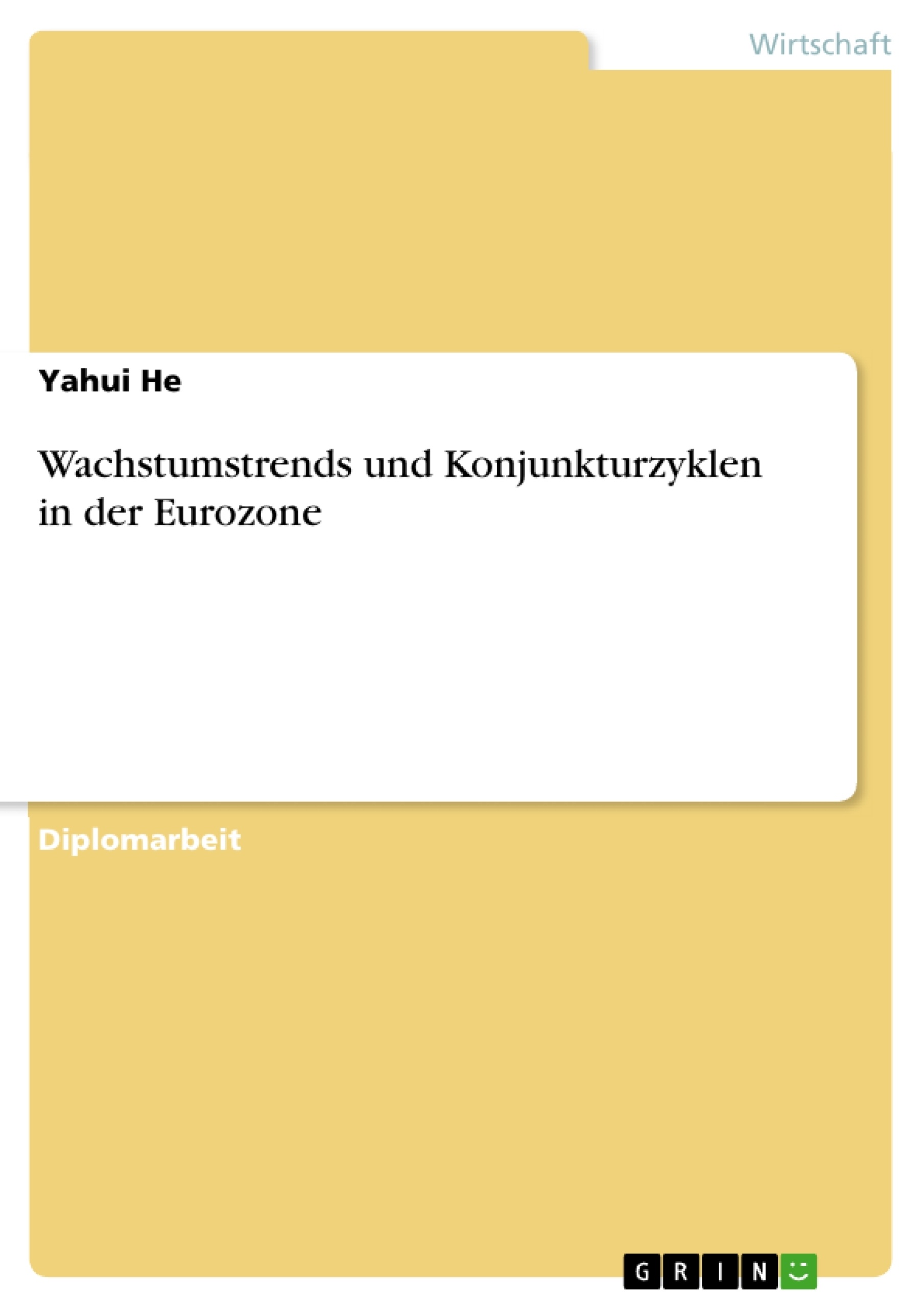Testabstract - hallo es funktioniert?„Italien möchte aus der Eurozone aussteigen“, sagte der italienische Minister im Juni 2005. Diese Nachricht war ein Schock für die Europäische Währungsunion (EMU) (vgl. Baldwin/Wyplosz, 2006, S.360). Seitdem sind folgende Thesen in der akademischen Welt öffentlich diskutiert worden: Divergierten die Mitgliedstaaten nach der Entstehung der EMU? Hat die stabilitätsorientierte Geldpolitik die langfristige Wachstumsrate in den Kernländern gedämpft?
Demzufolge stehen die Charakteristika der Wachstumstrends und Konjunkturzyklen in der Eurozone im Brennpunkt. Diese beiden wirtschaftlichen Phänomene gaben sowohl zu theoretischen, empirischen als auch politischen Debatten Anlass. Die vorliegende Arbeit setzt sich zum Ziel, durch Untersuchung der Wachstumstrends und Konjunkturzyklen die obengenannten Thesen zu analysieren und versucht, ein schlüssiges Lösungskonzept vorzuschlagen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I Theoretische Debatte
- 1. Die Endogenitätshypothese
- 2. Die Spezialisierungshypothese
- 3. Auswirkung der monetären Integration auf die Konjunktur
- II Empirische Analysen zu Konjunkturzyklen und Wachstumstrends in der Eurozone
- 1. Grundlage zur Konjunkturanalyse
- 1.1 Zum Wachstumstrend
- 1.2 Zu Konjunkturzyklen
- 2. Konvergenzanalyse der Wachstumsraten des BIP in der Eurozone
- 2.1 Stilisierte Fakten der Wachstumsdifferenzen in der Eurozone
- 2.2 Untersuchung zu Wachstumsdifferenzen in Mitgliedländern
- 2.3 Zerlegung der Wachstumsraten in Trend- und zyklische Komponente zur Erklärung der Wachstumsdifferenz im Euro-Raum
- 3. Synchronisierung der Konjunkturzyklen im Eurosystem
- 3.1 Korrelationsanalyse zur Synchronisierung der Konjunkturzyklen
- 3.1.1 Korrelation der klassischen Zyklen
- 3.1.2 Korrelation der Wachstumszyklen
- 3.2 Synchronisierung der Rezessionsphase der Zyklen
- 4. Stilisierte Fakten des Wachstumstrends und des Konjunkturzyklus der Eurozone
- 4.1 Zur Volatilität des Output-Wachstums
- 4.2 Zum Wachstumstrend
- 4.3 Charakteristika des Wachstumszyklus
- III Die Auswirkung der einheitlichen Geldpolitik auf Wachstumstrends und Konjunkturzyklen
- 1. Kann die einheitliche Geldpolitik die Divergenz kontrollieren?
- 1.1 Kleine Länder profitieren
- 1.2 Wechselkurs und Ausschlag der Konjunkturzyklen
- 2. Preisstabilitätsorientierte Geldpolitik und BIP-Wachstum in der Eurozone
- 2.1 Preisstabilität zur Kontrolle der zyklischen Bewegung der Konjunktur
- 2.1.1 Theoretische Interpretation
- 2.1.2 Gefahr der Inflation
- 2.2 Preisstabilität zur Gewährleistung des Wachstumstrends
- 2.2.1 Inflationserwartung und langfristiges Wachstumspotenzial
- 2.2.2 Glaubwürdigkeit der EZB
- 2.3 Preisstabilitätsorientierte Geldpolitik zugunsten Strukturreform
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht Wachstumstrends und Konjunkturzyklen in der Eurozone. Ziel ist es, die Auswirkungen der monetären Integration auf die Konjunkturdynamik zu analysieren und die Rolle der einheitlichen Geldpolitik zu bewerten.
- Analyse der theoretischen Debatte um Endogenität und Spezialisierungshypothesen im Kontext der europäischen Integration.
- Empirische Untersuchung von Konvergenz und Divergenz der Wachstumsraten im Euroraum.
- Analyse der Synchronisierung von Konjunkturzyklen innerhalb der Eurozone.
- Bewertung der Auswirkungen der einheitlichen Geldpolitik auf Wachstumstrends und Konjunkturzyklen.
- Untersuchung des Einflusses der Preisstabilitätspolitik auf das BIP-Wachstum.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Diplomarbeit ein und skizziert die Forschungsfrage und die Methodik. Sie erläutert die Bedeutung der Untersuchung von Wachstumstrends und Konjunkturzyklen in der Eurozone und die Relevanz der Ergebnisse für die Wirtschaftspolitik.
I Theoretische Debatte: Dieses Kapitel beleuchtet verschiedene theoretische Ansätze zur Erklärung der Auswirkungen wirtschaftlicher Integration auf Konjunkturzyklen. Es werden die Endogenitäts- und Spezialisierungshypothese diskutiert und deren Implikationen für die Eurozone analysiert. Der Fokus liegt auf dem Verständnis der potenziellen Effekte der monetären Union auf die wirtschaftliche Entwicklung der Mitgliedsstaaten.
II Empirische Analysen zu Konjunkturzyklen und Wachstumstrends in der Eurozone: Dieser Abschnitt präsentiert empirische Analysen zu Konjunkturzyklen und Wachstumstrends in der Eurozone. Es werden Daten zur Konvergenz der Wachstumsraten des BIP analysiert und die Faktoren, die zu Wachstumsdifferenzen zwischen den Mitgliedsstaaten beitragen, untersucht. Methoden zur Zerlegung von Wachstumsraten in Trend- und zyklische Komponenten werden angewendet, um die Dynamik des Wirtschaftswachstums zu beleuchten. Die Synchronisierung der Konjunkturzyklen im Euroraum wird ebenfalls untersucht, unter Berücksichtigung der Korrelation von Output-Lücken und Rezessionsphasen.
III Die Auswirkung der einheitlichen Geldpolitik auf Wachstumstrends und Konjunkturzyklen: Das Kapitel analysiert die Auswirkung der einheitlichen Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) auf Wachstumstrends und Konjunkturzyklen in der Eurozone. Es wird untersucht, ob die einheitliche Geldpolitik die Divergenz der wirtschaftlichen Entwicklung zwischen den Mitgliedsstaaten kontrollieren kann und wie sich die Preisstabilitätspolitik auf das BIP-Wachstum auswirkt. Die Rolle von Faktoren wie Wechselkurse und Inflationserwartungen wird ebenfalls berücksichtigt.
Schlüsselwörter
Eurozone, Wachstumstrends, Konjunkturzyklen, monetäre Integration, einheitliche Geldpolitik, Preisstabilität, BIP-Wachstum, Konvergenz, Divergenz, Endogenitätshypothese, Spezialisierungshypothese, Korrelationsanalyse.
Häufig gestellte Fragen zur Diplomarbeit: Wachstumstrends und Konjunkturzyklen in der Eurozone
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht Wachstumstrends und Konjunkturzyklen in der Eurozone. Im Mittelpunkt steht die Analyse der Auswirkungen der monetären Integration auf die Konjunkturdynamik und die Bewertung der Rolle der einheitlichen Geldpolitik.
Welche theoretischen Ansätze werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die Endogenitäts- und Spezialisierungshypothese im Kontext der europäischen Integration. Diese theoretischen Ansätze dienen als Grundlage zur Erklärung der Auswirkungen wirtschaftlicher Integration auf Konjunkturzyklen und werden auf die Eurozone angewendet.
Welche empirischen Analysen werden durchgeführt?
Empirische Analysen konzentrieren sich auf die Konvergenz und Divergenz der Wachstumsraten des BIP in der Eurozone. Die Arbeit untersucht Faktoren, die zu Wachstumsdifferenzen zwischen den Mitgliedsländern beitragen, und analysiert die Synchronisierung von Konjunkturzyklen. Dazu werden Methoden zur Zerlegung von Wachstumsraten in Trend- und zyklische Komponenten verwendet sowie Korrelationsanalysen durchgeführt.
Wie wird die einheitliche Geldpolitik bewertet?
Die Arbeit analysiert die Auswirkungen der einheitlichen Geldpolitik der EZB auf Wachstumstrends und Konjunkturzyklen. Dabei wird untersucht, ob diese die Divergenz der wirtschaftlichen Entwicklung zwischen den Mitgliedstaaten kontrollieren kann und wie sich die Preisstabilitätspolitik auf das BIP-Wachstum auswirkt. Die Rolle von Wechselkursen und Inflationserwartungen wird ebenfalls berücksichtigt.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in drei Hauptteile: Einleitung, Theoretische Debatte, Empirische Analysen zu Konjunkturzyklen und Wachstumstrends in der Eurozone und Die Auswirkung der einheitlichen Geldpolitik auf Wachstumstrends und Konjunkturzyklen. Jedes Kapitel enthält detaillierte Analysen und Ergebnisse.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Eurozone, Wachstumstrends, Konjunkturzyklen, monetäre Integration, einheitliche Geldpolitik, Preisstabilität, BIP-Wachstum, Konvergenz, Divergenz, Endogenitätshypothese, Spezialisierungshypothese, Korrelationsanalyse.
Welche Forschungsfragen werden beantwortet?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Auswirkungen der monetären Integration auf die Konjunkturdynamik zu analysieren und die Rolle der einheitlichen Geldpolitik bei der Steuerung von Wachstumstrends und Konjunkturzyklen zu bewerten. Dabei wird insbesondere der Einfluss der Preisstabilitätspolitik auf das BIP-Wachstum untersucht.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit kombiniert theoretische Analysen mit empirischen Methoden. Die empirischen Analysen umfassen u.a. Konvergenzanalysen der Wachstumsraten des BIP, Zerlegung der Wachstumsraten in Trend- und zyklische Komponenten und Korrelationsanalysen zur Synchronisierung der Konjunkturzyklen.
- Arbeit zitieren
- Yahui He (Autor:in), 2007, Wachstumstrends und Konjunkturzyklen in der Eurozone, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/157272