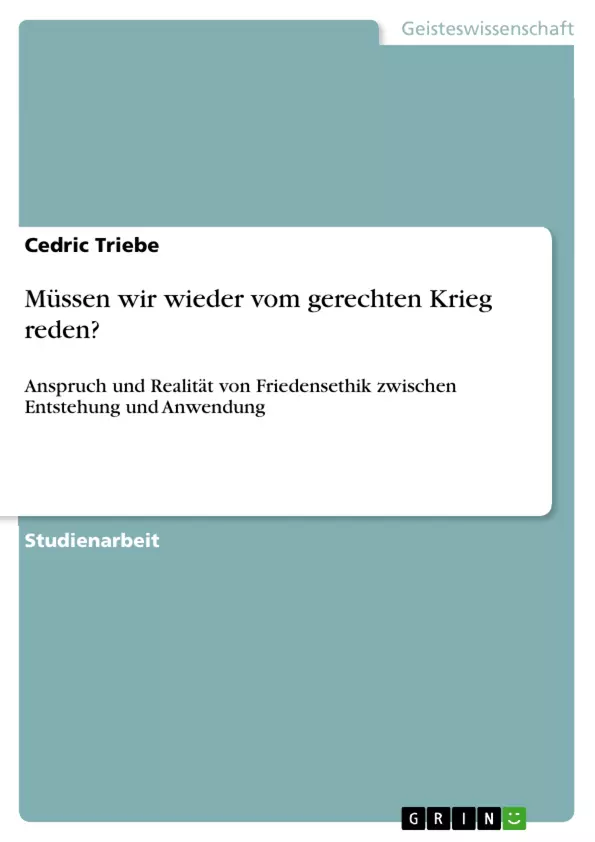Die Arbeit beleuchtet das Konzept des Gerechten Friedens vor der dem Horizont des theologischen Konzepts vom Gerechten Krieg und wirft die Frage auf, ob nicht angesichts der aktuellen Sicherheitslage nicht das Konzept vom Gerechten Krieg wieder produktiv in die Debatte eingebracht werden müsste.
Mit dem 24.02.2022 war es wieder bewusst, es gibt Krieg hier in Europa und wahrscheinlich war er nach dem 2. Weltkrieg auch nie weg von Europa. Mit dem Beginn der Großoffensive der russischen Föderation auf das Staatsgebiet der Ukraine entflammte
in Deutschland eine gesamtgesellschaftliche Debatte, welche auch die evangelische Kirche und die evangelische Theologie beanspruchte, denn „[f]ür die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) bildet der Frieden von Anfang an ein herausragendes
Thema öffentlicher Verantwortung.“ Dabei gibt es in der evangelischen Kirche nicht die eine Meinung zum Thema Krieg und Frieden und seinen zahlreichen Subdebatten. Während mit dem amtierenden Friedensbeauftragten der EKD, Landesbischof Friedrich Kramer, die pazifistischere Position innerhalb der EKD einen starke und wirkmächtige Bühne bekam, gab und gibt es genau so Stimmen, welche eher eine abgewogenere Meinung vertraten. Aber jenseits der Debatten und einzelnen Positionierungen von Menschen im kirchenleitenden Amt gilt es der Frage nachzugehen, was die spezifisch evangelische Vorstellung von Krieg und Frieden ist. Vor welchem theologischen Hintergrund wird innerkirchlich um die Frage des richtigen Umgangs mit dem Ukrainekrieg und seinen Auswirkungen gerungen. Dieser Hintergrund soll in der „Friedensdenkschrift“: „Aus Gottes Frieden leben – für gerechten Frieden sorgen“ des Rates der EKD von 2007 zum Ausdruck kommen. Dabei ist auch die Denkschrift selbst von Debatten durchzogen, da in ihr „nach Möglichkeit ein auf christlicher Verantwortung beruhender, sorgfältig geprüfter und stellvertretend für die ganze Gesellschaft formulierter Konsens zum Ausdruck kommen“ soll.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Entstehung der Denkschrift „Aus Gottes Frieden leben – für gerechten Frieden sorgen“
- 2.1 Die äußeren Umstände, unter denen die Denkschrift entstand
- 2.2 Der Weg der EKD zur Denkschrift
- 3. Die Denkschrift und ihre Theologie
- 3.1 Aufbau der Denkschrift
- 3.2 Anthropologie
- 3.2.1 Ursprung des Bösen und das Verhaftet-sein in der Sünde
- 3.2.2 Fähigkeit des Menschen zum Frieden
- 3.3 Lehre vom gerechten Krieg
- 3.3.1 Theologische Position zum Krieg in den Urgemeinden
- 3.3.2 Augustins Überlegungen vom bellum iustum
- 3.3.3 Thomas von Aquins Lehre vom bellum iustum
- 3.4 Gerechter Friede
- 3.4.1 Paradigmenwechsel vom Gerechten Krieg zum Gerechten Frieden
- 3.4.2 Leitmotiv des Gerechten Friedens
- 3.4.3 Was bedeutet gerecht?
- 3.4.4 Kritik am Gerechten Frieden als Leitmotiv christlicher Friedensethik
- 4. Gegenwärtige Herausforderungen für eine protestantische Friedensethik nach dem Leitmotiv des Gerechten Friedens
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Denkschrift der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) „Aus Gottes Frieden leben – für gerechten Frieden sorgen“ von 2007 im Kontext des Ukrainekriegs. Ziel ist es, die spezifisch evangelische Vorstellung von Krieg und Frieden zu beleuchten und den Paradigmenwechsel von der Lehre des gerechten Krieges zum gerechten Frieden zu analysieren. Die Arbeit fragt nach der theologischen Relevanz dieses Wechsels angesichts aktueller sicherheitspolitischer Entwicklungen.
- Entstehung und Kontext der EKD-Denkschrift „Aus Gottes Frieden leben – für gerechten Frieden sorgen“
- Theologische Grundlagen der Denkschrift: Anthropologie und Lehre vom gerechten Krieg
- Der Paradigmenwechsel vom gerechten Krieg zum gerechten Frieden
- Herausforderungen für eine protestantische Friedensethik im Lichte des Leitmotivs des Gerechten Friedens
- Relevanz der Denkschrift für aktuelle Debatten um Krieg und Frieden
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die aktuelle Debatte um Krieg und Frieden in der evangelischen Kirche im Kontext des Ukrainekriegs dar. Sie hebt die unterschiedlichen Positionen innerhalb der EKD hervor und benennt die EKD-Denkschrift von 2007 als zentralen Untersuchungsgegenstand. Die Arbeit untersucht, ob der in der Denkschrift vollzogene Paradigmenwechsel vom gerechten Krieg zum gerechten Frieden angesichts der aktuellen Lage weiterhin theologisch sinnvoll ist.
2. Entstehung der Denkschrift „Aus Gottes Frieden leben – für gerechten Frieden sorgen“: Dieses Kapitel beleuchtet den Entstehungskontext der Denkschrift. Es beschreibt die politischen Umstände der Zeit, wie die Überwindung der europäischen Teilung, das Ende des Kalten Krieges und die Entstehung neuer Konfliktherde. Der zweite Teil des Kapitels verfolgt den innerkirchlichen Diskurs zur Friedensethik von 1981 bis 2007 nach.
3. Die Denkschrift und ihre Theologie: Dieses Kapitel analysiert die Theologie der Denkschrift. Es untersucht den Aufbau des Dokuments, die anthropologische Grundlage, die Darstellung der Lehre vom gerechten Krieg in Bezug auf die Urgemeinden, Augustinus und Thomas von Aquin. Schließlich wird der Paradigmenwechsel zum „gerechten Frieden“ als Leitmotiv detailliert erläutert, inklusive einer Auseinandersetzung mit dem Begriff „gerecht“ und Kritik an dieser Position.
4. Gegenwärtige Herausforderungen für eine protestantische Friedensethik nach dem Leitmotiv des Gerechten Friedens: Dieses Kapitel befasst sich mit den aktuellen Herausforderungen für eine protestantische Friedensethik im Kontext des Leitmotivs „Gerechter Friede“. Es analysiert die Relevanz und die praktische Umsetzbarkeit des Paradigmenwechsels angesichts aktueller Konflikte und Sicherheitspolitischer Entwicklungen. Es vermutlich eine kritische Auseinandersetzung mit den Grenzen und Möglichkeiten des Konzepts des Gerechten Friedens.
Schlüsselwörter
Gerechter Krieg, Gerechter Friede, Friedensethik, Evangelische Kirche in Deutschland (EKD), Ukrainekrieg, Theologie des Friedens, Paradigmenwechsel, Anthropologie, Augustinus, Thomas von Aquin, Friedensdenkschrift.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt der Denkschrift "Aus Gottes Frieden leben – für gerechten Frieden sorgen"?
Die Denkschrift "Aus Gottes Frieden leben – für gerechten Frieden sorgen" der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) aus dem Jahr 2007 ist der zentrale Untersuchungsgegenstand dieser Analyse. Die Denkschrift behandelt die evangelische Vorstellung von Krieg und Frieden und vollzieht einen Paradigmenwechsel von der Lehre des gerechten Krieges zum gerechten Frieden.
Was sind die Hauptziele dieser Arbeit in Bezug auf die Denkschrift?
Ziel dieser Arbeit ist es, die spezifisch evangelische Vorstellung von Krieg und Frieden zu beleuchten und den Paradigmenwechsel von der Lehre des gerechten Krieges zum gerechten Frieden zu analysieren. Die Arbeit fragt nach der theologischen Relevanz dieses Wechsels angesichts aktueller sicherheitspolitischer Entwicklungen, insbesondere im Kontext des Ukrainekriegs.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die folgenden Themen:
- Entstehung und Kontext der EKD-Denkschrift "Aus Gottes Frieden leben – für gerechten Frieden sorgen"
- Theologische Grundlagen der Denkschrift: Anthropologie und Lehre vom gerechten Krieg
- Der Paradigmenwechsel vom gerechten Krieg zum gerechten Frieden
- Herausforderungen für eine protestantische Friedensethik im Lichte des Leitmotivs des Gerechten Friedens
- Relevanz der Denkschrift für aktuelle Debatten um Krieg und Frieden
Wie wird die Entstehung der Denkschrift untersucht?
Die Arbeit beleuchtet den Entstehungskontext der Denkschrift, indem sie die politischen Umstände der Zeit (Überwindung der europäischen Teilung, Ende des Kalten Krieges, Entstehung neuer Konfliktherde) und den innerkirchlichen Diskurs zur Friedensethik von 1981 bis 2007 nachzeichnet.
Was beinhaltet die theologische Analyse der Denkschrift?
Die theologische Analyse der Denkschrift untersucht den Aufbau des Dokuments, die anthropologische Grundlage, die Darstellung der Lehre vom gerechten Krieg (in Bezug auf die Urgemeinden, Augustinus und Thomas von Aquin) und den Paradigmenwechsel zum "gerechten Frieden" als Leitmotiv. Auch die Auseinandersetzung mit dem Begriff "gerecht" und Kritik an dieser Position werden behandelt.
Welche aktuellen Herausforderungen für die Friedensethik werden diskutiert?
Die Arbeit befasst sich mit den aktuellen Herausforderungen für eine protestantische Friedensethik im Kontext des Leitmotivs "Gerechter Friede". Es wird die Relevanz und praktische Umsetzbarkeit des Paradigmenwechsels angesichts aktueller Konflikte und sicherheitspolitischer Entwicklungen analysiert. Auch eine kritische Auseinandersetzung mit den Grenzen und Möglichkeiten des Konzepts des Gerechten Friedens wird erwartet.
Welche Schlüsselwörter sind mit dieser Arbeit verbunden?
Die Schlüsselwörter für diese Arbeit sind: Gerechter Krieg, Gerechter Friede, Friedensethik, Evangelische Kirche in Deutschland (EKD), Ukrainekrieg, Theologie des Friedens, Paradigmenwechsel, Anthropologie, Augustinus, Thomas von Aquin, Friedensdenkschrift.
- Citar trabajo
- Cedric Triebe (Autor), 2024, Müssen wir wieder vom gerechten Krieg reden?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1572944