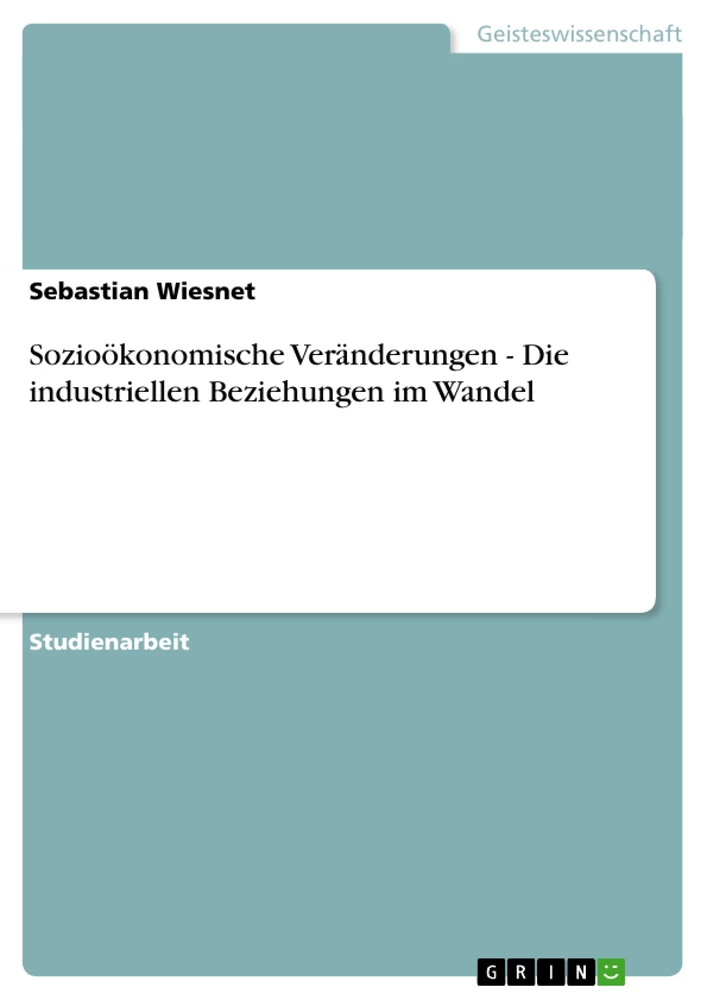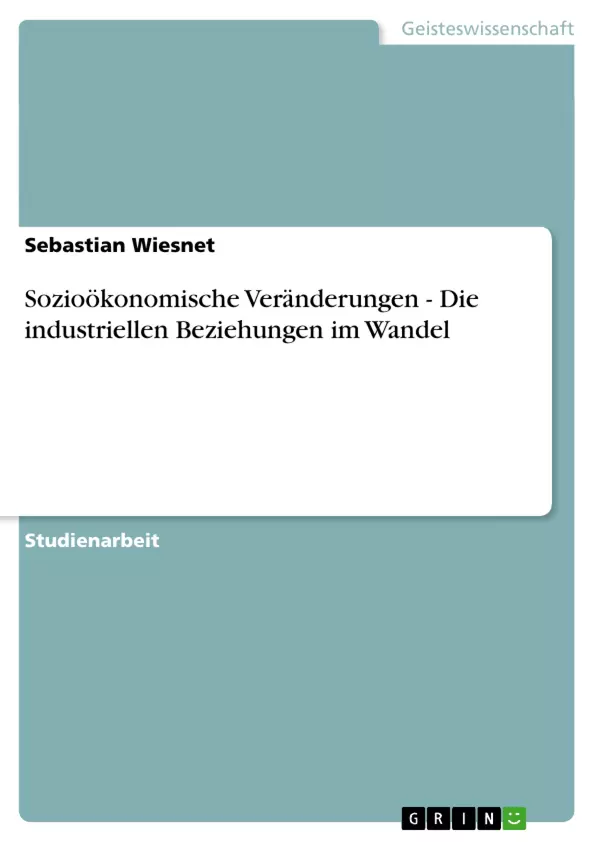Das Deutsche Modell der industriellen Beziehungen stand lange Zeit für Stabilität, Sicherheit, Wachstum und Beschäftigung. Es gewährleistete Prosperität und sozialen Frieden. Es galt sogar als Vorzeigemodell der Interessensregulierung zwischen Arbeit und Kapital. Doch das „goldene Zeitalter“ (Schroeder 2000, S.23) ist Vergangenheit. Durch Politische Umbrüche von globaler Bedeutung, weltwirtschaftliche Entwicklungen, technolo-gische und dadurch soziale Veränderungen wurde die Welt in den letzten 15 Jahre geprägt wie nie zuvor. Die Gesellschaft befindet sich im Wandel – und mit ihr muss sich auch das Deutsche Modell wan-deln, wenn es seine Ziele erreichen und sich weiterhin behaupten will. Im folgenden werde ich zunächst die neuen Herausforderungen, vor denen das Deutsche Modell steht, im einzelnen aufzeigen. Dabei soll deutlich werden, dass sich vor allem drei elementare Ei-genschaften des Tarifsystems als problematisch erweisen. Zu nennen sind das Solidaritätsprinzip, welches sich im Zuge der (Wieder-)Vereinigung als fehlerhaft darstellt (3.1); die Idee der allge-meinverbindlichen Regulierung der Arbeitsbedingungen, welche mit der zunehmenden Pluralisie-rung von Arbeits- und Erwerbsformen konfrontiert wird (3.2); sowie die auf ein nationalstaatlich beschränktes Wirtschaftssystem ausgelegte Tarifpolitik in einer fortschreitend globalisierten Welt-wirtschaft (3.3). Anschließend sollen die Auswirkungen (dieser Problematik) auf Funktion und Struktur des Deut-schen Modells diskutiert werden, bevor schließlich auf mögliche Entwicklungstendenzen der industriellen Beziehungen in Deutschland eingegangen wird.
Inhaltsverzeichnis
- Hat das Vorzeigemodell ausgedient?
- Neue Herausforderungen an das Deutsche Modell
- Veränderte Ansprüche und neue Problematik
- „Transformationsschock“ nach der Wiedervereinigung
- Die Krise des Fordismus und neue technologische Möglichkeiten prägen die Gesellschaft
- Die Globalisierung verändert die Wirtschaft nachhaltig
- Zwischenfazit
- Das Deutsche Modell
- Struktur des Deutschen Modells
- Vorteile des Kollektivvertragssystems
- Vorteile als Nachteile
- Erosion und Anpassung?
- Erosionstendenzen des Deutschen Modells
- Versuch der Anpassung durch Differenzierung, Dezentralisierung und Absenkung
- Mögliche Entwicklungstendenzen – Voraussetzungen und Probleme
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert die Herausforderungen, vor denen das Deutsche Modell der industriellen Beziehungen steht. Sie untersucht die Auswirkungen der Wiedervereinigung, der technologischen Entwicklung und der Globalisierung auf das Kollektivvertragssystem und seine Zukunft.
- Die Auswirkungen der Wiedervereinigung auf das Deutsche Modell
- Die Folgen der technologischen Entwicklung für die Arbeitsbedingungen
- Die Herausforderungen der Globalisierung für die Interessensregulierung zwischen Arbeit und Kapital
- Die Erosionstendenzen des Deutschen Modells
- Mögliche Anpassungsstrategien und zukünftige Entwicklungen
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Hat das Vorzeigemodell ausgedient? Das Kapitel beschreibt den Wandel des Deutschen Modells der industriellen Beziehungen und beleuchtet, wie das „goldene Zeitalter“ der Stabilität und des Wachstums durch globale Veränderungen in Frage gestellt wird. Es werden die neuen Herausforderungen für das Deutsche Modell vorgestellt und die zentralen Problemfelder des Solidaritätsprinzips, der Regulierung von Arbeitsbedingungen und der globalisierten Wirtschaft identifiziert.
- Kapitel 2: Neue Herausforderungen an das Deutsche Modell Dieses Kapitel definiert die drei zentralen Herausforderungen für das Deutsche Modell: die Wiedervereinigung, die technologische Entwicklung und die Globalisierung. Es erläutert die Auswirkungen dieser Themenbereiche auf das Kollektivvertragssystem und die damit verbundenen Problematiken.
- Kapitel 3: Veränderte Ansprüche und neue Problematik Dieses Kapitel untersucht die Auswirkungen des „Transformationsschocks“ nach der Wiedervereinigung auf Ostdeutschland. Es analysiert die Folgen der wirtschaftlichen und sozialen Spaltung Deutschlands und beleuchtet die Rolle der Tarifpolitik in diesem Kontext. Weiterhin werden die Auswirkungen der technologischen Entwicklung auf die Pluralisierung von Arbeits- und Erwerbsformen und die Problematik der Regulierung von Arbeitsmodalitäten in diesem Zusammenhang dargestellt.
- Kapitel 4: Das Deutsche Modell Dieser Teil beschreibt die Struktur und die Vorteile des Deutschen Modells der industriellen Beziehungen. Es erläutert das Funktionieren des Kollektivvertragssystems und hebt seine Stärken in Bezug auf Stabilität, Sicherheit und soziale Gerechtigkeit hervor.
- Kapitel 5: Erosion und Anpassung? Dieses Kapitel befasst sich mit der Erosion des Deutschen Modells und den Versuchen, sich an die neuen Herausforderungen anzupassen. Es analysiert die Tendenzen der Abwanderung von Betrieben aus den Arbeitgeberverbänden und den wachsenden Einfluss der betrieblichen Ebene. Die Folgen für den Flächentarifvertrag in Ostdeutschland und die Übertragung dieser Erosion auf Westdeutschland werden ebenfalls diskutiert.
- Kapitel 6: Mögliche Entwicklungstendenzen – Voraussetzungen und Probleme Dieser Teil befasst sich mit möglichen Entwicklungstendenzen der industriellen Beziehungen in Deutschland und den damit verbundenen Voraussetzungen und Problemen.
Schlüsselwörter
Industrielle Beziehungen, Deutsches Modell, Kollektivvertragssystem, Wiedervereinigung, Transformationsschock, Globalisierung, Technologie, Pluralisierung von Arbeitsformen, Tarifpolitik, Erosion, Anpassung, Entwicklungstendenzen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das „Deutsche Modell“ der industriellen Beziehungen?
Es bezeichnet das System der Tarifautonomie und Mitbestimmung in Deutschland, das lange Zeit für sozialen Frieden, Stabilität und wirtschaftliches Wachstum sorgte.
Warum geriet das Modell nach der Wiedervereinigung unter Druck?
Der „Transformationsschock“ in Ostdeutschland führte zu einer Erosion des Flächentarifvertrags, da viele Betriebe die westdeutschen Standards wirtschaftlich nicht tragen konnten.
Wie beeinflusst die Globalisierung die Tarifpolitik?
In einer globalisierten Wirtschaft stehen nationale Tarifsysteme im Wettbewerb mit Niedriglohnländern, was zu einem Druck auf Löhne und Arbeitsbedingungen führt.
Was versteht man unter der „Erosion“ des Flächentarifvertrags?
Erosion bedeutet, dass immer weniger Unternehmen tarifgebunden sind oder durch Öffnungsklauseln und Dezentralisierung vom Standard-Tarifvertrag abweichen.
Welche Rolle spielt die technologische Entwicklung?
Neue Technologien führen zu einer Pluralisierung der Arbeitsformen (z. B. Homeoffice, Plattformarbeit), die durch klassische Kollektivverträge schwerer zu regulieren sind.
- Quote paper
- Sebastian Wiesnet (Author), 2003, Sozioökonomische Veränderungen - Die industriellen Beziehungen im Wandel, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/15735