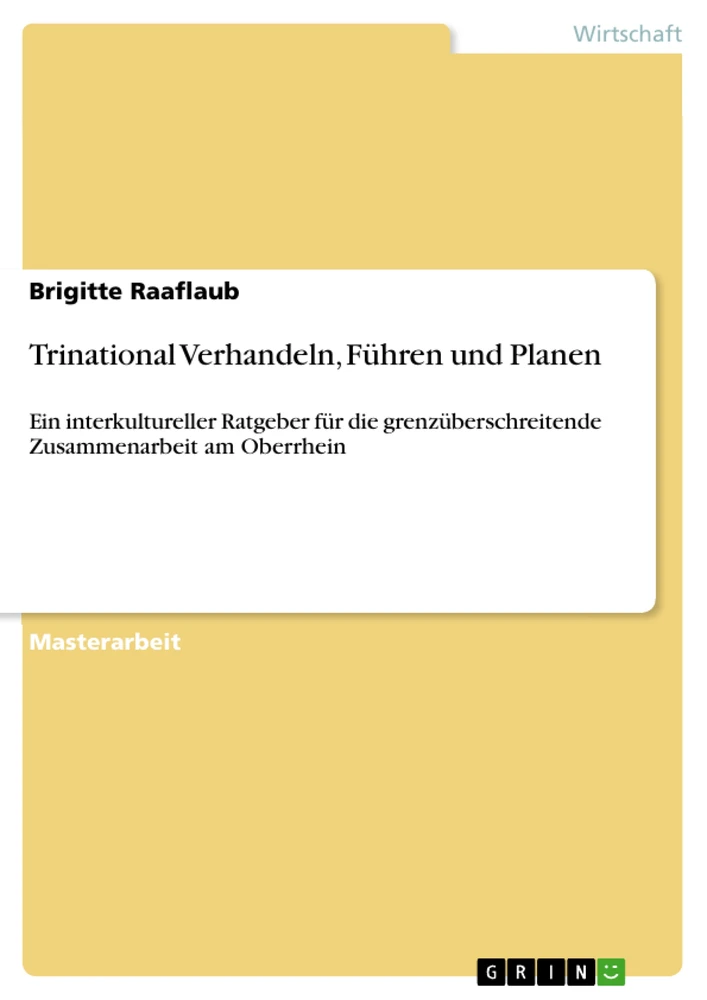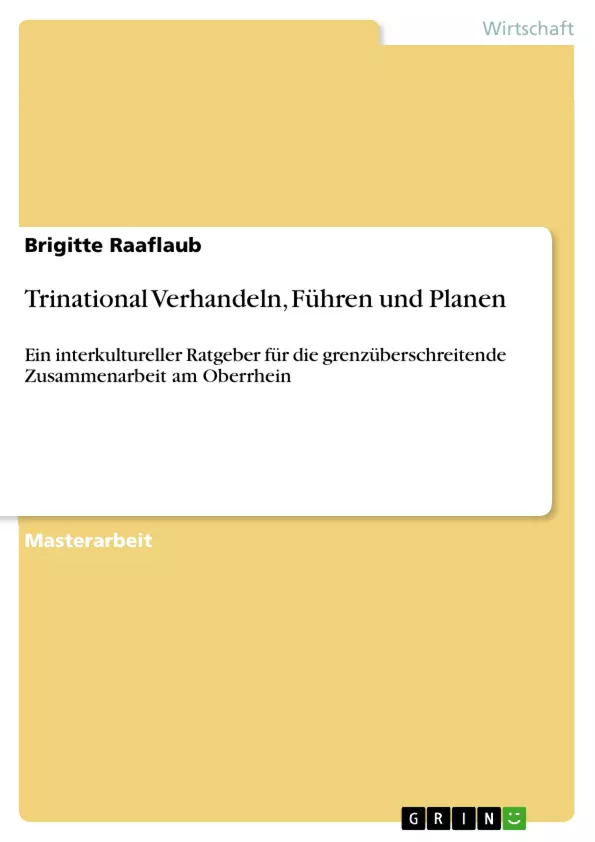Stellen Sie sich folgende Situation vor: Sie sind Schweizer Delegierter der deutsch-französisch-schweizerischen Oberrheinkonferenz und bereiten sich wie immer gründlich auf die erste Sitzung einer neu gegründeten Projektgruppe vor. Ihr Ziel in dieser Sitzung ist es, mit den deutschen und den französischen Partnern die ersten Projektschritte zu definieren. Auf der Einladung des französischen Partners stehen aber bloss der Tagungsort und die Uhrzeit.
Nachdem der französische Partner sich für seine halbstündige Verspätung entschuldigt hat und die Sitzungsteilnehmer nach einem zehnminütigen Monolog zur gegenwärtigen politischen Situation in der EU noch wortreich zum anschliessenden gemeinsamen Mittagessen eingeladen hat, ergreift der deutsche Delegierte das Wort und weist die französische Seite deutlich und mit Nachdruck auf die fehlende Tagungsordnung hin. Der Franzose wird daraufhin ziemlich wortkarg und macht während der Sitzung einen eher abweisenden Eindruck. Die Atmosphäre ist nicht besonders freundschaftlich und die Gespräche stocken. Die Sitzung endet ohne konkrete Resultate und Sie verstehen nicht warum.
Bestimmt kennen Sie diese oder ähnliche Situationen aus eigener Erfahrung im grenzüberschreitenden Arbeitsalltag? Hand aufs Herz: Haben Sie manchmal nicht auch heimlich über die Franzosen, die Deutschen oder die Schweizer gestöhnt und sich gefragt, wo denn der tiefere Sinn dieser Zusammenarbeit liegt?
Trotz der engen, historisch gewachsenen Bande zwischen Deutschland, Frankreich und der Schweiz stolpern wir immer wieder über die teilweise so ganz anderen Arbeitsgewohnheiten, über die Art und Weise der Kommunikation und über den andersartigen Umgang mit Zeit und Regeln.
Die Kenntnis und das Verständnis der Kultur, der unterschiedlichen politischen und administrativen Systeme des eigenen Hintergrunds sowie desjenigen des Nachbarlandes bilden die Grundvoraussetzung für die erfolgreiche grenzüberschreitende Zusammenarbeit.
Inhaltsverzeichnis
- A Trinational Verhandeln, Planen und Führen am Oberrhein
- A.1 Kulturelle Ebenen in der Kooperation am Oberrhein
- A.1.1 Gedanken zum Kulturbegriff
- A.2 Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit am Oberrhein: Was sollte man darüber wissen?
- A.2.1 Wie entstand die Zusammenarbeit am Oberrhein?
- A.2.2 Auf welchen Ebenen findet die Zusammenarbeit statt?
- A.2.3 Von der Vielfalt der Gremien
- A.2.3.1 Die Oberrheinkonferenz: Das zentrale politische Kooperationsgremium
- A.3 Die Vielfalt der Partner: Worauf sollte man besonders achten?
- A.3.1 Begegnungen auf Sitzungsebene
- A.3.2 Verhandeln & Entscheiden mit asymmetrischen Kompetenzen
- A.3.2.1 Die unterschiedlichen Kompetenzverteilungen und ihre Auswirkungen
- A.3.3 Von geschriebenen und ungeschriebenen Regeln
- A.3.4 Sprachunterschiede sind nicht vom Tisch zu reden
- A.4 Die interkulturelle Begegnung am Oberrhein
- A.4.1 Wie entstehen Missverständnisse?
- A.4.1.1 Konzept oder Dossier?
- A.4.1.2 Ist die Verabredung verbindlich?
- A.4.1.3 Ist der Franzose nicht ernsthaft und der Deutsche humorlos?
- A.4.1.4 Von gut gemeinten Redeunterbrechungen zum störenden Akt
- A.4.1.5 Der Schweizer ist kleinkariert und der Franzose hält sich nicht an Zeitpläne
- A.4.2 Interkulturelle Kommunikation: Thema unserer Zeit
- A.4.3 Wie können unterschiedliche kulturelle Orientierungen sichtbar gemacht werden?
- A.4.4 Welche kulturellen Orientierungen prägen die Zusammenarbeit am Oberrhein?
- A.4.4.1 Das Verhältnis zur Hierarchie
- A.4.4.2 Direkter und indirekter Kommunikationsstil
- A.4.4.3 Synchrones und sequentielles Zeitmanagement
- A.4.4.4 Verhandlungs- und Entscheidungsstil
- A.4.4.5 Personenorientiertes oder sachbezogenes Handeln
- A.4.4.6 Zukunfts- und Leistungsorientierung
- A.4.5 Gefahr & Nutzen von Kulturkategorisierungen: Achtung neue Vorurteile!
- A.5 Die trinationale Sitzung aus kultureller Perspektive
- A.5.1 Kommunikation ist mehr als nur Sprechen
- A.5.1.1 Die Eröffnungsphase
- A.5.1.2 Die Verhandlung und die Entscheidungsfindung
- A.5.1.3 Verbindlichkeit von Entscheidungen
- A.5.2 Tipps für Verhandlungen mit Deutschen, Schweizern und Franzosen
- A.5.3 Was sollte ein Vorsitzender mitbringen?
- A.5.3.1 Sprachunterschiede explizit machen!
- A.5.3.2 Wie erkenne ich einen interkulturellen Konflikt?
- A.5.3.3 Metakommunikativen Moderationsstil entwickeln
- A.5.3.4 Fallbeispiel: „Unterschiedliche Ansichten über die Organisation einer Tagung“
- A.6 Das grenzüberschreitende Projekt aus kultureller Perspektive
- A.6.1 Herausforderungen in der Zusammenarbeit trinationaler Teams
- A.6.2 Wie plane ich ein grenzüberschreitendes Projekt?
- A.6.3 Wie finde ich geeignete Projektpartner?
- A.6.4 Wie vermeide ich Fehler durch unklare Zielvorstellungen?
- A.6.5 Was sollte ich über meine Projektpartner wissen?
- A.6.6 Wie entwickle ich ein interkulturelles Team?
- A.6.6.1 Welche kulturellen Stilunterschiede beeinflussen ein trinationales Team?
- A.6.6.2 Praktische Hinweise für die Entwicklung trinationaler Teams
- A.6.7 Wie führe ich ein interkulturelles Team?
- A.6.7.1 Praktische Führungsempfehlungen für trinationale Teams
- A.7 Vom interkulturellen Verstehen zum transkulturellen Handeln
- A.7.1 Entwickeln Sie Ihre transkulturelle Kompetenz
- A.7.2 Das zweite Protokoll“: Von Empathie und Perspektivenwechsel
- Kulturelle Dimensionen der trinationalen Zusammenarbeit am Oberrhein
- Herausforderungen und Chancen der interkulturellen Kommunikation
- Praktische Tipps für erfolgreiche Verhandlungen und Projektmanagement in trinationalen Teams
- Entwicklung der transkulturellen Kompetenz
- Sichtbarmachung von kulturellen Orientierungen und Prägungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit befasst sich mit der trinationalen Zusammenarbeit am Oberrhein und will einen interkulturellen Ratgeber für erfolgreiche Verhandlungen, Planung und Führung in grenzüberschreitenden Projekten liefern.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Masterarbeit beleuchtet die Herausforderungen und Chancen der trinationalen Zusammenarbeit am Oberrhein. Im ersten Kapitel werden die kulturellen Ebenen der Zusammenarbeit vorgestellt, während das zweite Kapitel einen Überblick über die historische Entstehung und die verschiedenen Ebenen der Zusammenarbeit bietet. Das dritte Kapitel behandelt die Vielfalt der Partner und fokussiert auf die unterschiedlichen Kompetenzen und Regeln, die in der Zusammenarbeit eine Rolle spielen. Kapitel vier beschäftigt sich mit interkulturellen Begegnungen und Missverständnissen, wobei die kulturellen Orientierungen der Partner am Oberrhein im Vordergrund stehen. Das fünfte Kapitel betrachtet die trinationale Sitzung aus kultureller Perspektive und gibt praktische Tipps für Verhandlungen und Moderation. Das sechste Kapitel befasst sich mit grenzüberschreitenden Projekten und deren Herausforderungen, insbesondere mit der Bildung und Führung interkultureller Teams. Abschließend werden Möglichkeiten aufgezeigt, die transkulturelle Kompetenz zu entwickeln und das "zweite Protokoll" als Werkzeug für Empathie und Perspektivenwechsel vorgestellt.
Schlüsselwörter
Trinational, Oberrhein, Zusammenarbeit, Interkulturelle Kommunikation, Verhandeln, Planen, Führen, Kulturelle Orientierungen, Projektmanagement, Transkulturelle Kompetenz, Missverständnisse, Grenzüberschreitende Zusammenarbeit, Kulturelle Prägungen, Differenzen, Perspektivenwechsel
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptziel dieser Masterarbeit zur trinationalen Zusammenarbeit?
Das Ziel ist es, einen interkulturellen Ratgeber für erfolgreiches Verhandeln, Planen und Führen in grenzüberschreitenden Projekten am Oberrhein (Deutschland, Frankreich, Schweiz) zu liefern.
Warum kommt es in der Zusammenarbeit am Oberrhein oft zu Missverständnissen?
Missverständnisse entstehen meist durch unterschiedliche Arbeitsgewohnheiten, Kommunikationsstile sowie einen differenzierten Umgang mit Zeit, Regeln und Hierarchien in den drei Ländern.
Welche Rolle spielt die Oberrheinkonferenz?
Die Oberrheinkonferenz ist das zentrale politische Kooperationsgremium für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Deutschland, Frankreich und der Schweiz in dieser Region.
Was versteht man unter transkultureller Kompetenz?
Es handelt sich um die Fähigkeit, über das bloße Verständnis kultureller Unterschiede hinaus gemeinsam neue, länderübergreifende Handlungsweisen zu entwickeln und Empathie durch Perspektivenwechsel zu zeigen.
Welche kulturellen Unterschiede beeinflussen die Zeitplanung?
Die Arbeit unterscheidet zwischen synchronem und sequentiellem Zeitmanagement, was sich beispielsweise in der Pünktlichkeit oder der Flexibilität von Tagesordnungen äußert.
Was ist das "zweite Protokoll" in der Projektarbeit?
Das "zweite Protokoll" dient als Werkzeug für Empathie und den bewussten Perspektivenwechsel, um die Beweggründe der Partner besser nachvollziehen zu können.
- Arbeit zitieren
- Brigitte Raaflaub (Autor:in), 2010, Trinational Verhandeln, Führen und Planen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/157356