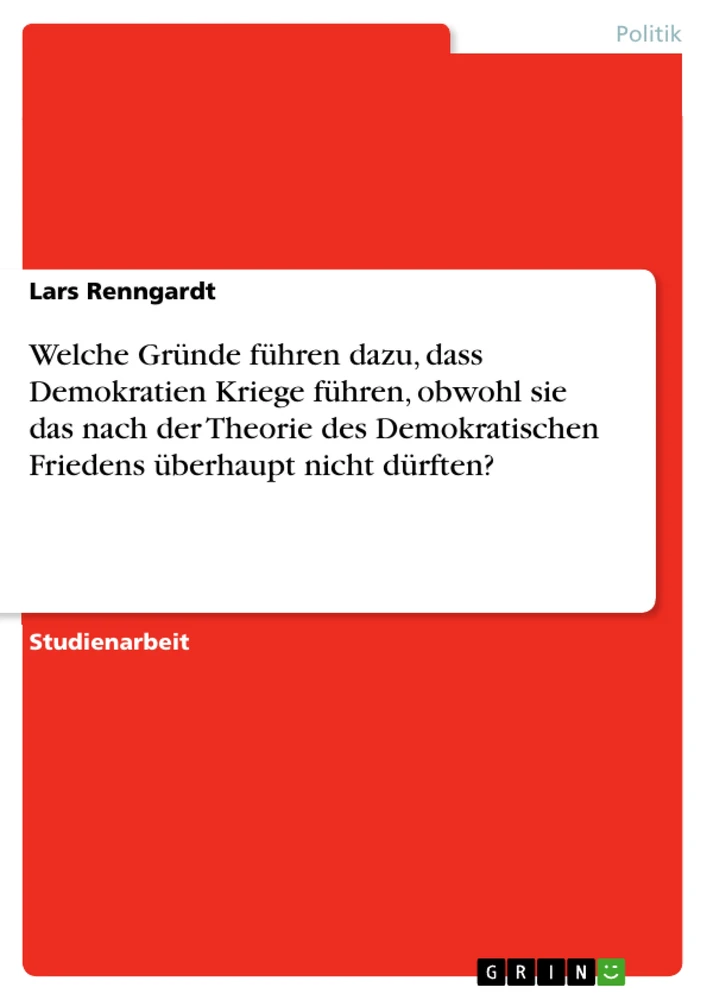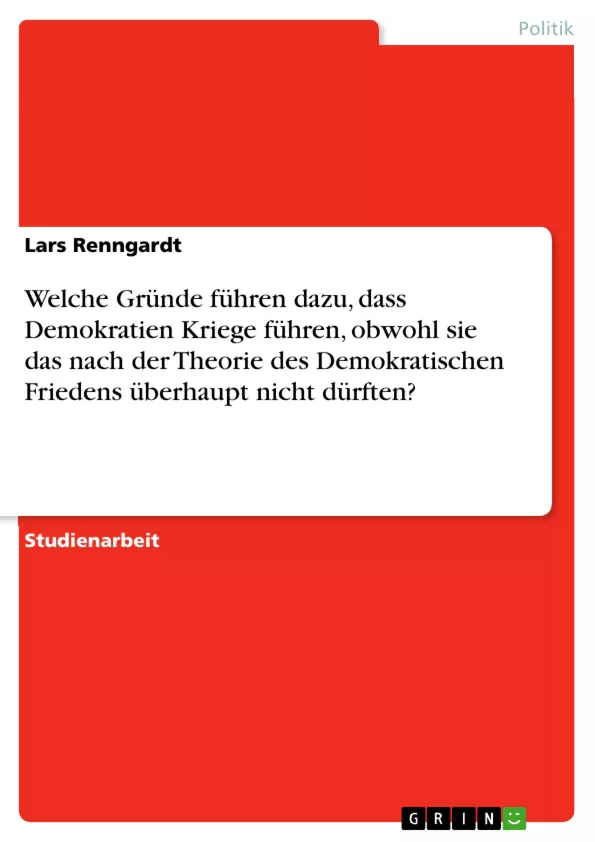„Kaum eine politikwissenschaftliche These hat in den vergangenen Jahren solche
fachinterne und öffentliche Aufmerksamkeit erregt wie die vom „Demokratischen
Frieden“ (…), kaum eine hat derart engagierte Debatten ausgelöst, kaum eine hat
eine vergleichbar große Zahl an empirischen und theoretischen Arbeiten
hervorgebracht.“ „Die Erforschung des Zusammenhangs zwischen Herrschaftsform
eines Staates und dessen Friedfertigkeit beschäftigt die Politikwissenschaft schon
seit langer Zeit. Die Vorreiter, die sich bereits schon vor mehreren Jahrhunderten mit
diesem Problem auseinander setzten, waren Jean Jaques Rousseau und der Abbe
de St. Pierre. Aber einer der bekanntesten und auch berühmtesten war wohl
Immanuel Kant, der in seiner Schrift „Zum ewigen Frieden“ versuchte, den
zwischenstaatlichen Frieden und die Friedfertigkeit von Demokratien zu erforschen
und zu analysieren.“ Gleichzeitig war es unter anderem auch Immanuel Kant, der
auf diese Art und Weise erste Grundlagen für die Theorie des „Demokratischen
Friedens“ erarbeitete. So soll zu Beginn dieser Hausarbeit auch ein kurzer Einblick in
das Werk Immanuel Kants, „Zum ewigen Frieden“, gegeben werden. Ziel soll es sein,
die wichtigsten Aussagen hervorzuheben. Im Anschluss wird der Begriff des
„Demokratischen Friedens“ untersucht. „Das „Theorem des demokratischen
Friedens“ kommt in zwei Varianten vor“, es soll aufgezeigt werden, was dies
bedeutet und anschließend näher erläutert werden. Im Anschluss hieran, nachdem
die Theorie des „Demokratischen Friedens“ dargestellt wurde und auch ihre
geschichtlichen Hintergründe erläutert wurden, soll geklärt werden, was denn die
Gründe für eine „Unfriedlichkeit“ der Demokratien sind, obwohl Demokratien nach
der Theorie des „Demokratischen Friedens“ dies überhaupt nicht sein dürften. Den
Beginn machen werden die drei „klassischen Erklärungsansätze“, der „Normativ-
Kulturelle Erklärungsansatz“, der „Utilitaristische Erklärungsansatz“ und der
„Institutionalistisch- strukturelle Erklärungsansatz“. Anschließend wird das Konzept
Fukuyamas, „der neue Westen als Wertegemeinschaft“ vorgestellt. Im Anschluss
daran kommt es zu einer abschließenden Betrachtung unter Prof. Dr. Ernst Otto
Czempiel. Der Schluss dieser Hausarbeit soll einer kurzen Zusammenfassung der hier gewonnenen Ergebnisse dienen, darüber hinaus soll er aber auch Raum für
einen Ausblick bereit halten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kurze Einführung in das Werk „Zum ewigen Frieden“ von Immanuel Kant
- Definition und Eingrenzung des Begriffes des „Demokratischen Friedens“
- Gründe, die dazu führen, dass Demokratische Staaten trotz des Befundes des „Demokratischen Friedens“ Kriege führen
- „Normativ - Kulturelle Erklärung“
- „Utilitaristische Erklärung“
- „Institutionalistisch – strukturelle Erklärung“
- Fukuyama und der „neue Westen als Wertegemeinschaft“
- Abschließende Betrachtungen unter Prof. Dr. Ernst Otto Czempiel
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit der Frage, warum Demokratien trotz der Theorie des „Demokratischen Friedens“ Krieg führen. Im Zentrum steht die Analyse der Gründe, die zu einer „Unfriedlichkeit“ der Demokratien führen können, obwohl diese nach der Theorie eigentlich friedfertiger sein sollten.
- Der „Demokratische Frieden“ und seine historischen Wurzeln
- Die wichtigsten Aussagen Immanuel Kants im Werk „Zum ewigen Frieden“
- Kulturelle, utilitaristische und institutionelle Erklärungen für Kriegführung von Demokratien
- Das Konzept Fukuyama's „der neue Westen als Wertegemeinschaft“
- Die Rolle der öffentlichen Meinung und der Kosten des Krieges in demokratischen Gesellschaften
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz des „Demokratischen Friedens“ für die Politikwissenschaft dar und skizziert den Aufbau der Hausarbeit. Das zweite Kapitel bietet eine Einführung in Immanuel Kants Werk „Zum ewigen Frieden“, indem es die wichtigsten Aussagen und Argumentationslinien beleuchtet. Im dritten Kapitel wird der Begriff des „Demokratischen Friedens“ definiert und seine verschiedenen Ausprägungen erläutert. Das vierte Kapitel untersucht die Gründe, die zur Kriegführung von Demokratien führen können, wobei drei „klassische Erklärungsansätze“ sowie das Konzept Fukuyama's vorgestellt werden.
Schlüsselwörter
Demokratischer Frieden, Immanuel Kant, „Zum ewigen Frieden“, Krieg, Frieden, Normativ-Kulturelle Erklärung, Utilitaristische Erklärung, Institutionalistisch-Strukturelle Erklärung, Fukuyama, Wertegemeinschaft, Öffentlichkeit, Kosten des Krieges
Häufig gestellte Fragen
Was besagt die Theorie des „Demokratischen Friedens“?
Die Theorie besagt, dass Demokratien untereinander fast nie Kriege führen. Dies wird oft auf geteilte Normen, institutionelle Kontrollen und die Kostenvermeidung durch die Bevölkerung zurückgeführt.
Warum führen Demokratien trotzdem Kriege?
Gründe können die Verteidigung von Werten gegenüber Nicht-Demokratien, utilitaristische Interessen oder institutionelle Strukturen sein, die unter bestimmten Bedingungen eine Kriegführung ermöglichen.
Welche Rolle spielt Immanuel Kant für diese Theorie?
Kant legte in seiner Schrift „Zum ewigen Frieden“ die philosophischen Grundlagen, indem er argumentierte, dass eine republikanische Verfassung die Bürger direkt an der Entscheidung über Krieg und Frieden beteiligt, was diese vorsichtiger mache.
Was ist der „Normativ-Kulturelle Erklärungsansatz“?
Dieser Ansatz geht davon aus, dass Demokratien Konflikte intern durch Kompromisse und Rechtsstaatlichkeit lösen und diese friedlichen Normen auch auf die Außenpolitik übertragen.
Was versteht Fukuyama unter dem „neuen Westen als Wertegemeinschaft“?
Fukuyama argumentiert, dass liberale Demokratien eine stabile Zone des Friedens bilden, da sie ein ähnliches Verständnis von Legitimität und Menschenrechten teilen.
- Citar trabajo
- Lars Renngardt (Autor), 2010, Welche Gründe führen dazu, dass Demokratien Kriege führen, obwohl sie das nach der Theorie des Demokratischen Friedens überhaupt nicht dürften?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/157363