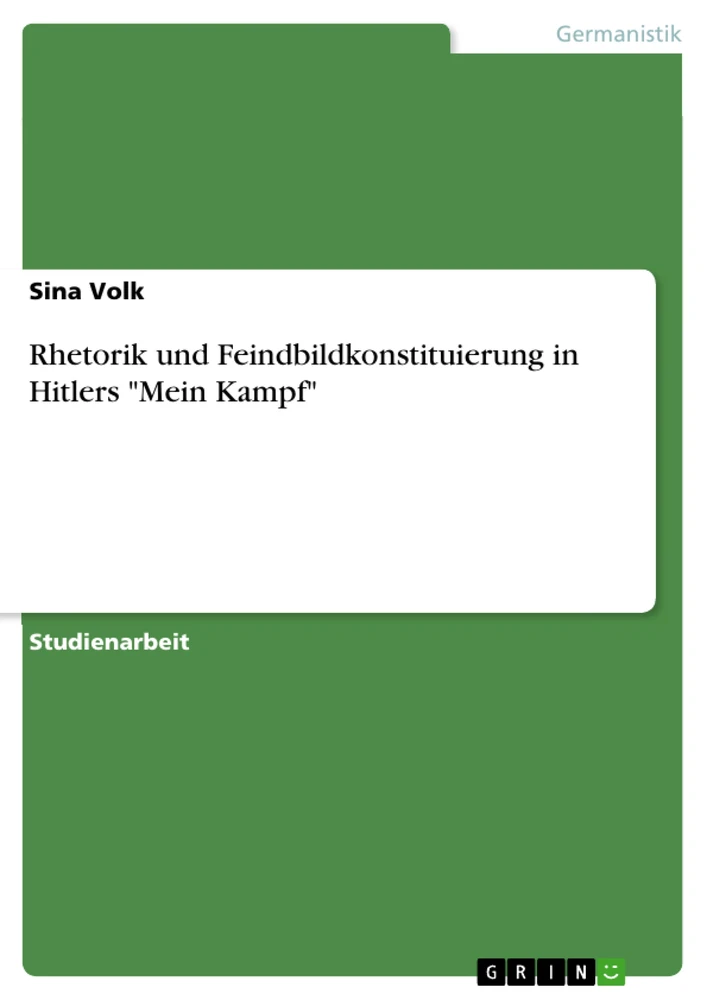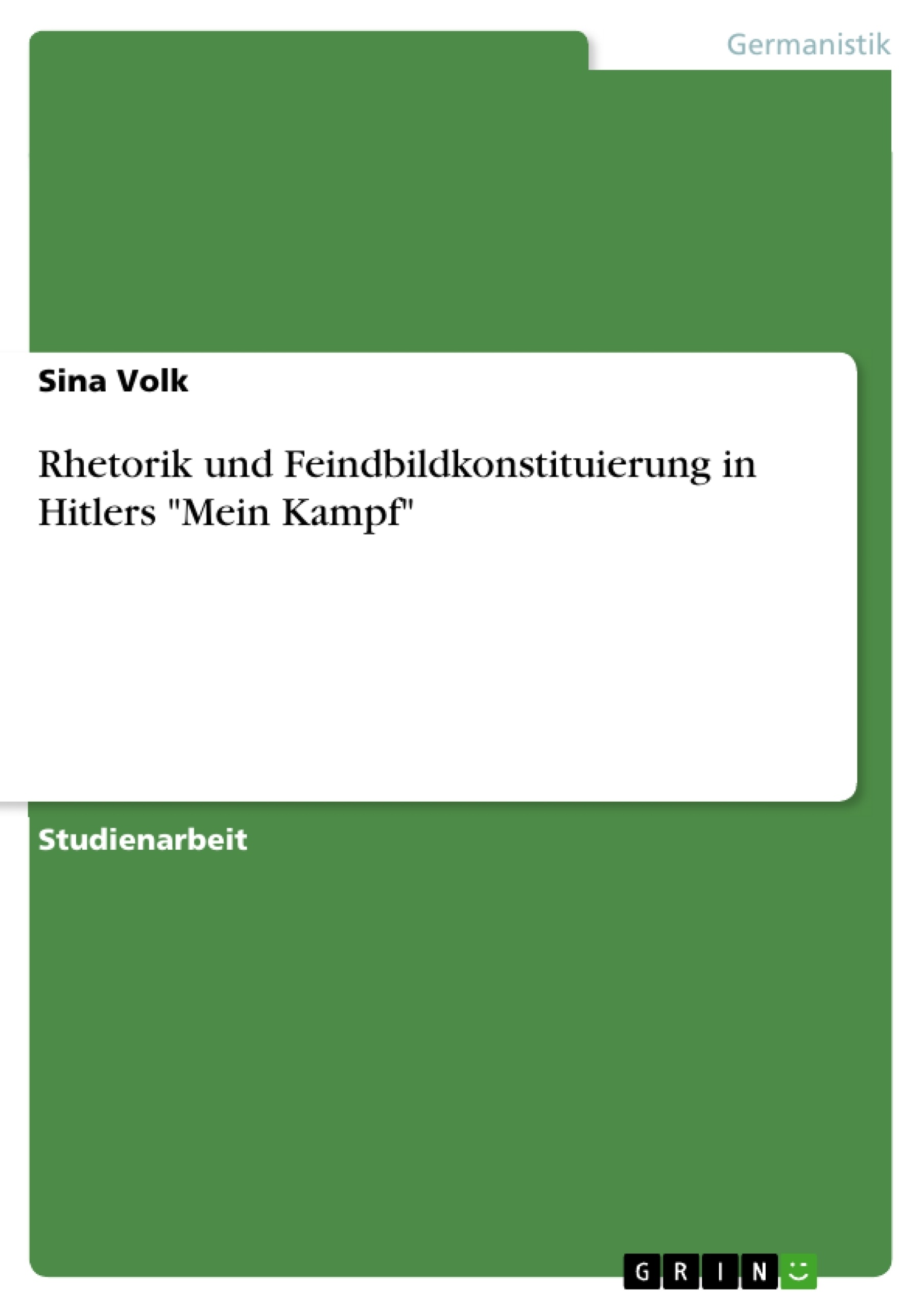I. Einleitung
„Ich weiß, daß man Menschen weniger durch das geschriebene Wort als vielmehr durch das gesprochene zu gewinnen vermag, daß jede große Bewegung auf dieser Erde ihr Wachsen den großen Rednern und nicht den großen Schreibern verdankt. Dennoch muß zur gleichmäßigen und einheitlichen Vertretung einer Lehre das Grundsätzliche derselben niedergelegt werden für immer.“
(Adolf Hitler: „Mein Kampf“, Vorwort)
Der Mythos um die Person Adolf Hitler und sein Werk „Mein Kampf“ (1925/1926 erstmals veröffentlicht) ist eines der meistdiskutierten Themen der jüngeren Vergangenheit. Ein besonderes Augenmerk wurde häufig auf die von Hitler verwendete Sprache gelegt, sowohl in seinem Hauptwerk als auch in seinen öffentlichen Reden. „Mein Kampf“ stellt laut Dr. Roland Aegerter (2005) eine „Mischung aus Biographie, Weltanschauung, politischem Bekenntnis und Agitationslehre“ dar.
Wie Hitler selbst im Vorwort zu „Mein Kampf“ schreibt, misst er dem gesprochenen Wort wesentlich mehr Bedeutung bei als dem geschriebenen. Seine Popularität verdankte Hitler hauptsächlich seinen Reden; den Grundstein für seine politischen Ziele und seine ideologischen Vorstellungen verfasste er jedoch schriftlich in Form seines Hauptwerkes „Mein Kampf“. Aus diesem Grund bedarf es einer ebenso gründlichen Analyse der verschriftlichten „Abrechnung“ Hitlers, wie sie auch an anderer Stelle seinen Reden zuteil wird. Ersteres soll Gegenstand dieser Arbeit sein.
In der folgenden Abhandlung werde ich daher zunächst auf allgemeine Merkmale der Schriftsprache Hitlers in „Mein Kampf“ eingehen und dann am Beispiel der Wortwahl bezüglich der Juden das Aufbauen beziehungsweise Festigen eines Feindbildes untersuchen. Hiernach werde ich ausführen, welche Bedeutung Hitler laut „Mein Kampf“ der Rhetorik beimaß und schlussendlich kurz beschreiben, inwiefern dies Einfluss auf seine tatsächlichen Reden hatte.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Sprache in „Mein Kampf“
- II.1. Allgemeine Merkmale der Semantik in „Mein Kampf“
- II.2. Sprachliche Konstituierung eines Feindbildes am Beispiel der Juden
- III. Die Bedeutung der Rhetorik für Adolf Hitler
- III.1. Rhetorik in „Mein Kampf“ - eine Art Anleitung?
- III.2. Reale Umsetzung in der öffentlichen Rede (Ausblick)
- IV. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Sprache in Hitlers „Mein Kampf“, mit dem Fokus auf die Konstruktion von Feindbildern und die Rolle der Rhetorik. Die Arbeit analysiert die sprachlichen Mittel, die Hitler zur Verbreitung seiner Ideologie einsetzt.
- Analyse der allgemeinen Merkmale der Sprache in „Mein Kampf“ (z.B. Stilmittel, Wortwahl).
- Untersuchung der sprachlichen Konstruktion des Feindbildes „Jude“.
- Bedeutung der Rhetorik in „Mein Kampf“ als Anleitung zur politischen Propaganda.
- Zusammenhang zwischen der in „Mein Kampf“ beschriebenen Rhetorik und Hitlers öffentlichen Reden.
- Aufzeigen der Wirkung der Sprache Hitlers auf den Leser/Hörer.
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung stellt Hitlers Werk „Mein Kampf“ und dessen Bedeutung vor. Sie hebt die besondere Rolle der Sprache sowohl im Buch als auch in Hitlers öffentlichen Reden hervor und skizziert den Aufbau der Arbeit. Der Fokus liegt auf der Analyse der Schriftsprache in „Mein Kampf“ und der Konstruktion von Feindbildern, insbesondere im Bezug auf die Juden. Die Bedeutung der Rhetorik und deren Einfluss auf Hitlers Reden wird ebenfalls angesprochen. Die Einleitung betont die Notwendigkeit einer gründlichen Analyse der schriftlichen Ausführungen Hitlers, um seine politischen Ziele und ideologischen Vorstellungen zu verstehen.
II. Sprache in „Mein Kampf“: Dieses Kapitel untersucht die sprachlichen Merkmale von Hitlers „Mein Kampf“. Es beschreibt die Sprache als „schwülstig“, „konstruiert“ und „pathetisch“, charakterisiert durch häufige Superlative und ein aggressives Vokabular. Die Analyse beleuchtet den Gebrauch von Hyperbeln zur Emotionalisierung des Lesers und den Bedeutungsverlust der Begriffe durch Übertreibung. Die aggressive Wortwahl, die Verwendung des Morphems „Kampf“, und drastische Begriffe zur Schaffung einer gewalttätigen Atmosphäre werden ebenso analysiert. Der Gebrauch von Tautologien, Akkumulationen und Wiederholungen zur Vereinfachung komplexer Sachverhalte für ein vermeintlich „primitives“ Publikum wird ebenfalls untersucht. Die „wir-Form“ und rhetorische Fragen dienen der Identifikation des Lesers mit Hitler und seiner Bewegung. Die Verwendung religiöser Begriffe und Euphemismen zur Rechtfertigung und Beschönigung von Gewalt wird ebenfalls thematisiert.
Schlüsselwörter
Mein Kampf, Adolf Hitler, Sprache, Rhetorik, Feindbild, Juden, Nationalsozialismus, Propaganda, Semantik, Stilmittel, Superlative, Aggressivität, Hyperbeln, Volk, Gewalt, Euphemismen.
Häufig gestellte Fragen zu „Mein Kampf“: Sprachliche Analyse
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit analysiert die Sprache in Adolf Hitlers „Mein Kampf“, konzentriert sich auf die Konstruktion von Feindbildern, insbesondere gegenüber Juden, und untersucht die Rolle der Rhetorik in der Verbreitung der nationalsozialistischen Ideologie. Die Arbeit beleuchtet die sprachlichen Mittel, die Hitler zur Manipulation und Mobilisierung seiner Anhänger einsetzte.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit untersucht die allgemeinen Merkmale der Sprache in „Mein Kampf“ (Stilmittel, Wortwahl), die sprachliche Konstruktion des Feindbildes „Jude“, die Bedeutung der Rhetorik als propagandistische Anleitung, den Zusammenhang zwischen der in „Mein Kampf“ beschriebenen Rhetorik und Hitlers öffentlichen Reden und die Wirkung der Sprache auf Leser und Hörer.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit besteht aus einer Einleitung, einem Kapitel zur Sprache in „Mein Kampf“, einem Kapitel zur Bedeutung der Rhetorik für Hitler und einem Fazit. Die Einleitung führt in die Thematik ein und skizziert den Aufbau der Arbeit. Kapitel II analysiert detailliert die sprachlichen Mittel in „Mein Kampf“, wie z.B. schwülstigen Stil, aggressive Wortwahl, Hyperbeln und rhetorische Figuren. Kapitel III beleuchtet die Rolle der Rhetorik als Anleitung zur politischen Propaganda und deren Umsetzung in Hitlers öffentlichen Reden. Das Fazit fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche sprachlichen Mittel werden in „Mein Kampf“ eingesetzt und wie wirken sie?
Hitler verwendet in „Mein Kampf“ zahlreiche sprachliche Mittel, um seine Botschaft zu vermitteln und seine Ziele zu erreichen. Dazu gehören Superlative, ein aggressives Vokabular, Hyperbeln zur Emotionalisierung des Lesers, Tautologien, Akkumulationen und Wiederholungen zur Vereinfachung komplexer Sachverhalte, die „wir-Form“ zur Identifikation des Lesers mit Hitler und seiner Bewegung, sowie religiöse Begriffe und Euphemismen zur Rechtfertigung von Gewalt. Die Wirkung dieser Mittel besteht in der Manipulation des Lesers/Hörers, der Emotionalisierung und Vereinfachung komplexer Zusammenhänge.
Wie konstruiert Hitler das Feindbild „Jude“ sprachlich?
Die Arbeit untersucht, wie Hitler sprachlich das Feindbild „Jude“ konstruiert, indem er spezifische sprachliche Mittel einsetzt, um Juden zu dämonisieren und zu entmenschlichen. Diese Analyse beleuchtet die Rolle der Sprache bei der Verbreitung von antisemitischen Vorurteilen und Hasspropaganda.
Welche Rolle spielt die Rhetorik in „Mein Kampf“ und in Hitlers Reden?
„Mein Kampf“ kann als eine Art Anleitung zur politischen Propaganda verstanden werden. Die Arbeit analysiert die in „Mein Kampf“ beschriebenen rhetorischen Strategien und deren Umsetzung in Hitlers öffentlichen Reden. Der Fokus liegt auf dem Zusammenhang zwischen der schriftlichen und mündlichen Rhetorik Hitlers und deren Wirkung auf sein Publikum.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Mein Kampf, Adolf Hitler, Sprache, Rhetorik, Feindbild, Juden, Nationalsozialismus, Propaganda, Semantik, Stilmittel, Superlative, Aggressivität, Hyperbeln, Volk, Gewalt, Euphemismen.
- Citation du texte
- Sina Volk (Auteur), 2010, Rhetorik und Feindbildkonstituierung in Hitlers "Mein Kampf", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/157367