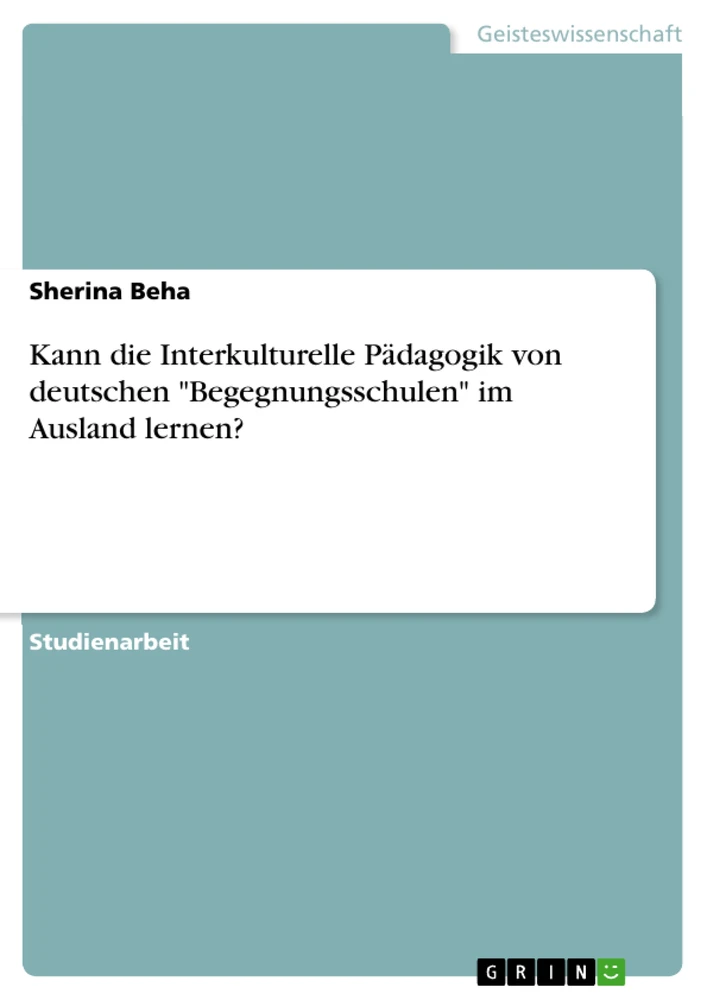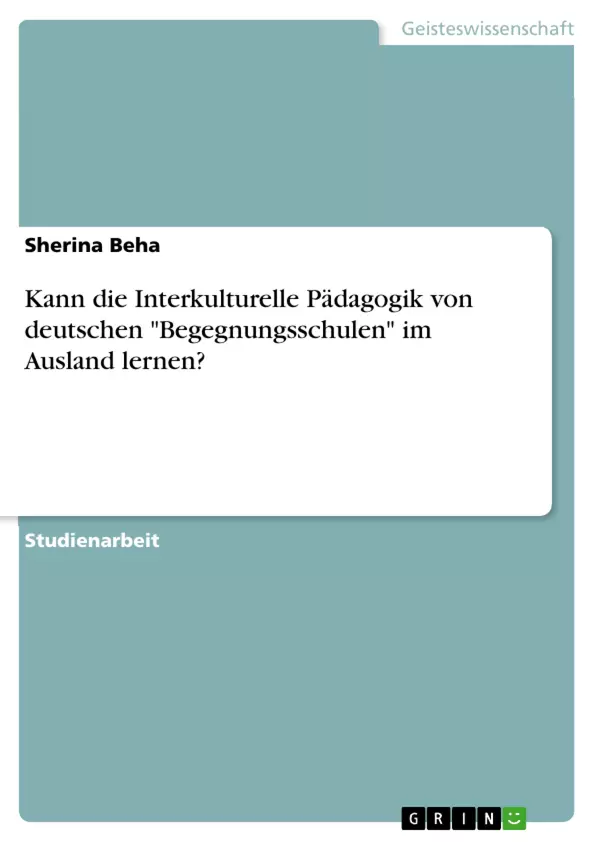In vorliegender Arbeit möchte ich zwischen dem Diskurs um die Interkulturelle Pädagogik und den Zielsetzungen des Deutschen Auslandsschulwesens einen Zusammenhang herstellen. Ausgangspunkt ist die zentrale Fragestellung: Kann die Interkulturelle Pädagogik von der “Begegnung” an Deutschen Auslandsschulen lernen? Beide Konzepte teilen einige grundlegende Gemeinsamkeiten, insbesondere in ihrem Anspruch, kulturelle Vielfalt zu berücksichtigen, kulturelle Differenzen zu überbrücken und interkulturelles Verständnis zu fördern. Idealerweise geschieht dies durch einen wertschätzenden Austausch auf Augenhöhe, so möchte man zumindest meinen. Die ersten beiden Kapitel dieser Arbeit befassen sich mit der Entwicklung und Kritik der Interkulturellen Pädagogik sowie einer grundlegenden Einführung in das Deutsche Auslandsschulwesen. Während die Interkulturelle Pädagogik Bildungsprozesse in heterogenen Kontexten gestalten will, setzen Deutsche Auslandsschulen auf interkulturellen Austausch durch die “Begegnung” von SchülerInnen unterschiedlicher (kultureller) Herkunft. Während die Interkulturelle Pädagogik eine zunehmend wichtige Rolle im Diskurs über die Ausgestaltung von Bildungssystemen in Einwanderungsgesellschaften spielt, fokussiert das Deutsche Auslandsschulwesen auf die Verbreitung deutscher Bildungsstandards weltweit und ist damit Teil der sogenannten auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik Deutschlands. Im dritten Kapitel werden diese Annahmen kritisch reflektiert. Es wird dabei aufgezeigt, dass sowohl die Interkulturelle Pädagogik mit ihrem geschichtlichen Kontext auf die durch Migration entstandenen Herausforderungen im deutschen Bildungswesen, ähnlich wie das Deutsche Auslandsschulwesen bei ihren Zielsetzungen von Partnerschaft, Austausch und Dialog bis heute eher die Note unbefriedigend erhalten würden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung und thematischer Kontext
- 1.1 Geschichte der Interkulturellen Pädagogik
- 1.2 Kritik an der Interkulturellen Pädagogik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen interkultureller Pädagogik und den Zielen deutscher Auslandsschulen. Die zentrale Frage lautet: Kann die interkulturelle Pädagogik von den Begegnungsschulen im Ausland lernen? Die Arbeit analysiert Gemeinsamkeiten und Unterschiede beider Konzepte und reflektiert deren Wirksamkeit.
- Entwicklung und Kritik der Interkulturellen Pädagogik
- Das Deutsche Auslandsschulwesen und seine Zielsetzungen
- Kritischer Vergleich beider Konzepte
- Herausforderungen interkultureller Bildung
- Potenziale des Austauschs zwischen Interkultureller Pädagogik und Auslandsschulen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung und thematischer Kontext: Diese Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem Lernpotenzial der Interkulturellen Pädagogik aus dem Kontext deutscher Auslandsschulen vor. Sie vergleicht die grundlegenden Gemeinsamkeiten beider Konzepte, nämlich die Berücksichtigung kultureller Vielfalt und die Förderung interkulturellen Verständnisses. Gleichzeitig werden die Unterschiede in ihren jeweiligen Kontexten und Zielsetzungen hervorgehoben: Interkulturelle Pädagogik im Kontext von Einwanderungsgesellschaften und deutsche Auslandsschulen im Kontext der internationalen Verbreitung deutscher Bildungsstandards. Die Einleitung deutet bereits an, dass beide Konzepte in ihren Ansprüchen an Partnerschaft, Austausch und Dialog bisher nicht vollständig erfolgreich waren.
1.1 Geschichte der Interkulturellen Pädagogik: Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehung der Interkulturellen Pädagogik im deutschsprachigen Raum ab den 1960er Jahren, im Kontext der internationalen Migration und der „Gastarbeiter“. Es analysiert die historische Entwicklung, beginnend mit der Behandlung autochthener Minderheiten im Kaiserreich und der Weimarer Republik, die eine homogenisierende Schulpolitik verfolgten und Minderheitensprachen unterdrückten. Das Kapitel beschreibt die Herausforderungen, die mit der zunehmenden Anzahl von Kindern aus „Gastarbeiterfamilien“ in den deutschen Schulen auftraten, und die späte Entstehung der Interkulturellen Pädagogik als Reaktion auf diese Herausforderungen. Es wird die Entwicklung von Vorbereitungsklassen und die zögerliche Integration der Interkulturellen Pädagogik in die Bildungspolitik bis 1996 dargestellt. Das Kapitel zeigt, dass die Anfänge der Interkulturellen Pädagogik eng mit der Geschichte der Migrationspolitik in Deutschland verbunden sind und dass sie sich in einem interdisziplinären Kontext entwickelt hat.
1.2 Kritik an der Interkulturellen Pädagogik: Dieses Kapitel behandelt die Kritik an der Interkulturellen Pädagogik. Es zeigt die Schwierigkeiten auf, den Diskurs um die Interkulturelle Pädagogik in einen einheitlichen theoretischen Begriff zu fassen, und präsentiert verschiedene Konzepte der Interkulturellen Pädagogik, insbesondere die „Ausländerpädagogik“ und die „Antidiskriminierungspädagogik“. Das Kapitel analysiert die Defizithypothese der „Ausländerpädagogik“, die Migranten und deren Nachkommen als Mängelwesen mit Korrekturbedarf darstellte. Es wird die Kritik an dieser Bezeichnung und die Entwicklung hin zur Interkulturellen Pädagogik als umfassenderer Ansatz diskutiert. Der Fokus liegt auf der Kritik an der Tendenz, kulturelle Unterschiede zu bewahren und die damit verbundenen Fremdheitszuschreibungen.
Schlüsselwörter
Interkulturelle Pädagogik, Deutsche Auslandsschulen, Begegnungsschulen, Kulturelle Vielfalt, Interkulturelles Verständnis, Migration, Bildungspolitik, Integration, Kritik, Defizithypothese.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema dieses Textes?
Dieser Text behandelt die Interkulturelle Pädagogik und ihre Beziehung zu den Zielen deutscher Auslandsschulen. Die zentrale Frage ist, ob die interkulturelle Pädagogik von den Begegnungsschulen im Ausland lernen kann.
Welche Hauptthemen werden in diesem Text behandelt?
Die Hauptthemen sind: die Entwicklung und Kritik der Interkulturellen Pädagogik, das Deutsche Auslandsschulwesen und seine Zielsetzungen, ein kritischer Vergleich beider Konzepte, die Herausforderungen interkultureller Bildung und die Potenziale des Austauschs zwischen Interkultureller Pädagogik und Auslandsschulen.
Was sind die wichtigsten Kritikpunkte an der Interkulturellen Pädagogik, die in diesem Text erwähnt werden?
Der Text behandelt die Schwierigkeiten, den Diskurs um die Interkulturelle Pädagogik in einen einheitlichen theoretischen Begriff zu fassen. Er analysiert die Defizithypothese der "Ausländerpädagogik" und kritisiert die Tendenz, kulturelle Unterschiede zu bewahren und die damit verbundenen Fremdheitszuschreibungen.
Was sind die Schlüsselwörter dieses Textes?
Die Schlüsselwörter sind: Interkulturelle Pädagogik, Deutsche Auslandsschulen, Begegnungsschulen, Kulturelle Vielfalt, Interkulturelles Verständnis, Migration, Bildungspolitik, Integration, Kritik, Defizithypothese.
Was wird im Kapitel "Geschichte der Interkulturellen Pädagogik" behandelt?
Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehung der Interkulturellen Pädagogik im deutschsprachigen Raum ab den 1960er Jahren, im Kontext der internationalen Migration und der „Gastarbeiter“. Es analysiert die historische Entwicklung von der homogenisierenden Schulpolitik im Kaiserreich und der Weimarer Republik bis zur späten Entstehung der Interkulturellen Pädagogik als Reaktion auf die Herausforderungen durch Kinder aus "Gastarbeiterfamilien".
Was wird im Kapitel "Kritik an der Interkulturellen Pädagogik" behandelt?
Dieses Kapitel behandelt die Kritik an der Interkulturellen Pädagogik. Es zeigt die Schwierigkeiten auf, den Diskurs um die Interkulturelle Pädagogik in einen einheitlichen theoretischen Begriff zu fassen, und präsentiert verschiedene Konzepte der Interkulturellen Pädagogik, insbesondere die „Ausländerpädagogik“ und die „Antidiskriminierungspädagogik“. Es analysiert auch die Defizithypothese der „Ausländerpädagogik“.
- Arbeit zitieren
- Sherina Beha (Autor:in), 2025, Kann die Interkulturelle Pädagogik von deutschen "Begegnungsschulen" im Ausland lernen?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1574670