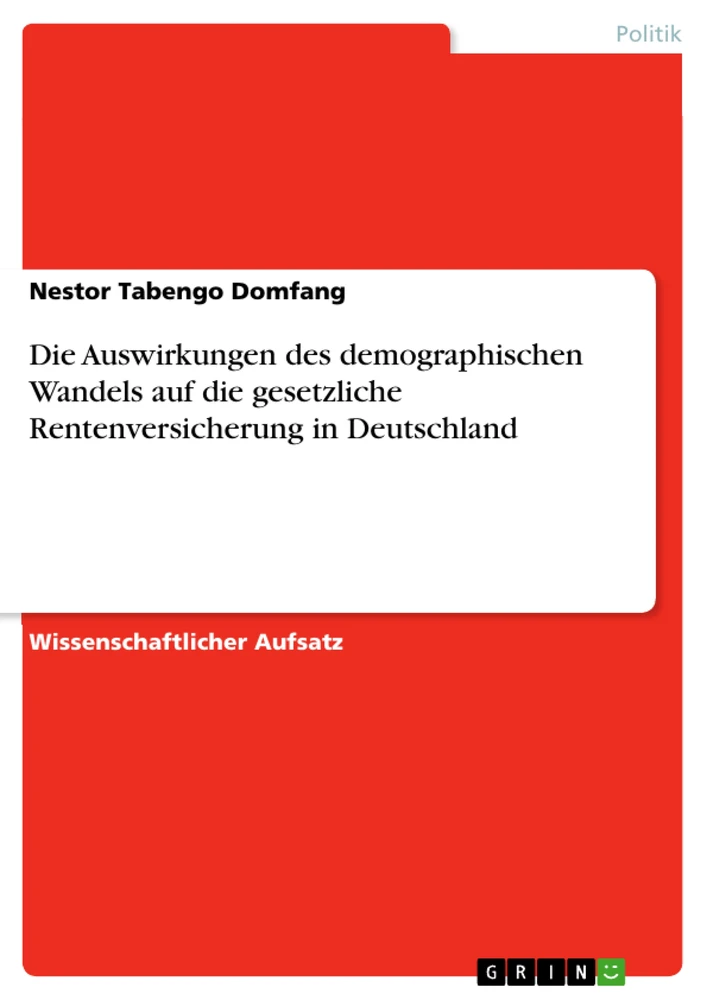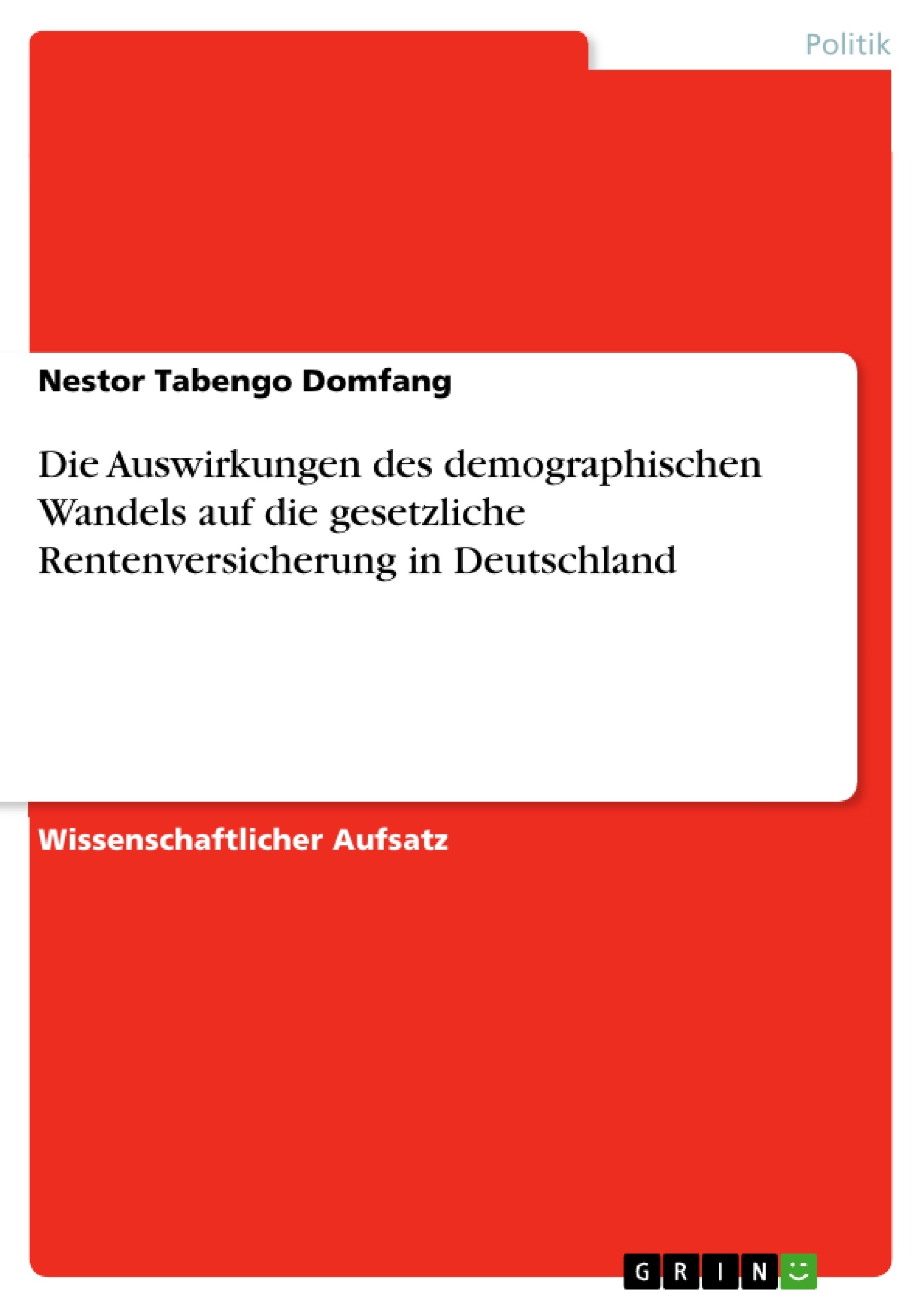Die Rente mit 67 und das Nachhaltigkeitsgesetz bringen zuerst Rentenkürzungen mit ihnen. Beim Einstieg in die betriebliche Altersversorgung erleiden die Rentnerinnen und Rentner übrigens viele Nachteile. Der erste Nachteil liegt darin, dass sie den vollen Krankenversicherungsbeitrag, also auch den Arbeitgeberanteil auf ihre Betriebsrenten statt wie bislang der Hälfte des Beitrags seit dem 1. Januar 2004 zahlen. Bei einer durchschnittlichen Betriebsrente von 330 Euro und einem durchschnittlichen Krankenversicherungsbeitrag von 14 Prozent entspricht das einer Mehrbelastung von etwa 23 Euro im Monat. Ein weiterer Nachteil ergibt sich außerdem daraus, dass seit April 2004 der volle Pflegebeitrag auf die Renten fällig ist. Das entspricht einer Rentenkürzung von 0,85 Prozent. Bei Arbeitgeberwechsel drohen überdies Verluste. Die Verträge für die betriebliche Altersversorgung werden nicht übrigens bei Geldknappheit beliehen oder können nicht verpfändet werden. Sämtliche Kapitalerträge werden zudem nicht nur bei der betrieblichen Altersversorgung, sondern auch bei der privaten Vorsorge bei Auszahlung voll besteuert. Das Alterseinkünftegesetz führt schließlich zu Verschlechterungen für Männer, die seit 2006 etwa 6,5 Prozent mehr Beiträge für die gleiche Rentenleistung wie die Frauen aufwenden müssen.
Die vorliegenden Bemerkungen lassen uns zum Schluss kommen, dass der demographische Wandel gemäß unserer These einen Übelstand für den deutschen Sozialstaat bildet. Überdies zeigen sie meist, dass die sich aus der demographischen Entwicklung in Deutschland ergebenden Probleme bisher nicht hinreichend gelöst sind. Deswegen sind neue Reformen nötig. Mit dem Niedergang der SPD und mithin deren Rückgang in die Opposition nach den Bundestagswahlen 2009 könnten die bisherigen Reformvorschläge von der amtierenden Regierungskoalition in nötigen Fällen reformiert werden. Die amtierende Bundesregierung aus CDU/CSU und FDP hat bereits die stärkere Berücksichtigung von Kindererziehungszeiten in der Rente, die Rentenangleichung in Ost und West und die Stärkung der betrieblichen Altersversorgung und der privaten Vorsorge vorgesehen. Jedoch sollten die Probleme ohne Rücksicht auf Parteienideologien angepackt werden, um nachhaltig gelöst werden zu können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Fragestellung
- Ziel und Abgrenzung der Arbeit
- Methoden, Erkenntnisinteresse und theoretische Perspektiven
- Grundlagen der gesetzlichen Rentenversicherung in Deutschland
- Träger und finanzielle Grundlagen
- Die Leistungen
- Altersrenten
- Renten gegen verminderter Erwerbsfähigkeit
- Hinterbliebenenrenten
- Leistungen an die Krankenversicherung der Rentner
- Leistungen an die Pflegeversicherung der Rentner
- Leistungen zur Rehabilitation
- Die Berechtigten
- Endogene Effekte
- Effekte auf die Alterssicherungsdauer
- Effekte auf die Finanzierungsbasis
- Effekte auf den Beitragssatz
- Effekte auf die Bundeszuschüsse
- Das Nachhaltigkeitsgesetz
- Reformmöglichkeiten nach den Bundestagswahlen 2009
- Exogene Effekte
- Die betriebliche Altersversorgung
- Die private Vorsorge
- Das Alterseinkünftegesetz
- Weitere Reformmöglichkeiten nach den Bundestagswahlen 2009
- Abschließende Betrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit den Auswirkungen des demografischen Wandels auf die gesetzliche Rentenversicherung in Deutschland. Sie zielt darauf ab, die Folgen der Überalterung der Gesellschaft auf die Rentenversicherung zu verdeutlichen und die Allgemeinheit darüber zu informieren.
- Die Auswirkungen des demografischen Wandels auf die Finanzierungsbasis der gesetzlichen Rentenversicherung
- Die Auswirkungen des demografischen Wandels auf das Renteneintrittsalter
- Die Auswirkungen des demografischen Wandels auf die Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung
- Mögliche Reformansätze zur Sicherung der gesetzlichen Rentenversicherung im Kontext des demografischen Wandels
- Die Bedeutung der privaten und betrieblichen Altersvorsorge im Kontext des demografischen Wandels
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel erläutert die Grundlagen der gesetzlichen Rentenversicherung in Deutschland, einschließlich ihrer Träger, finanziellen Grundlagen und der verschiedenen Leistungsarten. Das zweite Kapitel analysiert die endogenen Effekte des demografischen Wandels auf die Rentenversicherung. Hier werden die Auswirkungen auf die Alterssicherungsdauer, die Finanzierungsbasis, das Nachhaltigkeitsgesetz und die Reformmöglichkeiten im Kontext der Bundestagswahlen 2009 beleuchtet. Im dritten Kapitel werden exogene Effekte des demografischen Wandels auf die Rentenversicherung betrachtet, darunter die betriebliche Altersversorgung, die private Vorsorge, das Alterseinkünftegesetz und weitere Reformmöglichkeiten im Kontext der Bundestagswahlen 2009.
Schlüsselwörter
Demografischer Wandel, gesetzliche Rentenversicherung, Überalterung, Finanzierungsbasis, Renteneintrittsalter, Leistungen, Reformmöglichkeiten, private Vorsorge, betriebliche Altersversorgung, Nachhaltigkeitsgesetz.
Häufig gestellte Fragen
Wie wirkt sich der demographische Wandel auf die Renten aus?
Die Überalterung der Gesellschaft führt zu einer schrumpfenden Finanzierungsbasis bei gleichzeitig steigenden Ausgaben, was Rentenkürzungen und ein höheres Renteneintrittsalter zur Folge hat.
Was bedeutet die 'Rente mit 67' für die Versicherten?
Sie ist eine Reaktion auf die längere Lebenserwartung, führt aber de facto oft zu Rentenabschlägen für diejenigen, die nicht bis 67 arbeiten können.
Welche Nachteile gibt es bei der betrieblichen Altersvorsorge?
Rentner müssen seit 2004 den vollen Kranken- und Pflegeversicherungsbeitrag auf ihre Betriebsrenten zahlen, was die effektive Auszahlung deutlich mindert.
Was ist das Ziel des Nachhaltigkeitsgesetzes?
Es soll die Rentenentwicklung an das Verhältnis von Beitragszahlern zu Rentenempfängern koppeln, um die finanzielle Stabilität der Rentenversicherung langfristig zu sichern.
Warum sind private Vorsorge und Kindererziehungszeiten wichtig?
Private Vorsorge soll die Lücke der sinkenden gesetzlichen Rente schließen; die Berücksichtigung von Kindererziehungszeiten dient der sozialen Gerechtigkeit und dem Ausgleich demographischer Defizite.
- Quote paper
- Nestor Tabengo Domfang (Author), 2010, Die Auswirkungen des demographischen Wandels auf die gesetzliche Rentenversicherung in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/157481