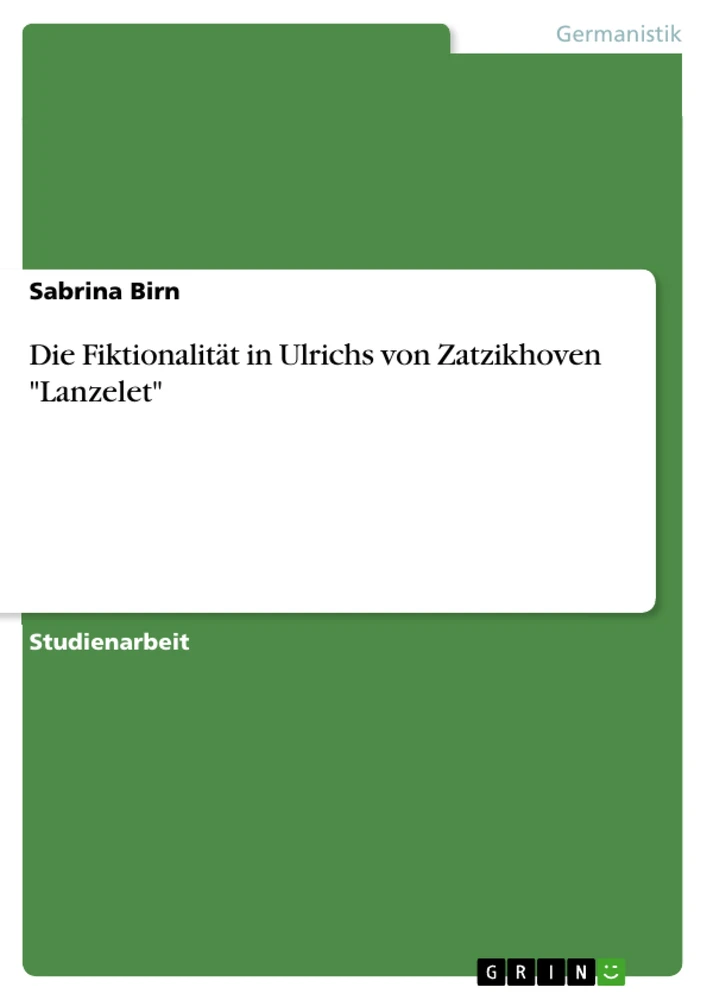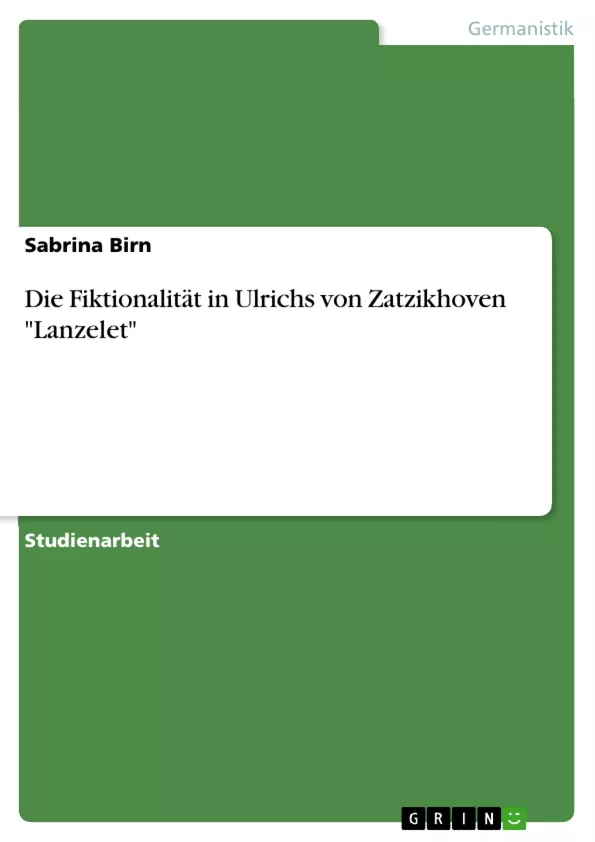Der Dichter Ulrich von Zatzikhoven verfasst um 1210 ein umfangreiches Werk von etwa 9500 Versen, den 'Lanzelet'. Überliefert ist der 'Lanzelet' lediglich in zwei Handschriften und vier Fragmenten. Der Stoff dieser Dichtung ist möglicherweise auf den französischen Epiker Chrétien de Troyes zurückzuführen. Dieser hat zwischen 1160 und 1190 den keltisch-bretonischen Sagenstoff um König Artus in Versromanen wie 'Erec', 'Yvain', 'Lancelot' und 'Perceval' zu einer geschlossenen Dichtungswelt jenseits der vorausgegangenen historischen Tatsächlichkeit umgearbeitet. Das Ziel dieser Arbeit ist es, die Fiktionalität im Lanzelet genauer zu untersuchen. Um dies zu ermöglichen, wird zuerst der Fiktionsbegriff genauer definiert, um für die darauffolgende Untersuchung am Text selbst, Vergleichsmöglichkeiten zu erhalten, mit denen dem Fiktionalitätsverständnis Ulrichs und auch dem der mittelalterlichen Rezipienten etwas näher gekommen werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einleitung
- 1. Der Fiktionsbegriff – Von der Antike bis heute
- 1.1 Fiktionalität in der Antike und im Mittelalter
- 1.2 Fiktionalität in der Neueren Forschung.
- 2. Funktion der indirekten Sprache
- 3. Untersuchungen der Fiktionalität an Ulrichs von Zatzikhoven Lanzelet
- 4. Schlussbetrachtungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit beschäftigt sich mit der Fiktionalität in Ulrichs von Zatzikhoven "Lanzelet". Ziel ist es, den Begriff der Fiktion im Kontext der mittelalterlichen Literatur zu beleuchten und seine Bedeutung für die Interpretation des "Lanzelet" zu analysieren.
- Der Wandel des Fiktionsbegriffs von der Antike bis zum Mittelalter
- Die Rolle der indirekten Sprache in der Konstruktion von Fiktionalität
- Die Anwendung des Fiktionsbegriffs auf ausgewählte Textstellen im "Lanzelet"
- Die Rezeption des "Lanzelet" im Mittelalter und in der neueren Forschung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und stellt den Kontext des "Lanzelet" im mittelalterlichen Literaturbetrieb dar. Sie beleuchtet die Quellen des Werks sowie die Forschungsgeschichte zu Ulrich von Zatzikhoven und seiner Dichtung.
Das erste Kapitel beschäftigt sich mit dem Begriff der Fiktion und seiner Entwicklung von der Antike bis zum Mittelalter. Dabei werden die Ansichten von Aristoteles, Platon und anderen wichtigen Autoren berücksichtigt. Besonderes Augenmerk liegt auf der Bedeutung der indirekten Sprache für die Konstruktion von Fiktionalität im Mittelalter.
Das zweite Kapitel untersucht die Funktion der indirekten Sprache im "Lanzelet" und zeigt, wie Ulrich von Zatzikhoven die Grenzen zwischen Wahrheit und Fiktion verschwimmen lässt.
Das dritte Kapitel analysiert ausgewählte Textstellen im "Lanzelet", um die Anwendung des Fiktionsbegriffs auf die konkrete literarische Praxis zu demonstrieren.
Schlüsselwörter
Fiktionalität, Mittelalter, Ulrich von Zatzikhoven, Lanzelet, indirekte Sprache, Artusroman, historische Wahrheit, Fiktion, Poetik, Aristoteles, Platon, Sprechakttheorie, Searle.
Häufig gestellte Fragen
Wer ist der Autor des Werks "Lanzelet"?
Das Werk "Lanzelet" wurde um 1210 von Ulrich von Zatzikhoven verfasst.
Was ist das zentrale Untersuchungsthema dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Fiktionalität im "Lanzelet" und wie Ulrich von Zatzikhoven die Grenzen zwischen Wahrheit und Fiktion gestaltet.
Wie wird der Fiktionsbegriff im Mittelalter definiert?
Der Begriff unterschied sich stark von modernen Ansätzen und war oft eng mit der Frage nach historischer Wahrheit und der Funktion von Sprache verknüpft.
Welchen Einfluss hatte Chrétien de Troyes auf den Lanzelet?
Chrétien de Troyes prägte den keltisch-bretonischen Sagenstoff um König Artus maßgeblich, worauf Ulrichs Werk möglicherweise stofflich zurückzuführen ist.
Was ist die Rolle der indirekten Sprache im Text?
Die indirekte Sprache dient als Mittel zur Konstruktion von Fiktionalität und beeinflusst die Wahrnehmung der Rezipienten hinsichtlich der Erzählwelt.
- Citation du texte
- Sabrina Birn (Auteur), 2006, Die Fiktionalität in Ulrichs von Zatzikhoven "Lanzelet", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/157511