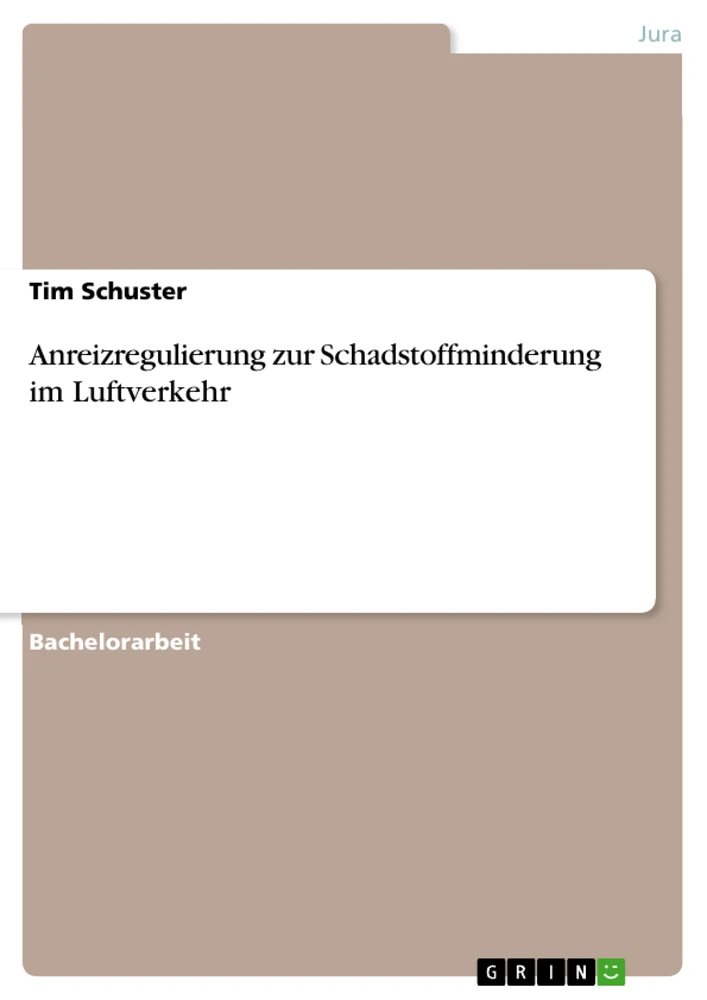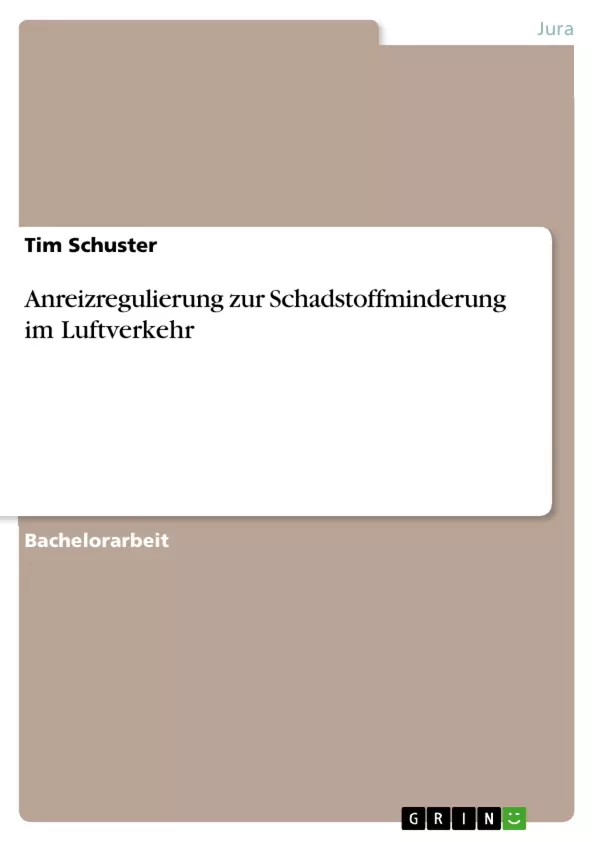Gegenstand dieser Arbeit soll es sein mögliche Instrumentarien zur Schadstoffreduktion im Luftverkehr und die rechtliche Ausgestaltung der Einbeziehung des Luftverkehrs in das EU-ETS darzustellen. Vor dem Hintergrund der beschlossenen Einbeziehung des Luftverkehrs in den europäischen Emissionshandel stellt sich die Frage, ob das gewählte Instrument auf den internationalen Luftverkehr anwendbar ist und zu einer effektiven THG-Reduktion im Luftverkehr führen kann?
Abschnitt 2 stellt die grundlegende Entwicklung der internationalen zivilen Luftfahrt einschließlich ihrer internationalen, europäischen und nationalen Gesetzesgrundlagen dar. Auf Grund des enormen Wachstums der Luftverkehrsbranche und der vielfältigen Auswirkungen auf das Klima, behandelt der dritte Abschnitt die Frage, welche Instrumentarien zur Schadstoffminderung im Luftverkehr denkbar und in welchem Maße diese zielführend seien. Vor dem Hintergrund der internationalen Verflechtung des Luftverkehrs muss die Frage gestellt werden, ob die beschlossene Einbeziehung des Luftverkehrs in den EU-ETS aus internationaler Sicht rechtlich durchführbar ist (4. Abschnitt) und wie diese auf europäischer Ebene durchgeführt werden soll (5. Abschnitt). Im 6. und letzten Abschnitt wird die bisherige Entwicklung des EU-ETS, sowie die von der Kommission herausgearbeiteten Änderungen für die dritte Handelsperiode dargestellt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Grundlagen und Entwicklung des Luftverkehrsrechts
- 2.1 Die internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO) und das Chicagoer Abkommen
- 2.2 Europäische Richtlinien
- 2.3 Deutsche Gesetzesgrundlagen
- 3. Instrumente zur Schadstoffminderung im Luftverkehr
- 3.1 Finanzielle Instrumente
- 3.2 Ordnungsrechtliche Maßnahmen
- 3.3 Operative Maßnahmen
- 3.4 Fazit
- 4. Vereinbarung des Emissionshandels mit dem Völkerrecht
- 4.1 Die Aufgabenübertragung an die ICAO
- 4.2 Die Vereinbarkeit mit dem Chicagoer Abkommen
- 4.3 Die Vereinbarkeit mit bilateralen Luftverkehrsabkommen
- 4.4 Fazit
- 5. Die Einbeziehung des Luftverkehrs in das Europäische Emissionshandelssystem
- 5.1 Anwendungsbereich
- 5.2 Gesamtmenge der Zertifikate für den Luftverkehr
- 5.3 Zuteilung von Zertifikaten durch Versteigerung
- 5.4 Zuteilung und Vergabe von Zertifikaten
- 5.5 Sonderreserve
- 5.6 Überwachungs- und Berichterstattungspläne
- 5.7 Projektbezogene Mechanismen
- 5.8 Gültigkeit der Zertifikate und Sanktionsmechanismen
- 6. Die Entwicklung des EU-ETS und die sich daraus ergebenen Änderungen für die 3. Handelsperiode
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Anreizregulierung zur Schadstoffminderung im Luftverkehr. Sie analysiert die Entwicklung des Luftverkehrsrechts sowie die verschiedenen Instrumente zur Schadstoffminderung. Ein Schwerpunkt liegt auf der Vereinbarkeit des Emissionshandels mit dem Völkerrecht, insbesondere dem Chicagoer Abkommen und bilateralen Luftverkehrsabkommen. Die Arbeit beleuchtet auch die Einbeziehung des Luftverkehrs in das Europäische Emissionshandelssystem (EU-ETS) und die damit verbundenen Herausforderungen und Chancen.
- Entwicklung des Luftverkehrsrechts
- Instrumente zur Schadstoffminderung im Luftverkehr
- Vereinbarkeit des Emissionshandels mit dem Völkerrecht
- Einbeziehung des Luftverkehrs in das EU-ETS
- Herausforderungen und Chancen der Anreizregulierung im Luftverkehr
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik der Anreizregulierung zur Schadstoffminderung im Luftverkehr ein. Es stellt die Relevanz des Themas dar und skizziert den Aufbau der Arbeit. Das zweite Kapitel behandelt die Grundlagen und Entwicklung des Luftverkehrsrechts, wobei die internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO) und das Chicagoer Abkommen, europäische Richtlinien und deutsche Gesetzesgrundlagen beleuchtet werden. Das dritte Kapitel befasst sich mit verschiedenen Instrumenten zur Schadstoffminderung im Luftverkehr, darunter finanzielle Instrumente, ordnungsrechtliche Maßnahmen und operative Maßnahmen. Es wird ein Fazit zu den verschiedenen Instrumenten gezogen.
Das vierte Kapitel analysiert die Vereinbarkeit des Emissionshandels mit dem Völkerrecht. Es wird untersucht, ob die Aufgabenübertragung an die ICAO mit dem Chicagoer Abkommen und bilateralen Luftverkehrsabkommen vereinbar ist. Abschließend wird ein Fazit zu den rechtlichen Rahmenbedingungen für den Emissionshandel im Luftverkehr gezogen. Das fünfte Kapitel befasst sich mit der Einbeziehung des Luftverkehrs in das EU-ETS. Es werden Themen wie der Anwendungsbereich, die Gesamtmenge der Zertifikate, die Zuteilung und Vergabe von Zertifikaten, die Sonderreserve, Überwachungs- und Berichterstattungspläne, projektbezogene Mechanismen sowie die Gültigkeit der Zertifikate und Sanktionsmechanismen behandelt.
Schlüsselwörter
Anreizregulierung, Luftverkehrsrecht, Schadstoffminderung, Emissionshandel, Chicagoer Abkommen, ICAO, EU-ETS, Luftverkehrsmanagement, Treibhausgase, Umweltpolitik, Nachhaltigkeit.
Häufig gestellte Fragen
Wie funktioniert das EU-ETS im Luftverkehr?
Fluggesellschaften müssen für ihren CO2-Ausstoß Zertifikate erwerben, deren Gesamtmenge gedeckelt ist, um Anreize zur Emissionsminderung zu schaffen.
Ist die Einbeziehung des Luftverkehrs völkerrechtlich zulässig?
Die Arbeit untersucht die Vereinbarkeit mit dem Chicagoer Abkommen und bilateralen Luftverkehrsabkommen, was international oft umstritten ist.
Was ist das Chicagoer Abkommen?
Die völkerrechtliche Grundlage der internationalen Zivilluftfahrt, die unter anderem die Souveränität über den Luftraum regelt.
Welche anderen Instrumente zur Schadstoffminderung gibt es?
Man unterscheidet finanzielle Instrumente, ordnungsrechtliche Maßnahmen und operative Maßnahmen zur Effizienzsteigerung.
Welche Rolle spielt die ICAO beim Klimaschutz?
Die Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO) ist für globale Standards zuständig; die EU handelte oft, weil globale ICAO-Lösungen zu langsam vorankamen.
- Arbeit zitieren
- Tim Schuster (Autor:in), 2009, Anreizregulierung zur Schadstoffminderung im Luftverkehr, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/157519