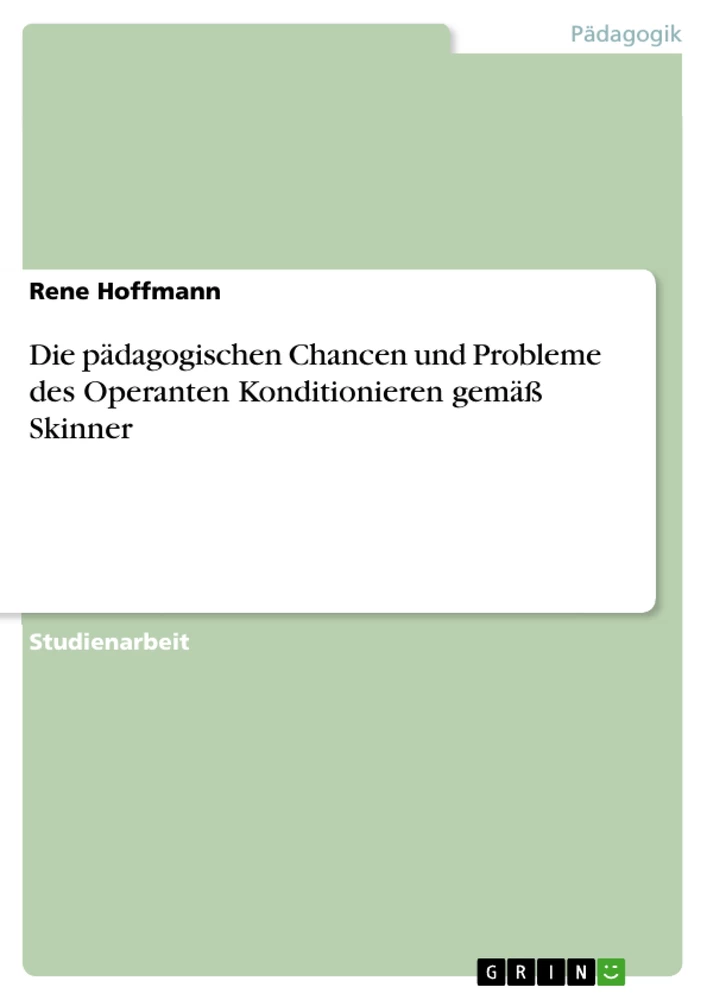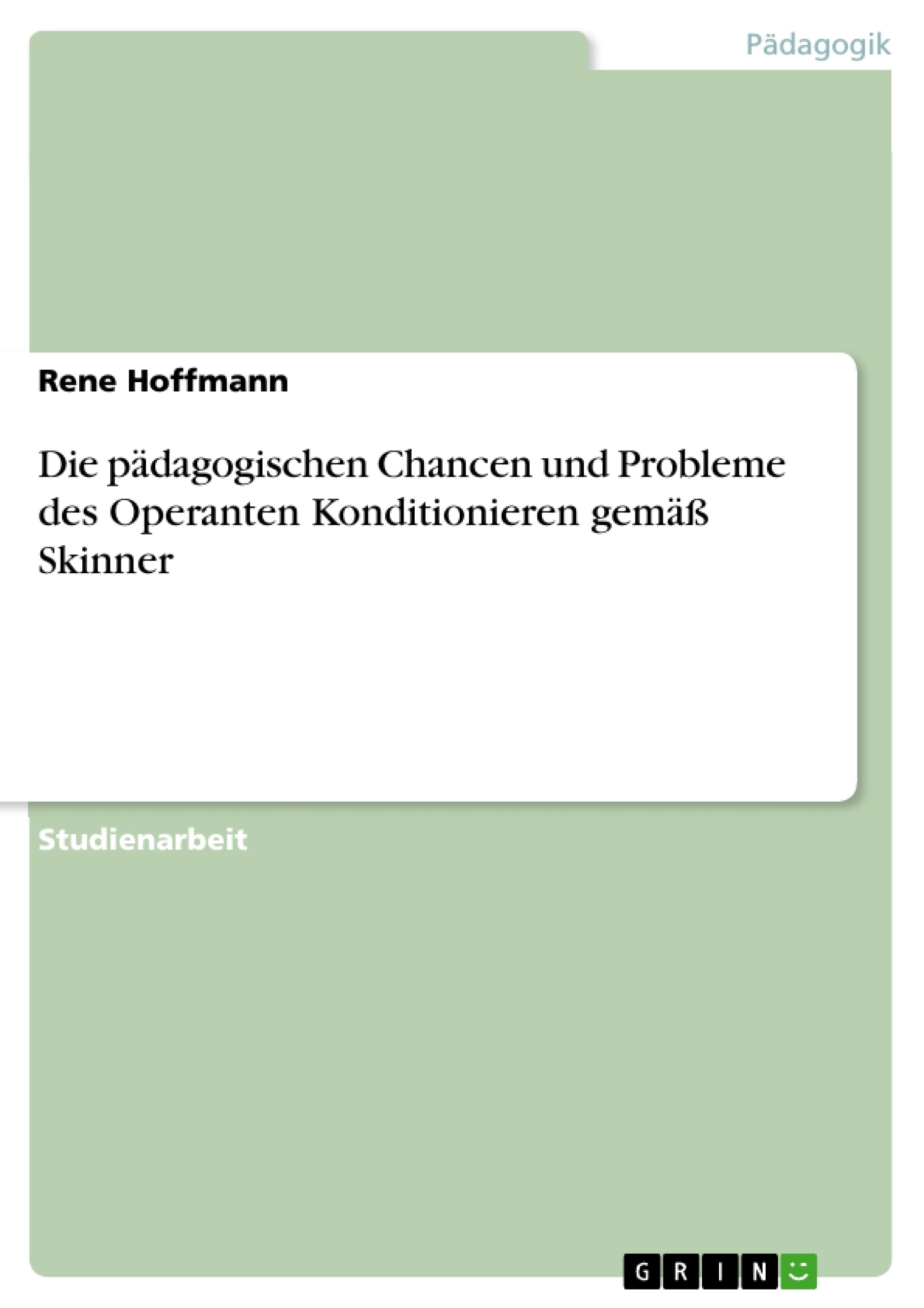Der Behaviorismus bietet Lösungsmöglichkeiten diese Frage zu beantworten. Unter dem Begriff Behaviorismus werden alle die Forschungsprogramme zusammengefasst, deren Basiseinheiten aus Reiz - Reaktions – Verbindungen bestehen, und die sich der naturwissenschaftlichen, objektiven und experimentellen Methodik verschrieben haben. Während die Arbeiten von Thorndike und Pawlow, der bedeutenden Vorläufer des Behaviorismus, im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts noch relativ sporadisch und auch voneinander isoliert rezipiert wurden, wurde die verbale Selbstidentifizierung der neuen Richtung vor allem in den USA sehr populär. Watson, der Begründer des Behaviorismus, proklamierte die Abkehr von der mentalistischen Psychologie der Psyche und des Bewusstseins, wie sie von der damaligen psychologischen Forschung betrieben wurde. Grundlage der Sichtweise des Behaviorismus ist, dass der Organismus als eine Art "Maschine" betrachtet wird. Eine Maschine, in die man nicht hineinsehen kann („black box"), sondern deren Funktionsweise nur aus einem Input (Reize) und dem Output (Reaktion) zu erschließen ist. Psychische Vorgänge werden dabei also in Reiz - Reaktions - Verbindungen aufgelöst. Der Behaviorismus wird demnach generell in einer empirisch - analytischen Sichtweise dargestellt. Er ist die umfassende Bezeichnung für alle beobachtbaren Aktivitäten des lebenden Organismus unter Ausschluss physiologischer und psychologischer Variablen. Einer der wichtigsten Vertreter dieser Theorie war der am 20.03.1904 in Susquehanna, Pennsylvania geborene Burrhus Frederic Skinner. Seine Theorie des deskriptiven Behaviorismus in Form der, von ihm experimentell untersuchten, Operanten Konditionierung soll in dieser Hausarbeit dargelegt werden. Nach Darstellung der theoretischen Grundlagen im zweiten Kapitel, soll der zentralen Fragestellung, welche Probleme und pädagogischen Chancen erschließen sich dem Erzieher in konkreten Erziehungssituationen, im dritten Kapitel auf den Grund gegangen werden. Im vierten Kapitel soll die Operante Konditionierung aus systemtheoretischer Sicht betrachtet werden. Etwaige Parallelen oder Unterschiede werden hier aufgezeigt. Am Ende dieser Arbeit wird anhand einer persönlichen Einschätzung deutlich, ob und in wie weit das Operante Konditionieren für die Erziehung des Menschen geeignet ist, sowie welche Vor- und Nachteile hinsichtlich seiner Verwendung zu erkennen sind.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die theoretischen Grundlagen der Operanten Konditionierung nach B.F. SKINNER
- Das Effektgesetz
- Die Operante Konditionierung
- Positive und negative Verstärkung
- Verstärkerklassen
- Bestrafung
- Die Operante Löschung
- Verstärkungspläne
- Generalisierung und Diskriminierung
- Die pädagogischen Aspekte des Operanten Konditionierens
- Unterstützende Erziehungsmaßnahmen
- Lob und Belohnung
- Lob und Belohnung als negative und positive Verstärker
- Pädagogische Probleme bei der Anwendung von Lob und Belohnung als Erziehungsmaßnahmen
- Der Einsatz von Verstärkungsplänen
- Gegenwirkende Erziehungsmaßnahmen
- Strafe und Bestrafung in der pädagogischen Praxis
- Pädagogische Probleme beim Einsatz von Strafe
- Unterstützende Erziehungsmaßnahmen
- Die Operante Konditionierung unter dem Blickwinkel der Systemtheorie
- Einführung in die Systemtheorie lebender Systeme
- Lernen und die Möglichkeit der Erziehung aus systemtheoretischer Sicht
- Systemtheoretische Kritik am Schema der Operanten Konditionierung
- Die Operante Konditionierung am Beispiel eigener Erfahrungen
- Eigene Einschätzung der Vor- und Nachteile des Operanten Konditionierens für die Pädagogik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der pädagogischen Bedeutung des Operanten Konditionierens nach B.F. Skinner. Sie untersucht die theoretischen Grundlagen des Konzepts und analysiert die Chancen und Herausforderungen, die sich aus seiner Anwendung in der Erziehungspraxis ergeben.
- Die theoretischen Grundlagen der Operanten Konditionierung nach Skinner
- Die Anwendung des Operanten Konditionierens in der Erziehungspraxis
- Die pädagogischen Chancen und Probleme des Operanten Konditionierens
- Die kritische Betrachtung des Operanten Konditionierens aus systemtheoretischer Sicht
- Die Reflexion eigener Erfahrungen im Kontext des Operanten Konditionierens
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Leser in die Thematik des Operanten Konditionierens einführt und die Relevanz dieser Theorie für die Pädagogik herausstellt. Im zweiten Kapitel werden die theoretischen Grundlagen des Operanten Konditionierens nach Skinner erläutert, wobei die zentralen Konzepte wie das Effektgesetz, die verschiedenen Verstärkerformen und die Bedeutung von Verstärkungsplänen sowie Generalisierung und Diskriminierung im Detail beleuchtet werden. Das dritte Kapitel widmet sich den pädagogischen Aspekten des Operanten Konditionierens. Hier werden sowohl unterstützende Erziehungsmaßnahmen wie Lob und Belohnung als auch gegenwirkende Maßnahmen wie Strafe und Bestrafung analysiert. Es wird dabei auf die potentiellen Chancen und Probleme der Anwendung dieser Konzepte in der Praxis eingegangen. Im vierten Kapitel wird das Operanten Konditionieren aus systemtheoretischer Perspektive betrachtet, um kritisch die Grenzen dieser Theorie zu beleuchten. Das fünfte Kapitel reflektiert die eigenen Erfahrungen im Kontext des Operanten Konditionierens, um die gewonnenen Erkenntnisse und die praktische Relevanz der Theorie zu verdeutlichen.
Schlüsselwörter
Operante Konditionierung, B.F. Skinner, Effektgesetz, Verstärkung, Bestrafung, Pädagogik, Erziehung, Systemtheorie, Lernen, Verhalten, Verhaltensmodifikation, Erziehungspraxis, Chancen, Probleme.
- Quote paper
- Rene Hoffmann (Author), 2003, Die pädagogischen Chancen und Probleme des Operanten Konditionieren gemäß Skinner, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/15757