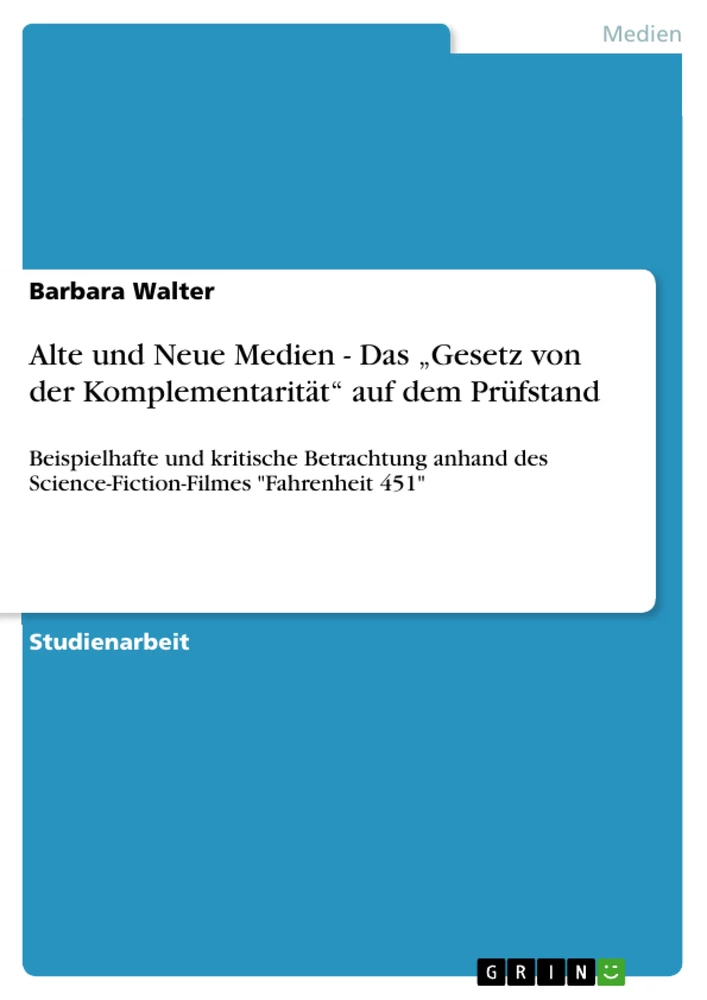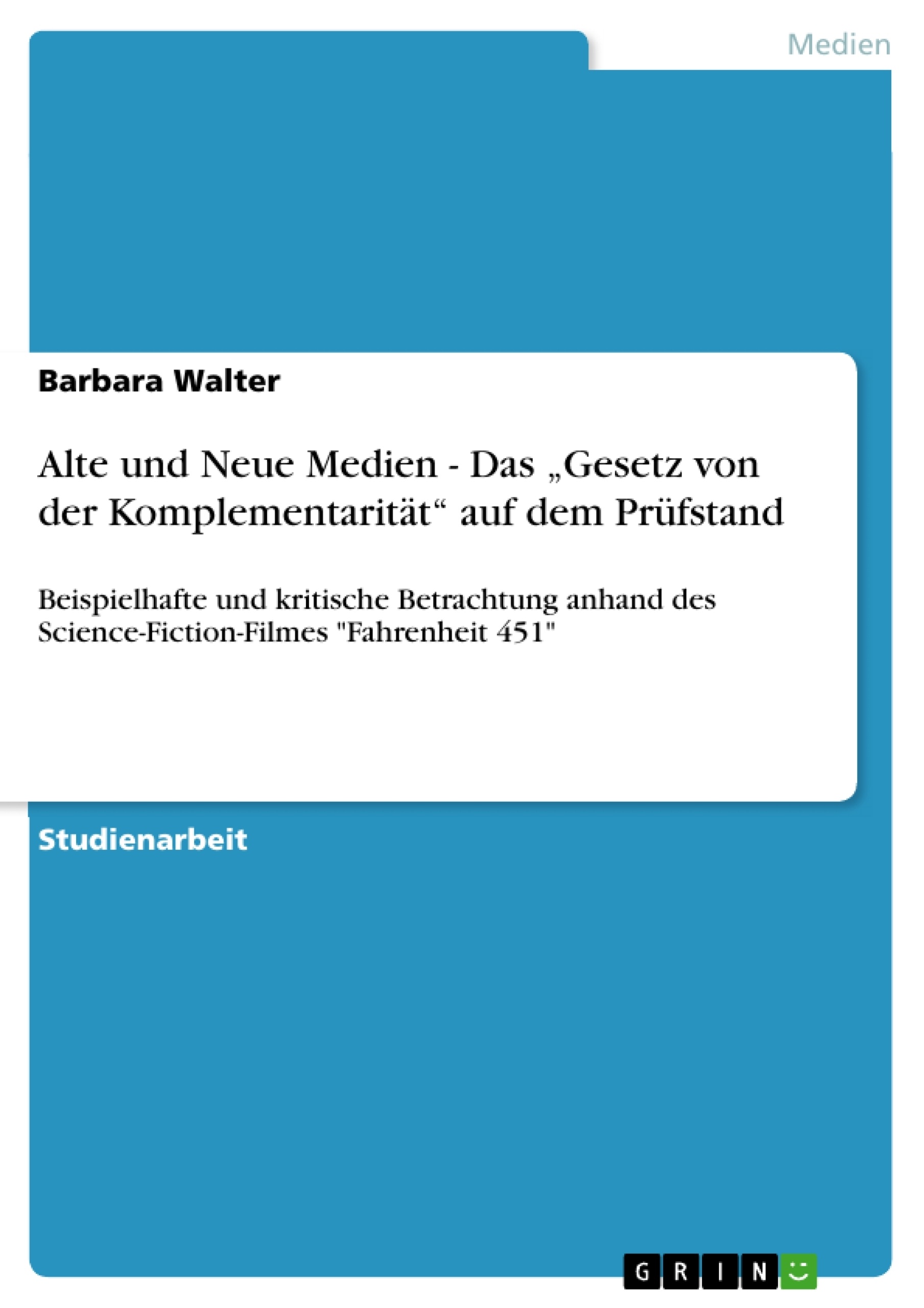Der in der Medientheorie immer wieder aufgegriffene Diskurs um Alte und Neue Medien, die Frage, ob ein Neues das Alte verdränge, ablöse, oder gar zerstöre, gilt heute gemeinhin allein dadurch beantwortet, dass es immer noch Bücher, Malerei, Schallplatten und Kassetten gibt, denen sich der Mediennutzer nahezu uneingeschränkt bedienen kann. Doch es ist jene grundlegende Annahme, jenes konstitutive „Gesetz von der Komplementarität“, welches die vorliegende Untersuchung kritisch zu reflektieren erstrebt.
Die Untersuchung stellt sich somit bewusst gegen eine jahrelang aufrechterhaltene These, die auf das Jahr 1913 zurückgeht, und wird versuchen, diese zeitgemäß neu zu interpretieren.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- EINFÜHRUNG IN DEN MEDIENDISKURS UM ALTE UND NEUE MEDIEN
- Begriffsabgrenzung
- Neue Medien und Alte Medien
- Der Begriff der Supplementierung
- Der Begriff der Komplementierung
- Das Gesetz der Komplementarität
- Das Riepl'sche Gesetz
- Zeitgenössische Betrachtung
- Begriffsabgrenzung
- „FAHRENHEIT 451“
- Filmanalyse und Interpretation
- Historische Kontextualisierung
- „Fahrenheit 451“ als Inkunabel einer Medienkritik
- RESÜMEE - ZEITGENÖSSISCHE AUSLEGUNG
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Untersuchung setzt sich kritisch mit dem „Gesetz von der Komplementarität“ auseinander, welches besagt, dass Alte Medien niemals vollständig durch Neue Medien verdrängt werden können. Anhand des Science-Fiction-Films „Fahrenheit 451“ wird untersucht, ob der Wertigkeitsumbruch in der Medienlandschaft nicht doch mit einem Prozess der „schöpferischen Zerstörung“ gleichzusetzen ist.
- Historische Entwicklung des Mediendiskurses um Alte und Neue Medien
- Begriffsdefinition von Supplementierung und Komplementierung
- Kritische Betrachtung des Riepl'schen Gesetzes der Komplementarität
- Analyse des Films „Fahrenheit 451“ als Beispiel für Medienkritik
- Zeitgenössische Auslegung des „Gesetzes von der Komplementarität“
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet den Diskurs um Alte und Neue Medien, stellt die Problematik des „Gesetzes von der Komplementarität“ dar und führt in die Untersuchung ein. Das zweite Kapitel befasst sich mit dem Begriffsverständnis von Alten und Neuen Medien sowie den Konzepten von Supplementierung und Komplementierung. Anschließend wird das Riepl'sche Gesetz der Komplementarität, das eine Koexistenz von Alten und Neuen Medien postuliert, vorgestellt und in einen zeitgenössischen Kontext gestellt. Das dritte Kapitel analysiert den Film „Fahrenheit 451“ von Francois Truffaut im Hinblick auf seine medienkritische Aussage, sowohl hinsichtlich der damaligen Medienlandschaft als auch in heutiger Zeit.
Schlüsselwörter
Alte Medien, Neue Medien, Supplementierung, Komplementarität, Riepl'sches Gesetz, Medienkritik, Film, „Fahrenheit 451“, Science-Fiction, Schöpferische Zerstörung
Häufig gestellte Fragen
Was besagt das Riepl’sche Gesetz der Komplementarität?
Es besagt, dass neue, höher entwickelte Medien die alten Medien niemals vollständig verdrängen, sondern diese lediglich ergänzen (Komplementierung) oder in andere Funktionsbereiche abdrängen.
Was ist der Unterschied zwischen Supplementierung und Komplementierung?
Supplementierung bezeichnet das Hinzufügen oder Ersetzen, während Komplementierung die gegenseitige Ergänzung von Medien beschreibt.
Wie wird „Fahrenheit 451“ in der Arbeit genutzt?
Der Film dient als Analysebeispiel für eine radikale Medienkritik und untersucht, ob ein Wertigkeitsumbruch in der Medienlandschaft einer „schöpferischen Zerstörung“ gleichkommen kann.
Ist das Riepl’sche Gesetz heute noch aktuell?
Die Arbeit setzt sich kritisch damit auseinander und prüft, ob die digitale Transformation die These der dauerhaften Koexistenz alter und neuer Medien ins Wanken bringt.
Was versteht man unter „schöpferischer Zerstörung“ im Medienkontext?
Es beschreibt einen Prozess, bei dem neue Innovationen alte Strukturen grundlegend zerstören, um Platz für Neues zu schaffen, was im Gegensatz zur reinen Komplementarität steht.
- Quote paper
- Barbara Walter (Author), 2010, Alte und Neue Medien - Das „Gesetz von der Komplementarität“ auf dem Prüfstand , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/157604