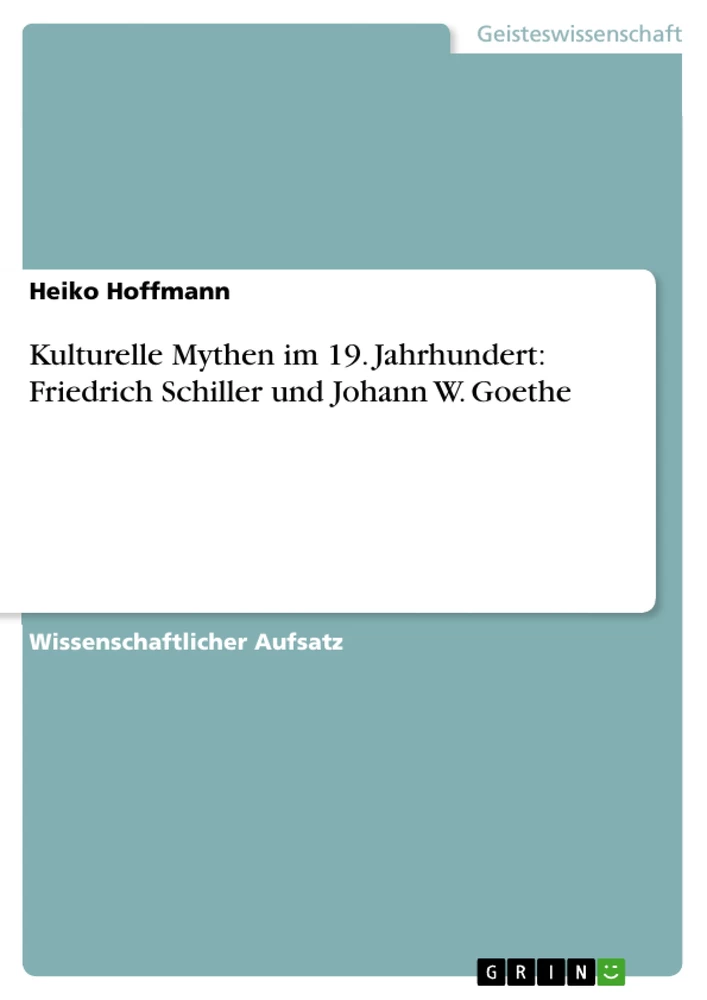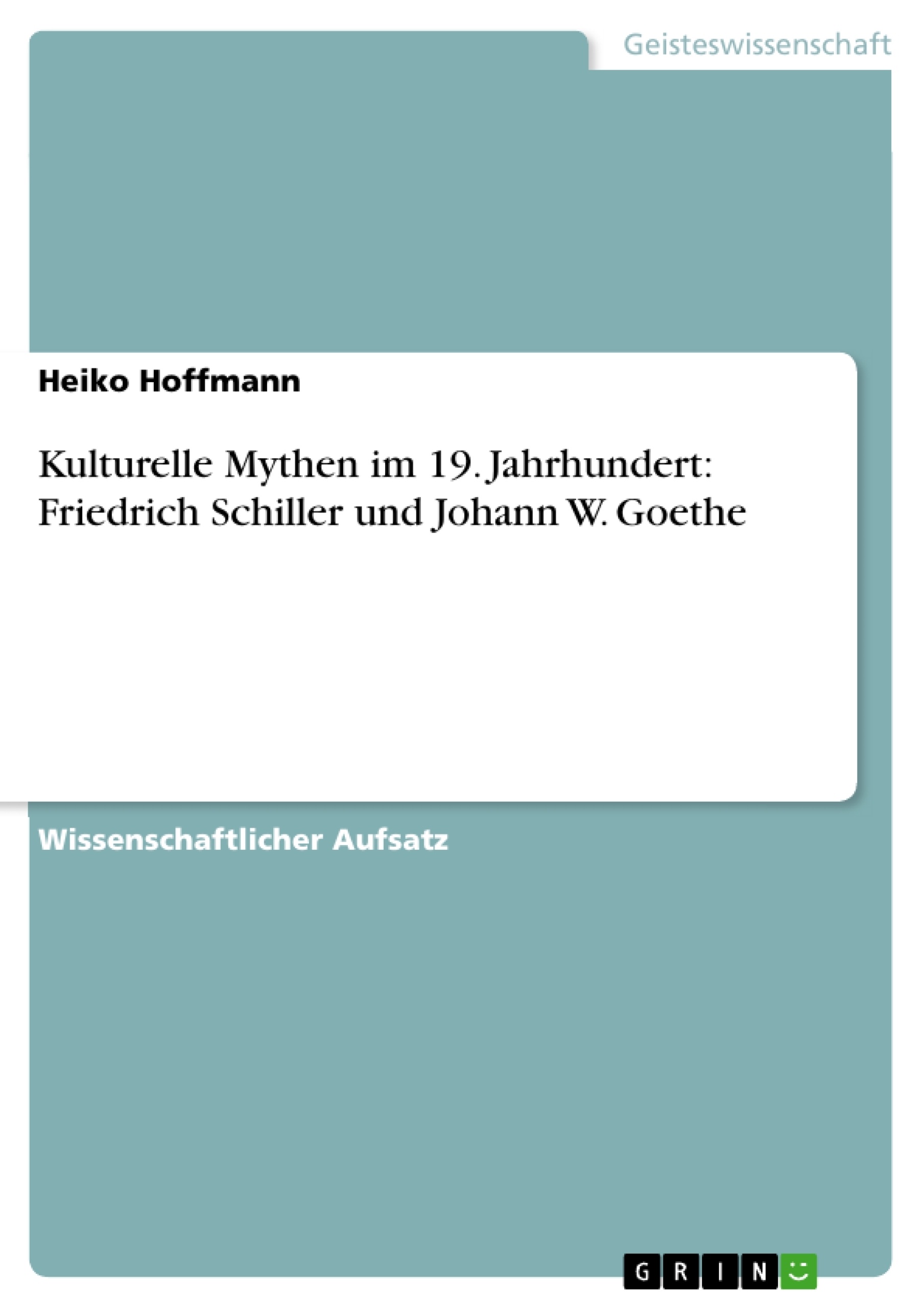Einleitung
Durch die Verwissenschaftlichung des Faches Geschichte bildete sich während des 19. Jahrhunderts eine Art der Geschichtsschreibung heraus, die wir als Nationalgeschichte kennen. Diese Form der Geschichtsschreibung befasst sich mit der Entstehung von Nationen
und sieht es dabei als Aufgabe, den Staat politisch sowie kulturell zu legitimieren. Von Bedeutung ist hierbei, dass jeder Staat seine eigene Nationalgeschichte entwickelt, diese im Innern durch jedes Individuum konstituiert wird und zugleich eine Abgrenzung von außerstaatlichen Institutionen oder Menschen erfolgt. Dementsprechend kann die
Geschichtsschreibung zur Förderung und Ausbildung von kollektiven Identitäten beitragen. Diese kurze Abhandlung illustriert, wie kulturelle Persönlichkeiten im Zuge der Geschichtsschreibung hochstilisiert und den Bedürfnissen der jeweiligen Gegenwart angepasst werden. Dabei kann sich jedoch eine kulturelle Sinngebung ebenso durch Feste, Denkmäler oder Symbolen herausbilden. Die Arbeit zeigt aber auch die stete Änderung von Geschichte mit dem einhergehenden Wandel des kollektiven Bewusstseins. So bedienen sich Historiker vergangener Ereignisse respektive Personen und interpretieren diese für sich selbst und ihre Gegenwart jeweils neu.1 Andererseits beeinflussen Historiker durch das Schreiben von Geschichte künftige Ereignisse und versuchen (bewusst oder unbewusst) diese in ein kollektives Bewusstsein zu manifestieren.Gerade in den ausgesuchten Beispielen mit
Friedrich Schiller und Johann Wolfgang von Goethe wird ersichtlich, wie kulturelle Geistesgrößen zur Legitimierung politischer Ziele und Vorstellungen verwendet werden. So ist besonders in der Entstehung von Nationen zu beobachten, dass Vergangenheit durch die gegenwärtige Geschichtsschreibung in eine „ersehnte Zukunft“ transformiert wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Mythenbildung im Nation-building
- Mythos: Friedrich Schiller
- Schillers literarisches Schaffen und seine öffentliche Bewunderung
- Goethekult im Kaiserreich
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Abhandlung analysiert die Mythisierung kultureller Persönlichkeiten im 19. Jahrhundert, insbesondere von Friedrich Schiller und Johann Wolfgang von Goethe, im Kontext der Entstehung von Nationalgeschichte und der Konstituierung nationaler Identitäten. Sie untersucht, wie diese Persönlichkeiten hochstilisiert und zur Legitimierung politischer Ziele instrumentalisiert wurden. Dabei werden die Rolle von Mythen und Kulten in der Nationsbildung, die sprachliche Wirkung der Dichter sowie die politische und kulturelle Instrumentalisierung ihrer Werke beleuchtet.
- Die Rolle von Mythen und Kulten in der Nationsbildung
- Die Instrumentalisierung kultureller Persönlichkeiten zur Legitimierung politischer Ziele
- Die sprachliche Wirkung von Schiller und Goethe auf die Entwicklung nationaler Identitäten
- Die öffentliche Rezeption von Schiller und Goethe in verschiedenen Epochen des 19. Jahrhunderts
- Der Wandel des kollektiven Bewusstseins und seine Auswirkung auf die Geschichtsschreibung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung erläutert den Hintergrund der Nationalgeschichte und die Rolle der Geschichtsschreibung in der Bildung von kollektiven Identitäten. Die Abhandlung fokussiert auf die Mythisierung kultureller Persönlichkeiten im Kontext dieser Entwicklung.
Mythenbildung im Nation-building
Dieser Abschnitt definiert die Begriffe Mythos und Kult und beleuchtet ihre Bedeutung bei der Entstehung von Nationen. Der Text argumentiert, dass Mythen durch ihre Dauerhaftigkeit und ihre Verbindung zu politischen oder gesellschaftlichen Zielen zur Legitimierung von Handeln beitragen.
Mythos: Friedrich Schiller
Der Abschnitt beleuchtet die Mythisierung Schillers, insbesondere seine Rolle in der deutschen Nationalgeschichte. Die öffentliche Verehrung Schillers durch Schillervereine, Denkmäler und Feierlichkeiten wird dargestellt. Der Text betont, wie Schillers Sprache und Werke zur Identitätsbildung und zur Vermittlung von Werten im 19. Jahrhundert eingesetzt wurden.
Goethekult im Kaiserreich
Der Abschnitt beschreibt die Verlagerung der öffentlichen Aufmerksamkeit von Schiller zu Goethe im Zuge der Reichsgründung. Die Bedeutung Goethes für die kulturelle Einheit des Deutschen Reichs und die Instrumentalisierung seiner Werke, insbesondere Faust, werden diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themenbereiche Nationalgeschichte, Mythenbildung, Kult, Identitätsbildung, kulturelle Persönlichkeiten, Friedrich Schiller, Johann Wolfgang von Goethe, Nation-building, Sprachgemeinschaft, Instrumentalisierung und politische Legitimierung. Die Untersuchung stützt sich auf empirische Beispiele aus der deutschen Literatur und Geschichte des 19. Jahrhunderts.
- Quote paper
- Heiko Hoffmann (Author), 2009, Kulturelle Mythen im 19. Jahrhundert: Friedrich Schiller und Johann W. Goethe , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/157657