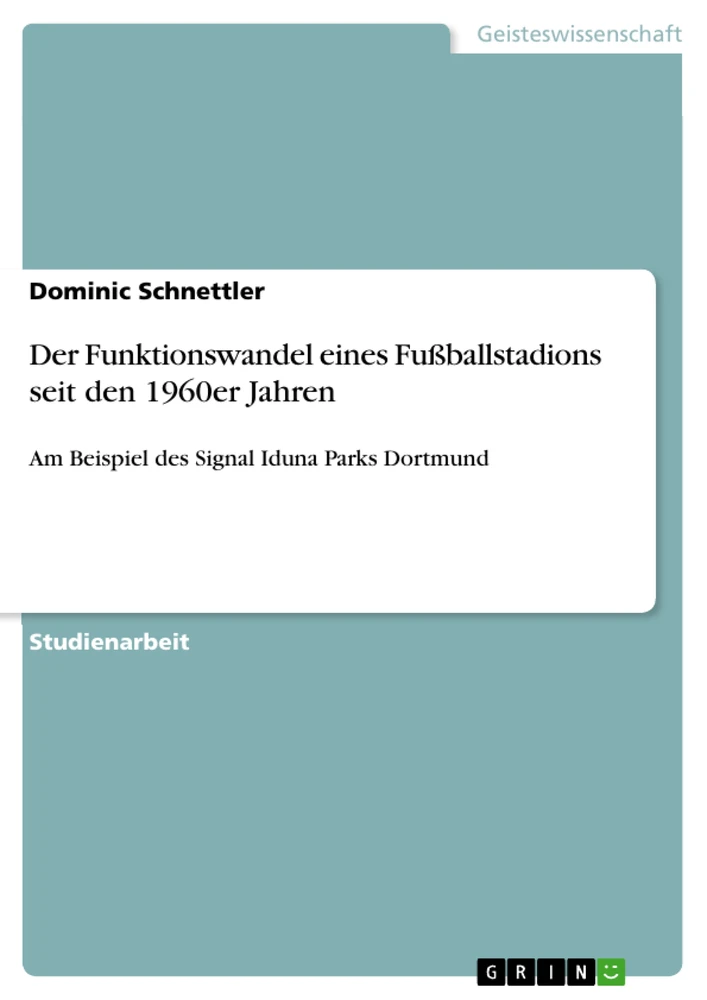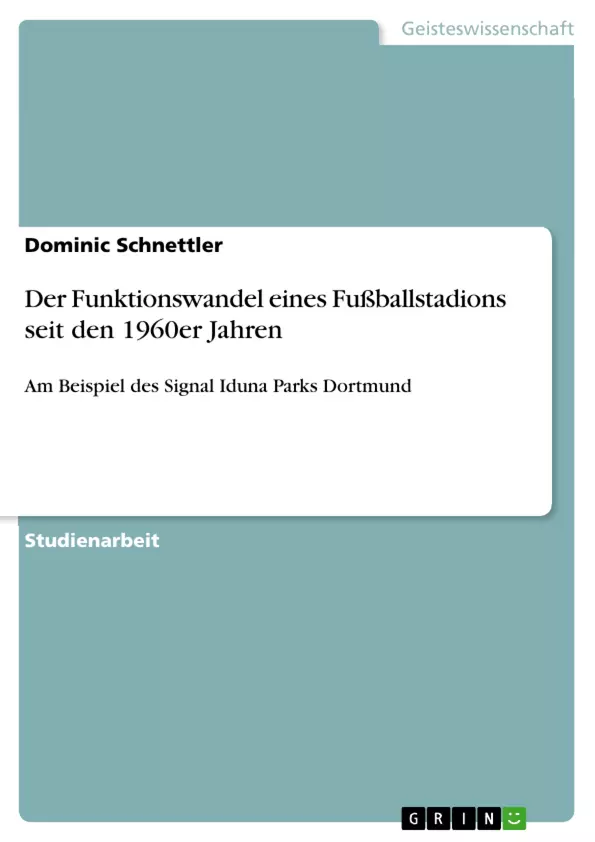Stadien als Austragungsorte für Sportereignisse gibt es schon seit der Antike. Anfangs be-zeichnete das altgriechische Wort Stadion noch eine 192,28m bzw. 600ft1 lange Laufbahn, an deren Seiten sich Zuschauer aufstellen und dem sportlichen Wettkampf der Athleten beiwohnen konnten. In den nächsten zweieinhalb Jahrtausenden entwickelte sich dieser ‚Sport-Raum’ jedoch enorm weiter. Nach und nach wurde aus gerader eine ovale Bahn, die ein Frei-Feld umschloss und zunehmend eingerahmt wurde von Steh- und Sitzmöglichkei-ten. Was insbesondere in griechisch-römischer Zeit vielfach kultische Hintergründe hatte, fokussierte sich dann auf das Sportereignis im Zentrum des Stadion-Komplexes.
Zu beobachten ist aber nicht nur eine Bedeutungswandlung dieses Primärereignisses, für wen, wozu und wie es ausgetragen wurde, sondern auch ein Wandel in der Art und Weise, wie die sportliche Wettkampfstätte selbst und ihr ‚Drumherum’ gebaut und genutzt wur-den. Zweck und Funktion des Stadions änderten sich. Dass man heute nicht nur eine Leichtathletik-Laufstrecke mit dem Begriff Stadion verbindet, sondern einen architektoni-schen Komplex, der längst nicht mehr nur sportliche Funktionen bedient, macht deutlich, dass (Erscheinungs-)Bild und Bedeutung dieses Raumes eine ‚Archimorphose’2 durchlau-fen haben, an deren – vorläufigem – Ende heute meist multifunktionale (Sport-)Arenen stehen.
Diese Arbeit fragt daher mit einer architektursoziologischen sowie sozialmorphologischen Perspektive3 am Beispiel Signal Iduna Park Dortmund, wie sich der Funktionswandel spe-ziell von Fußballstadien seit den 1960er Jahren vollzogen hat, wie er sich sichtbar in der Architektur zeigt und was das für das Erlebnis ‚Stadionbesuch’ bedeutet. Dieser soll auf mehrfache Weise nachgezeichnet werden: Zum einen4 durch den architektonischen Ver-gleich der Stadien Rote Erde und Signal Iduna Park (Kap. II), was sich aus vier Gründen anbietet: die Stadien, die (1) zu ganz verschiedenen Zeiten gebaut wurden, werden (2) bis heute (3) von demselben Verein genutzt und liegen (4) nebeneinander, was buchstäblich den direkten Vergleich dieser unüblichen Konstellation5 ermöglicht.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Die Architektur der Stadien im Wandel.
- III. Multifunktionale Stadionnutzung.
- III.1 Nutzung - Die Stadt Dortmund
- III.2 Nutzung - Verein
- III.3 Nutzung - Die Fans.
- IV. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Funktionswandel von Fußballstadien seit den 1960er Jahren am Beispiel des Signal Iduna Parks Dortmund. Sie zeichnet die Entwicklung der Stadionarchitektur und die Bedeutung der Stadien für die Stadt, den Verein und die Fans nach.
- Architektur und Funktionswandel von Fußballstadien
- Multifunktionale Nutzung von Fußballstadien
- Bedeutung von Fußballstadien für die Stadt Dortmund
- Nutzung des Stadions durch den Verein
- Fan-Erlebnis im Stadion
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel I beleuchtet die Entwicklung des Stadionbegriffs von der Antike bis zur Gegenwart und erläutert die Fragestellung der Arbeit. In Kapitel II wird der architektonische Wandel anhand eines Vergleichs zwischen der Roten Erde und dem Signal Iduna Park dargestellt. Kapitel III analysiert die multifunktionale Nutzung des Signal Iduna Parks aus den Perspektiven der Stadt Dortmund, des Vereins und der Fans. Die Kapitel IV und V wurden in dieser Vorschau nicht berücksichtigt.
Schlüsselwörter
Diese Arbeit befasst sich mit den Themen Fußballstadion, Architektur, Funktionswandel, Multifunktionalität, Stadtentwicklung, Vereinswesen, Fans, Signal Iduna Park Dortmund, Rote Erde, Westfalenstadion.
Häufig gestellte Fragen
Wie hat sich die Funktion von Fußballstadien seit den 1960ern gewandelt?
Stadien haben sich von reinen Sportstätten zu multifunktionalen Arenen entwickelt, die auch kommerzielle, kulturelle und soziale Funktionen bedienen.
Was ist der architektonische Unterschied zwischen "Rote Erde" und "Signal Iduna Park"?
Die Rote Erde ist ein klassisches Leichtathletikstadion, während der Signal Iduna Park eine moderne, spezialisierte Fußballarena mit hoher Kapazität und Multifunktionalität ist.
Welche Bedeutung hat das Stadion für die Stadt Dortmund?
Das Stadion ist ein bedeutender Wirtschaftsfaktor, ein Wahrzeichen der Stadt und ein zentraler Ort der Identifikation für die Bürger.
Was bedeutet "Multifunktionalität" bei modernen Arenen?
Es beschreibt die Nutzung des Raums für Events jenseits des Fußballs, wie Konzerte, Kongresse oder Gastronomie, um die Rentabilität zu steigern.
Wie beeinflusst die Architektur das Fan-Erlebnis?
Die moderne Architektur zielt auf maximale Nähe zum Spielfeld, bessere Akustik und hohen Komfort ab, was die Atmosphäre und das Erlebnis des Stadionbesuchs prägt.
- Arbeit zitieren
- Dominic Schnettler (Autor:in), 2010, Der Funktionswandel eines Fußballstadions seit den 1960er Jahren, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/157681