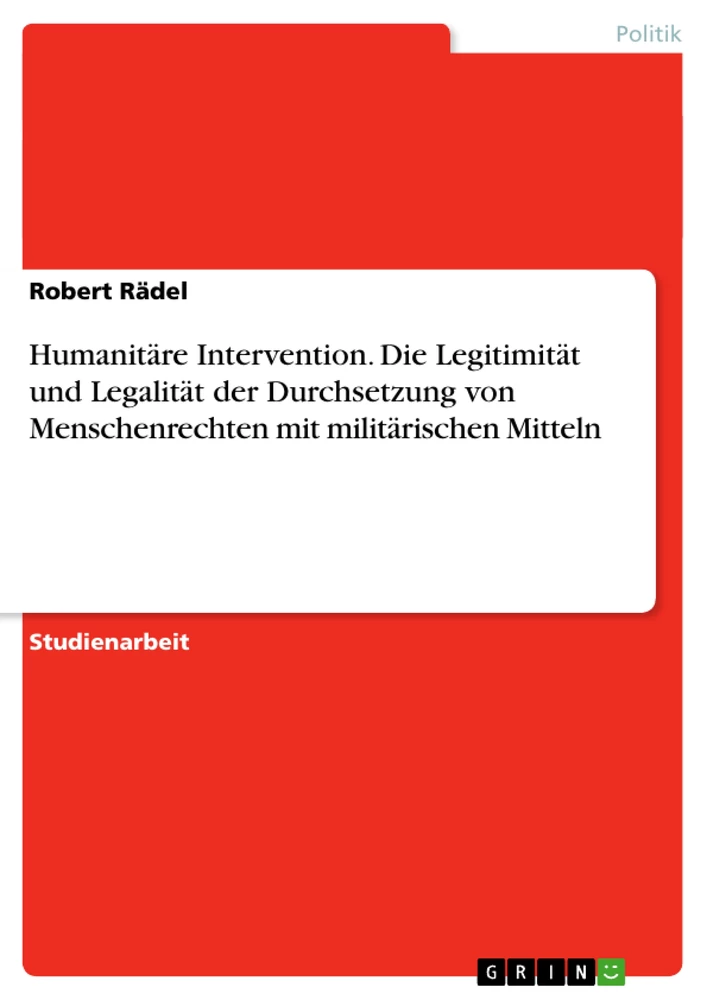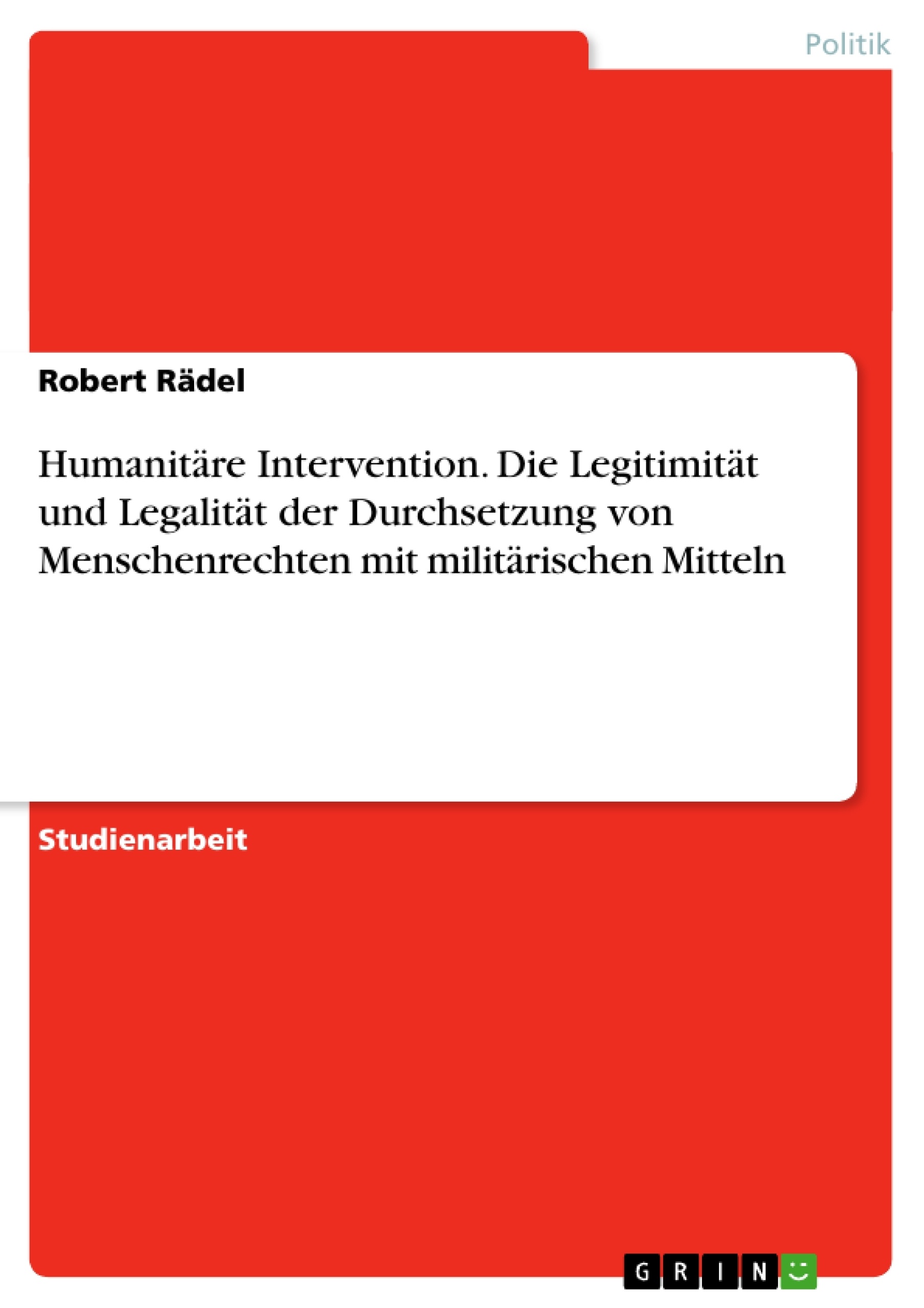Das Spannungsverhältnis zwischen der moralisch und völkerrechtlich verpflichtenden Anerkennung und Beachtung der elementarsten Menschenrechte auf der einen Seite und dem fast absolut geltenden Gewalt- und Interventionsverbot auf der anderen trat nach dem Ende des Kalten Krieges offen zu Tage. Seit dem dreht sich die Diskussion im Völkerrecht verstärkt um die moralische und rechtliche Zulässigkeit der sogenannten Humanitären Intervention. Es gibt Tendenzen, dass im Extremfall einer drohenden massiven Verletzung der Menschenrechte die staatliche Souveränität und das Gewaltverbot ein Eingreifen nicht verhindern dürfen. Diskussionsbedürftig ist dabei einerseits das Verhältnis von (moralischer) Legitimität und der völkerrechtlichen Legalität solcher Interventionen und andererseits die Kompetenzzuweisung, also die Frage, ob allein die Vereinten Nationen in Form einer Sicherheitsratsresolution oder bei Versagen des multilateralen Systems auch einzelne Staaten zur Humanitären Intervention berechtigt sind.
Diese Arbeit geht aus rechtswissenschaftlicher Sicht der Frage nach, ob, und wenn ja, wie sich ein bewaffnetes Eingreifen in die Souveränität eines anderen Staates aus eventuell übergeordneten, humanitären Interessen rechtfertigen lässt. Aus politikwissenschaftlicher Sicht interessiert die politische Verantwortlichkeit für Menschenrechtsprobleme und ob sich aus den Ausführungen eine Pflicht für die politischen Entscheidungsakteure zur Humanitären Intervention ableiten lässt.
Sowohl aus ethisch-moralischer als auch aus völkerrechtlicher Perspektive lassen sich gute Gründe für die Zulässigkeit einer unilateralen humanitären militärischen Intervention finden. Aber nur wenn das universelle, in der Natur des Menschen veranlagte Recht auf Leben, Freiheit und körperliche Unversehrtheit systematisch gebrochen wird und massive inhumane Verbrechen unmittelbar bevorstehen oder anhalten, lässt sich eine humanitäre militärische Intervention rechtfertigen. Wenn die menschlichen Grundlagen auf dem Spiel stehen, wird eine Humanitäre Intervention zumindest zur moralischen Pflicht, aber ein völkerrechtliches Pendant zur unterlassenen Hilfeleistung bleibt leider vorerst Utopie.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zum Verständnis von Humanitärer Intervention. Begriffliche und inhaltliche Dimensionen.
- Warum Humanitäre Intervention? Ethische und moralische Überlegungen.
- Die Frage nach der völkerrechtlichen Legalität der Humanitären Intervention.
- Das Gewalt- und Interventionsverbot der Charta der Vereinten Nationen und seine Ausnahmen.
- Menschenrechtsnormen und ihr Geltungsanspruch im modernen Völkerrecht
- Rechtliche Argumente und Kriterien für die Zulässigkeit Humanitärer Interventionen.
- Politikwissenschaftliche Wertung und Zusammenfassung.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage der Legitimität und Legalität von Humanitären Interventionen. Ziel ist es, aus rechtswissenschaftlicher Sicht zu untersuchen, ob und wie sich ein bewaffnetes Eingreifen in die Souveränität eines anderen Staates aus eventuell übergeordneten, humanitären Interessen rechtfertigen lässt. Aus politikwissenschaftlicher Sicht wird die politische Verantwortlichkeit für Menschenrechtsprobleme betrachtet und untersucht, ob sich aus den Ausführungen eine Pflicht für die politischen Entscheidungsakteure zur Humanitären Intervention ableiten lässt.
- Begriffliche Einordnung und Definition der Humanitären Intervention
- Ethische und moralische Überlegungen zur Rechtfertigung von Interventionen
- Völkerrechtliche Legalität und die Grenzen staatlicher Souveränität
- Rechtliche Argumente und Kriterien für die Zulässigkeit von Interventionen
- Politische Verantwortung für Menschenrechtsprobleme
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung beleuchtet die historischen Hintergründe und die aktuelle Relevanz der Frage nach Humanitären Interventionen im Kontext von Völkerrecht und Menschenrechten.
- Das zweite Kapitel befasst sich mit der Definition und Einordnung des Begriffs der Humanitären Intervention. Es werden verschiedene Perspektiven und Denkansätze vorgestellt.
- Kapitel drei widmet sich den ethischen und moralischen Überlegungen, die für die Legitimität von Humanitären Interventionen sprechen. Es werden die grundlegenden Werte und Prinzipien diskutiert, die diese Interventionsform begründen.
- Kapitel vier behandelt die Frage nach der völkerrechtlichen Legalität von Humanitären Interventionen. Hierbei werden die relevanten Normen des Völkerrechts, insbesondere das Gewaltverbot der Charta der Vereinten Nationen, sowie die Ausnahmen von diesem Verbot analysiert.
Schlüsselwörter
Humanitäre Intervention, Völkerrecht, Menschenrechte, Gewaltverbot, Souveränität, Legitimität, Legalität, Internationale Politik, Sicherheitsrat, UN-Charta, Krieg, Genozid, Vertreibung, Menschenrechtsverletzung, ethische Wertvorstellungen, politischer Entscheidungsprozess.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter einer Humanitären Intervention?
Es handelt sich um ein bewaffnetes Eingreifen in die Souveränität eines Staates, um massive Menschenrechtsverletzungen zu verhindern oder zu beenden.
Ist eine militärische Intervention völkerrechtlich legal?
Die Arbeit untersucht das Spannungsverhältnis zwischen dem Gewaltverbot der UN-Charta und dem Schutz elementarer Menschenrechte.
Wann ist eine humanitäre Intervention moralisch gerechtfertigt?
Eine Rechtfertigung ist gegeben, wenn das Recht auf Leben und Freiheit systematisch gebrochen wird und massive Verbrechen unmittelbar bevorstehen.
Wer ist zur Durchführung einer solchen Intervention berechtigt?
Es wird diskutiert, ob nur die Vereinten Nationen (Sicherheitsrat) oder im Extremfall auch einzelne Staaten (unilateral) dazu berechtigt sind.
Welche Rolle spielt die staatliche Souveränität?
Die Arbeit prüft Tendenzen, nach denen Souveränität ein Eingreifen bei drohendem Genozid oder Vertreibung nicht verhindern darf.
Gibt es eine politische Pflicht zur Intervention?
Aus politikwissenschaftlicher Sicht wird untersucht, ob sich für Entscheidungsträger eine moralische Pflicht zur Hilfeleistung ableiten lässt.
- Citar trabajo
- Robert Rädel (Autor), 2003, Humanitäre Intervention. Die Legitimität und Legalität der Durchsetzung von Menschenrechten mit militärischen Mitteln, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/15770