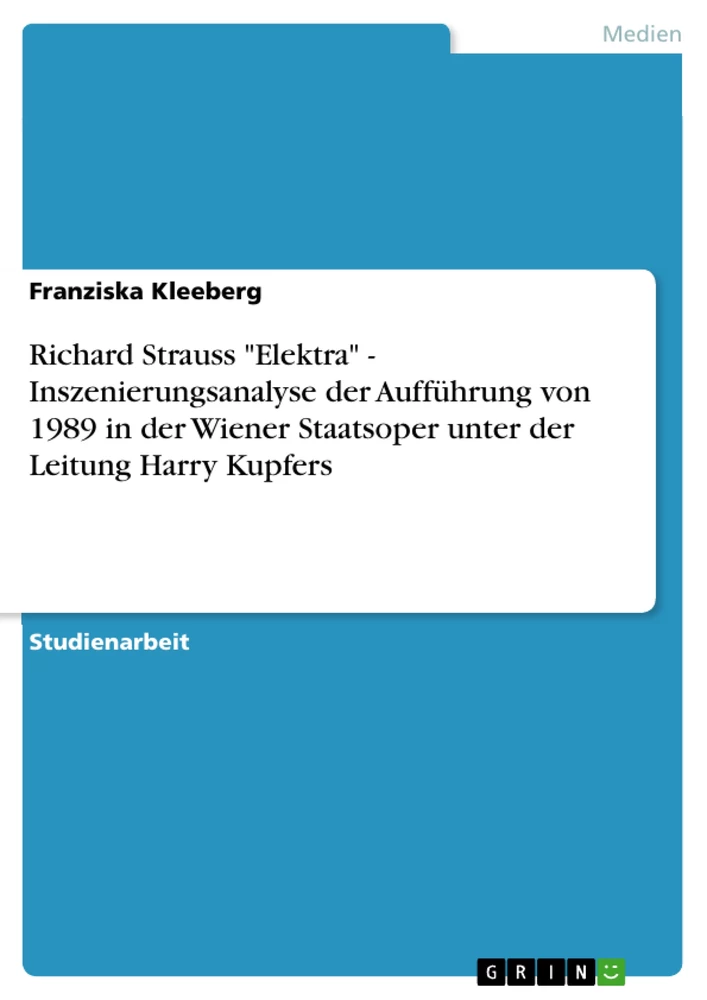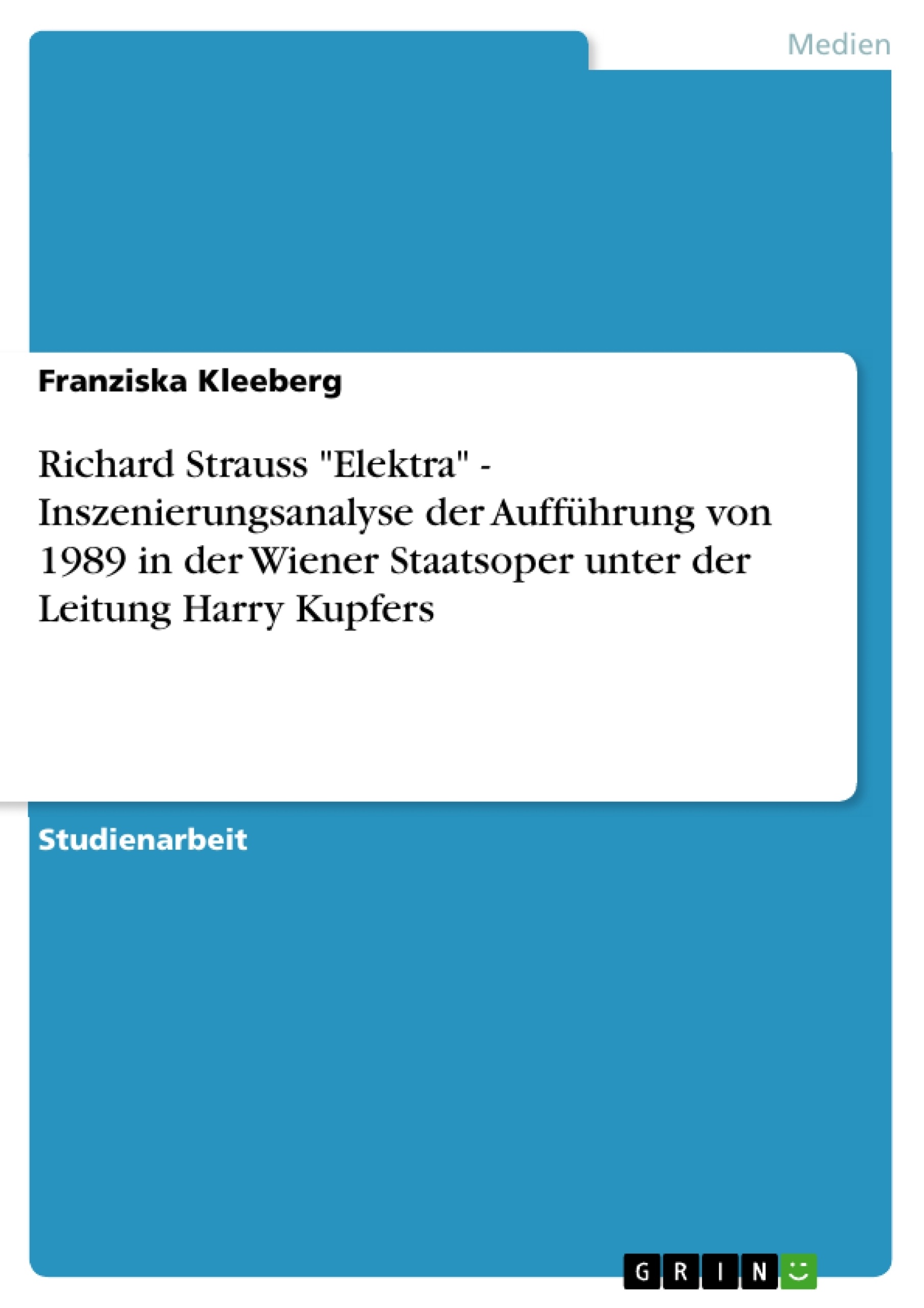1 Einleitung
1909 schuf Richard Strauss mit der einaktigen Symphonieoper „Elektra“ das wahrscheinlich wichtigste musiktheatralische Werk seines kompositorischen Werdegangs. Nicht selten hört man die These, vorhergehende und folgende Opernwerke des deutschen Musikers hätten in ihrer Ausdrucksstärke
nicht mehr an die opulente und emotionsgeladene Musikalität der „Elektra“ anknüpfen können, weshalb sie einen Höheund Wendepunkt in Strauss’ Schöpfung darstelle.
Inspiriert zu seiner Komposition wurde Strauss von der psychoanalytischen Verarbeitung des sophokleischen Stoffes durch Hugo von Hofmannsthal in dessen gleichnamigen Theaterstück von 1905. Dieser steuerte auch, auf Bitten Strauss’, das Libretto zu der Oper „Elektra“ bei. Die neuartige Interpretation hat weniger die Schilderung der dramatischen Handlung als vielmehr das Aufzeigen der verschiedenen Charaktere und ihrer „Zwiespältigkeit“ im Umgang mit dem Geschehenen und sich selbst zum Gegenstand. Nennenswert ist diese Rezeptionsgeschichte, da sich Harry Kupfer, deutscher
Theaterwissenschaftler und bekannter Opernregisseur, in seiner Inszenierung für die Wiener Festspielwochen von 1989 davon inspirieren und leiten ließ.
Die folgende Arbeit möchte sich mit einer Analyse dieser Inszenierung auseinandersetzen und eines von vielen, möglichen Ästhetikkonzepten der Praxis im Umgang mit Musiktheater untersuchen.
Der eigentlichen Analyse vorangestellt wird ein kurzer Abriss der Rezeptionsgeschichte der Oper „Elektra“, um anschließend, darauf aufbauend, detailliert auf die Inszenierung Harry Kupfers eingehen zu können. Nach der Vorstellung von Kupfers allgemeinem Inszenierungskonzept, das auch seiner Arbeit mit der Oper „Elektra“ zu Grunde liegt, soll die Aufführung von 1989 betrachtet werden, wobei der Schwerpunkt auf die Figurenpsychologie gelegt wurde. Als kontextuelle Elemente werden dabei auch Raum und Handlungsweise in die Darstellung mit einbezogen.
Schlussendlich werden in zeitgenössischen Musik(fach)zeitschriften erschienene Rezensionen vorgestellt, an denen die verschiedenen Wirkungsweisen der Inszenierung sowie das Ästhetikempfindungen des Einzelnen (Kritikers) gezeigt werden sollen.
2 Entstehungshintergrund der Oper „Elektra“
1905 brachte Hugo von Hofmannsthal seine Tragödie „Elektra“, eine Bearbeitung des antiken Dramas von Sophokles, im Berliner „Kleinen Theater“ in einer Inszenierung Max Reinhardts auf die Bühne...
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Entstehungshintergrund der Oper „Elektra“
- Hofmannsthals Interpretation des Elektra-Stoffes
- Die musikalische Bearbeitung durch Richard Strauss
- Das Inszenierungskonzept Harry Kupfers
- Die Inszenierung der „Elektra“ an der Wiener Staatsoper 1989
- Intention Kupfers
- Das Bühnenbild
- Die Maske
- Die Protagonisten
- Elektra
- Klytämnestra
- Chrysothemis
- Die Männerfiguren
- Die Spielweise
- Zeitgenössische Rezensionen zu der Aufführung „Elektras“ 1989
- Schlussbetrachtungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Inszenierung von Richard Strauss' Oper „Elektra“ durch Harry Kupfer in den Wiener Festspielwochen 1989. Sie untersucht Kupfers Inszenierungskonzept und beleuchtet, wie er den sophokleischen Stoff in einer zeitgemäßen Interpretation präsentiert.
- Die psychologische Ebene der Figuren im Kontext von Hofmannsthals und Strauss' Interpretation des Elektra-Mythos
- Kupfers Inszenierungskonzept und seine Umsetzung in der Wiener Staatsoper
- Die Rolle von Bühnenbild, Maske und Kostümen in der Inszenierung
- Die Darstellung der Protagonisten und ihre Beziehung zueinander
- Die Rezeption der Inszenierung durch zeitgenössische Rezensionen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel stellt die Oper „Elektra“ und ihre Bedeutung in Richard Strauss' Schaffen vor. Kapitel 2 beleuchtet den Entstehungshintergrund der Oper und die Rolle von Hugo von Hofmannsthal als Librettist. Es analysiert Hofmannsthals Interpretation des Elektra-Stoffes im Hinblick auf die psychologische Ebene der Figuren sowie Strauss' musikalische Umsetzung dieser Interpretation. Kapitel 3 widmet sich dem Inszenierungskonzept Harry Kupfers, bevor Kapitel 4 die konkrete Umsetzung in der Wiener Staatsoper 1989 fokussiert. Hier werden insbesondere die Inszenierungsmerkmale, die Charakterdarstellungen und die Beziehung der Figuren zueinander analysiert.
Schlüsselwörter
Richard Strauss, Elektra, Oper, Inszenierung, Harry Kupfer, Wiener Staatsoper, Hofmannsthal, Psychoanalyse, Figurenpsychologie, Bühnenbild, Maske, Kostüm, Rezension, Zeitgenössische Kritik
Häufig gestellte Fragen
Warum gilt „Elektra“ als Wendepunkt in Richard Strauss’ Schaffen?
Die Oper zeichnet sich durch eine opulente, emotionsgeladene Musikalität aus, die in ihrer Ausdrucksstärke als Höhepunkt seines kompositorischen Werks gilt.
Welche Rolle spielte Hugo von Hofmannsthal?
Er verarbeitete den antiken Stoff von Sophokles psychoanalytisch und schrieb auf Wunsch von Strauss das Libretto zur Oper.
Was zeichnet Harry Kupfers Inszenierung von 1989 aus?
Kupfer legte den Schwerpunkt auf die Figurenpsychologie und die Zwiespältigkeit der Charaktere, unterstützt durch ein spezifisches Bühnenbild und Maskenkonzept.
Wie wird die Figur der Elektra in der Arbeit analysiert?
Die Analyse betrachtet Elektras psychologische Verfassung und ihre Beziehungen zu Klytämnestra und Chrysothemis im Kontext der Inszenierung.
Wie reagierte die Kritik auf die Aufführung an der Wiener Staatsoper?
Die Arbeit stellt zeitgenössische Rezensionen vor, die die unterschiedlichen Wirkungsweisen und das Ästhetikempfinden der Kritiker widerspiegeln.
- Citar trabajo
- Franziska Kleeberg (Autor), 2008, Richard Strauss "Elektra" - Inszenierungsanalyse der Aufführung von 1989 in der Wiener Staatsoper unter der Leitung Harry Kupfers, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/157702