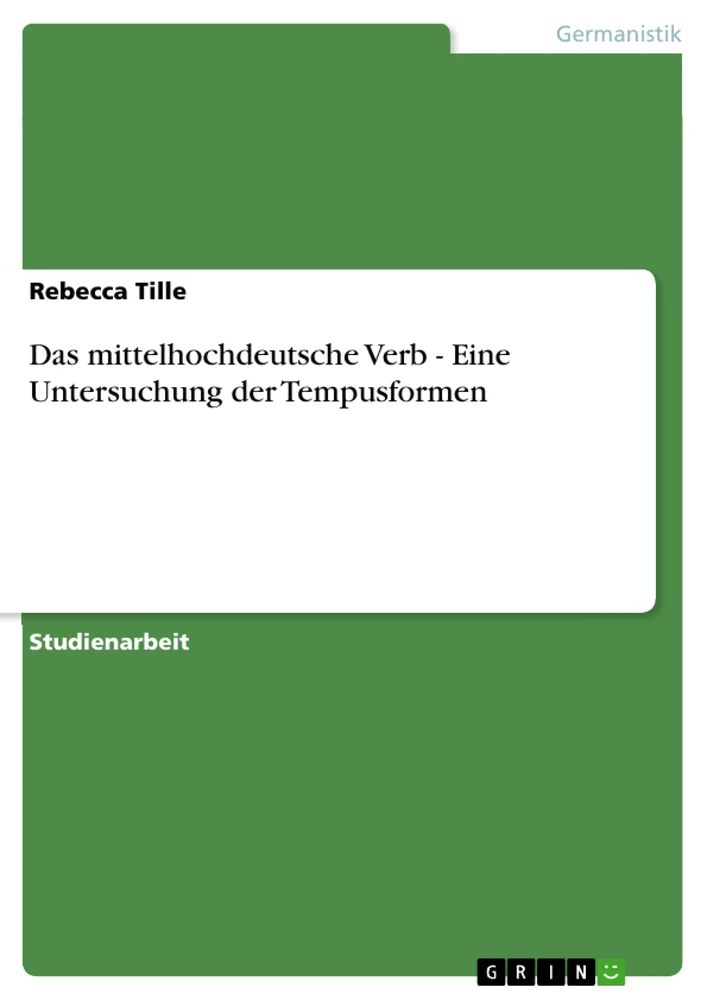In der vorliegenden Hausarbeit soll das mittelhochdeutsche Verb eingehend hinsichtlich seiner Tempuslehre betrachtet sowie analysiert und anhand von ausgewählten Beispielen veranschaulicht werden. Die Analyse orientiert sich hauptsächlich an der aktuellen Mittelhochdeutschen Grammatik von Hermann Paul.
Das Mittelhochdeutsche hat wie das Althochdeutsche zwei synthetisch gebildete Tempora: Präsens und Präteritum, welche durch morphologische Markierungen am Wortstamm gebildet werden. Diese Tempora werden mit sogenannten einfachen Formen wiedergegeben und stellen mehrere Zeitbereiche dar. Des Weiteren bilden sich erst im späten Mittelalter drei zusammengesetzte Formen aus, die in dieser Arbeit unterschieden werden sollen. Und zwar das Perfekt, Plusquamperfekt und Futur, welche ähnlich wie im Neuhochdeutschen nur durch periphrastische Bildungen umschrieben werden können. Hierbei wird das Hilfsverb konjugiert und mit infiniten Formen eines Verbs kombiniert. Während sich beispielsweise das mittelhochdeutsche Perfekt auf die Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft beziehen kann, bezeichnet das Plusquamperfekt hingegen lediglich die Vorvergangenheit.
Auch der Infinitiv Perfekt, welcher sich erst seit der Mitte des 12. Jahrhunderts entwickelte, soll eine Darstellung erfahren. Wohingegen der Gebrauch des Infinitiv Präsens wesentlich älter ist, welcher mit Hilfe eines Beispiels veranschaulicht werden soll. Es folgt eine ausführliche Betrachtung des umschriebenen Futurs hinsichtlich seiner Kombinationen sol, muoz, und wil mit Infinitiv sowie der Umschreibung mit werden.
Alles in allem sollen in der Arbeit die verschiedenen Bedeutungsvarianten der Tempora Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt und Futur ausführlich vorgestellt werden. Im Verlaufe der Untersuchung werden ebenso einige Besonderheiten herauskristallisiert, wie beispielsweise die Bedeutungsvariante des Präsens, die als generelles (atemporales) Präsens bezeichnet wird, und somit eine Ausnahme bildet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Einfache Formen
- Präsens
- Die zeitliche Gegenwart
- Atemporales Präsens
- Die Vergangenheit (historisches Präsens)
- Zukünftiges Geschehen (futurisches Präsens)
- Das Präteritum
- Episches Präteritum
- Präteritum mit Perfektbedeutung
- Präteritum mit Plusquamperfektbedeutung
- Gnomisches Präteritum
- Präteritales Futur
- Präsens
- Zusammengesetzte Formen
- Die Umschreibung des Perfekts und Plusquamperfekts
- Das umschriebene Perfekt
- Das umschriebene Plusquamperfekt
- Der Infinitiv Perfekt
- Das umschriebene Futur
- sol mit Infinitiv
- muoz mit Infinitiv
- wil mit Infinitiv
- Umschreibungen mit werden
- Die Umschreibung des Perfekts und Plusquamperfekts
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem mittelhochdeutschen Verb und analysiert dessen Tempuslehre anhand von ausgewählten Beispielen. Der Fokus liegt dabei auf der aktuellen Mittelhochdeutschen Grammatik von Hermann Paul. Die Arbeit untersucht die verschiedenen Bedeutungsvarianten der Tempusformen Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt und Futur, wobei auch Besonderheiten wie das atemporale Präsens beleuchtet werden.
- Analyse der Tempusformen im Mittelhochdeutschen
- Untersuchung der morphologischen Bildung einfacher Formen (Präsens, Präteritum)
- Beschreibung der periphrastischen Bildung zusammengesetzter Formen (Perfekt, Plusquamperfekt, Futur)
- Bedeutung und Gebrauch der verschiedenen Tempusformen in unterschiedlichen Kontexten
- Hervorhebung von Besonderheiten und Ausnahmen innerhalb der Tempuslehre
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung gibt einen Überblick über das Thema der Arbeit und stellt die verwendeten Quellen und Methoden vor.
- Kapitel 2 befasst sich mit den einfachen Formen des mittelhochdeutschen Verbs, Präsens und Präteritum, und erläutert deren verschiedenen Bedeutungsvarianten. Dazu zählen die zeitliche Gegenwart, das atemporale Präsens, das historische Präsens und das futurisches Präsens. Weiterhin werden die verschiedenen Bedeutungsvarianten des Präteritums, wie das epische Präteritum, das Präteritum mit Perfekt- und Plusquamperfektbedeutung sowie das gnomische Präteritum und das Präteritale Futur, beleuchtet.
- Kapitel 3 behandelt die zusammengesetzten Formen des mittelhochdeutschen Verbs. Es werden die Umschreibungen des Perfekts und Plusquamperfekts sowie der Infinitiv Perfekt und das umschriebene Futur mit seinen verschiedenen Kombinationen (sol, muoz, wil mit Infinitiv sowie die Umschreibung mit werden) dargestellt.
Schlüsselwörter
Mittelhochdeutsches Verb, Tempusformen, Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futur, einfache Formen, zusammengesetzte Formen, periphrastische Bildung, atemporales Präsens, historisches Präsens, episches Präteritum, Infinitiv Perfekt, umschriebenes Futur, Hermann Paul, Mittelhochdeutsche Grammatik.
Häufig gestellte Fragen
Welche Zeitformen (Tempora) gab es im Mittelhochdeutschen?
Es gab die einfachen Formen Präsens und Präteritum sowie die zusammengesetzten Formen Perfekt, Plusquamperfekt und Futur.
Was ist das „atemporale Präsens“?
Dies ist eine Bedeutungsvariante des Präsens, die allgemeingültige Wahrheiten ausdrückt, die unabhängig von einem spezifischen Zeitpunkt gelten.
Wie wurde das Futur im Mittelhochdeutschen umschrieben?
Es wurde durch Kombinationen von Hilfsverben wie „sol“, „muoz“, „wil“ oder „werden“ mit einem Infinitiv gebildet.
Was unterscheidet das Präteritum vom Perfekt im Mittelhochdeutschen?
Das Präteritum ist eine einfache synthetische Form, während das Perfekt eine zusammengesetzte periphrastische Form ist, die sich erst später voll entwickelte.
Was bedeutet „historisches Präsens“?
Dabei wird die Präsensform verwendet, um Ereignisse zu beschreiben, die eigentlich in der Vergangenheit liegen, oft um die Erzählung lebendiger zu gestalten.
Auf welcher Grammatik basiert die Analyse in dieser Arbeit?
Die Untersuchung orientiert sich maßgeblich an der Mittelhochdeutschen Grammatik von Hermann Paul.
- Citar trabajo
- Rebecca Tille (Autor), 2010, Das mittelhochdeutsche Verb - Eine Untersuchung der Tempusformen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/157729