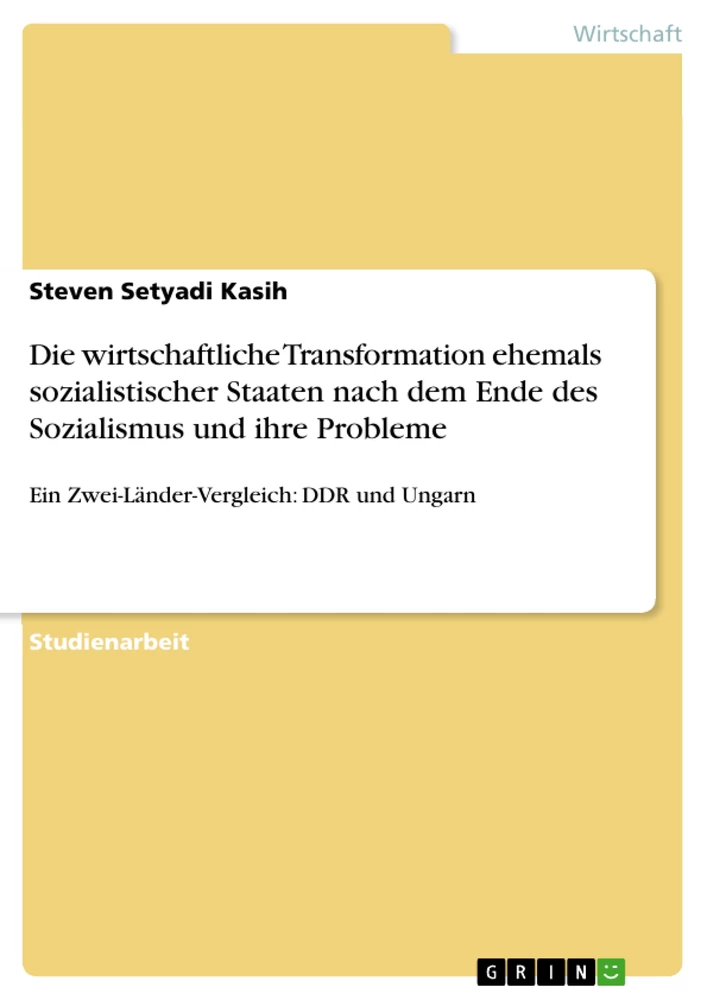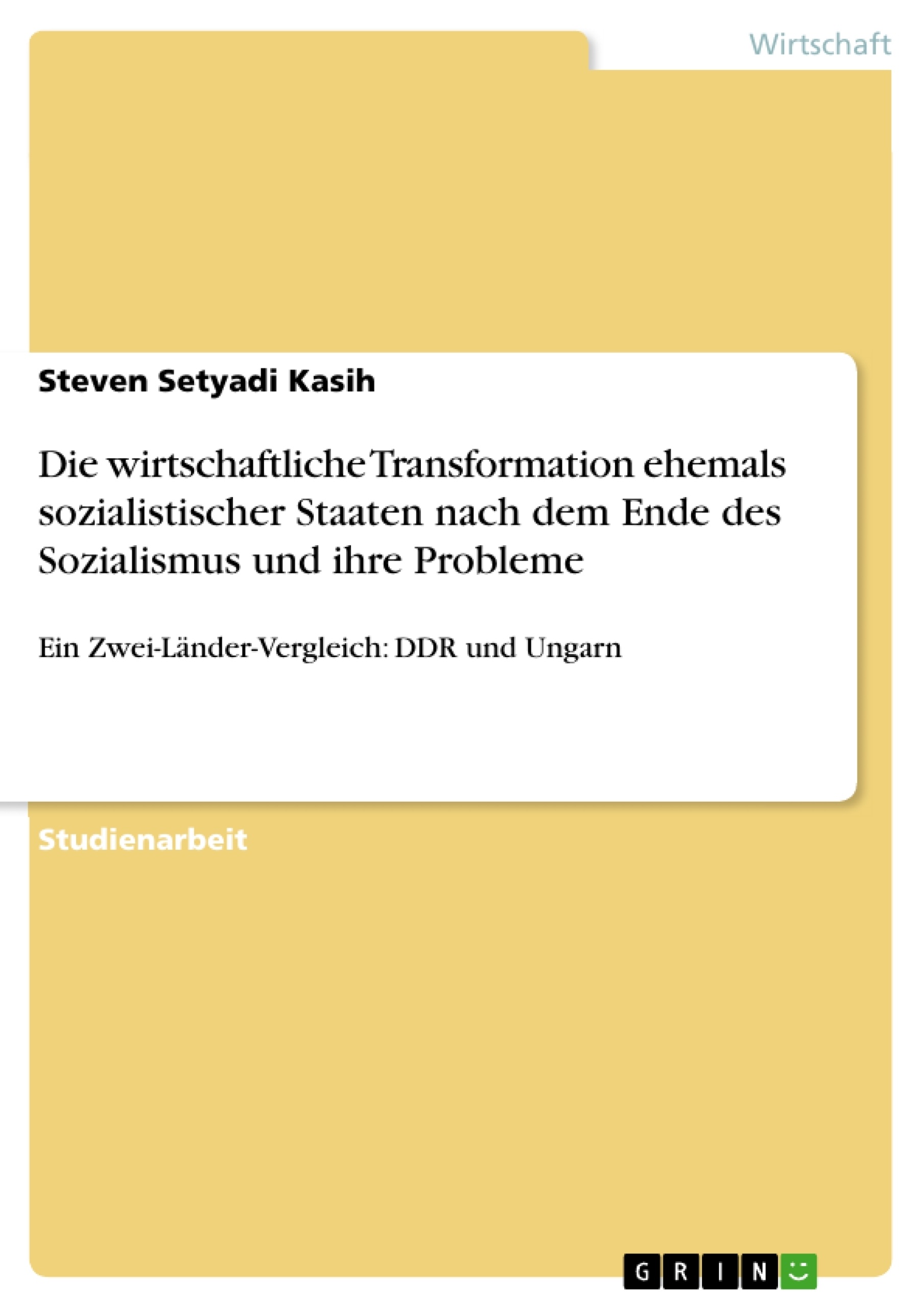Seit Errichtung des Eisernen Vorhangs standen der Sozialismus und die Demokratie in stetem Wettkampf um die Vorherrschaft der Systeme. Im Laufe der Zeit wurde jedoch schnell deutlich, dass ein kollektivistisches und von oben gesteuertes Wirtschaftssystem nicht die Anreize liefern kann, Wachstum, Wohlstand und die Steigerung des Lebensstandards der breiten Bevölkerung sicherzustellen. Ende der 1980er Jahre kam es schließlich zur Systemtransformation in den Ostblockstaaten und zu dem Ende des Sozialismus in Osteuropa.
Der in allen postsozialistischen Ländern einsetzende wirtschaftliche Transformationsprozess nahm in jeder dieser Volkswirtschaften einen anderen Verlauf. In manchen verlief er relativ schnell, in anderen mit weniger Problemen behaftet.
Mit dieser Arbeit werden exemplarisch die ehemalige Deutsche Demokratische Republik (DDR) und die Republik Ungarn in Bezug auf den wirtschaftlichen Transformationsprozess und den daraus resultierenden krisenhaften Entwicklungen in einem Zeitfenster von 1989 bis 1995 näher betrachtet. Der Vergleich der beiden Länder bietet sich aufgrund der unterschiedlichen Ausprägung und Sequenz der jeweiligen wirtschaftlichen Transformationsprozesse besonders an.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Gang der Untersuchung
- Grundlagen der wirtschaftlichen Transformation
- Die wirtschaftliche Transformation und die daraus resultierenden Probleme in der DDR
- Die wirtschaftliche Wiedervereinigung – Der Transformationsprozess von der Plan- zur Marktwirtschaft
- Die Wirtschafts- und Währungsunion als Garant von Wettbewerb, monetärer Stabilität und materieller Sicherheit
- Die Festlegung des Umrechnungskurses zwischen DDR- und D-Mark
- Die Privatisierung ostdeutscher Betriebe im Zeichen der Treuhandanstalt
- Die Auswirkungen der Wiedervereinigung auf die Wirtschaftskraft der neuen Bundesländer und die Transformationskrise
- Die Überbewertung des ostdeutschen Kapitalstocks
- Die De-Industrialisierung in den neuen Bundesländern
- Die Auswirkung der Wirtschaftstransformation auf die Lohndynamik in den neuen Bundesländern
- Der ökonomische Aufholprozess der neuen Bundesländer
- Die wirtschaftliche Transformation und die daraus resultierenden Probleme in Ungarn
- Frühe Wirtschaftsreformen als Wegbereiter des Transformationsprozesses und der Übergang zur Marktwirtschaft
- „Der Dritte Weg“ zwischen Plan- und Marktwirtschaft
- Die Reform des ungarischen Bankensystems
- Die monetäre Stabilisierungspolitik in Ungarn
- Die Transformationskrise der ungarischen Wirtschaft
- Die verpasste Chance einer Währungsreform
- Der Einbruch der Wirtschaftsaktivitäten
- Ansätze zur Überwindung der Transformationskrise – Der ökonomische Aufholprozess Ungarns
- DDR und Ungarn im Zwei-Länder-Vergleich
- Gemeinsamkeiten
- Unterschiede
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Seminararbeit untersucht die wirtschaftliche Transformation ehemals sozialistischer Staaten nach dem Ende des Sozialismus. Im Mittelpunkt steht dabei der Vergleich der wirtschaftlichen Entwicklungen der DDR und Ungarns von 1989 bis 1995. Die Arbeit analysiert die jeweiligen Transformationsprozesse, die daraus resultierenden Krisen sowie die Bemühungen um einen ökonomischen Aufholprozess.
- Der Transformationsprozess von der Plan- zur Marktwirtschaft in der DDR und Ungarn
- Die Herausforderungen und Probleme der wirtschaftlichen Transformation in beiden Ländern
- Der Vergleich der Transformationserfahrungen und -ergebnisse in der DDR und Ungarn
- Die Rolle staatlicher Intervention und privater Initiative in der wirtschaftlichen Entwicklung
- Die Auswirkungen der Transformation auf die Lebensbedingungen der Bevölkerung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problemstellung der Arbeit dar und skizziert den Gang der Untersuchung. Im Anschluss werden die Grundlagen der wirtschaftlichen Transformation erläutert, wobei der Begriff der Transformation definiert und die Voraussetzungen für einen erfolgreichen Übergang zur Marktwirtschaft beschrieben werden.
Das dritte Kapitel widmet sich der wirtschaftlichen Transformation in der DDR, wobei die Wiedervereinigung als entscheidender Faktor im Transformationsprozess dargestellt wird. Es werden die Wirtschafts- und Währungsunion, die Privatisierung ostdeutscher Betriebe und die Auswirkungen der Wiedervereinigung auf die Wirtschaftskraft der neuen Bundesländer sowie die Transformationskrise beleuchtet.
Im vierten Kapitel wird der wirtschaftliche Transformationsprozess in Ungarn analysiert. Die Arbeit fokussiert auf die frühen Wirtschaftsreformen, den Übergang zur Marktwirtschaft und die Transformationskrise. Dabei werden die verpasste Chance einer Währungsreform, der Einbruch der Wirtschaftsaktivitäten sowie Ansätze zur Überwindung der Transformationskrise und der ökonomische Aufholprozess thematisiert.
Der fünfte Gliederungspunkt stellt die wirtschaftlichen Transformationsprozesse in der DDR und Ungarn einander gegenüber und zeigt Gemeinsamkeiten und Unterschiede auf.
Das Kapitel "Fazit" wird in dieser Vorschau nicht berücksichtigt, um Spoiler zu vermeiden.
Schlüsselwörter
Wirtschaftliche Transformation, Sozialismus, Marktwirtschaft, DDR, Ungarn, Wiedervereinigung, Wirtschafts- und Währungsunion, Privatisierung, Transformationskrise, Ökonomischer Aufholprozess, Planwirtschaft, Marktwirtschaftliche Koordinationsmechanismen, Privatrechtsordnung.
Häufig gestellte Fragen
Was war das Ziel der wirtschaftlichen Transformation nach 1989?
Das Ziel war der Übergang von einer zentral gesteuerten Planwirtschaft zu einer marktwirtschaftlichen Ordnung, um Wachstum und Wohlstand zu steigern.
Welche Rolle spielte die Treuhandanstalt in der DDR?
Die Treuhandanstalt war für die Privatisierung der ehemals staatseigenen Betriebe der DDR verantwortlich, um diese in die soziale Marktwirtschaft zu integrieren.
Was versteht man unter dem "Dritten Weg" in Ungarn?
Ungarn versuchte bereits früh durch Wirtschaftsreformen einen Mittelweg zwischen Plan- und Marktwirtschaft zu finden, was den späteren Transformationsprozess beeinflusste.
Was ist eine Transformationskrise?
Es bezeichnet den wirtschaftlichen Einbruch (z.B. De-Industrialisierung, Arbeitslosigkeit), der während des Systemwechsels durch die plötzliche Konfrontation mit dem Weltmarkt entsteht.
Welche Auswirkungen hatte die Währungsunion in der DDR?
Die Einführung der D-Mark brachte materielle Sicherheit, führte aber durch den gewählten Umrechnungskurs auch zu einer Überbewertung des ostdeutschen Kapitals und Wettbewerbsproblemen.
- Quote paper
- Steven Setyadi Kasih (Author), 2009, Die wirtschaftliche Transformation ehemals sozialistischer Staaten nach dem Ende des Sozialismus und ihre Probleme, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/157758