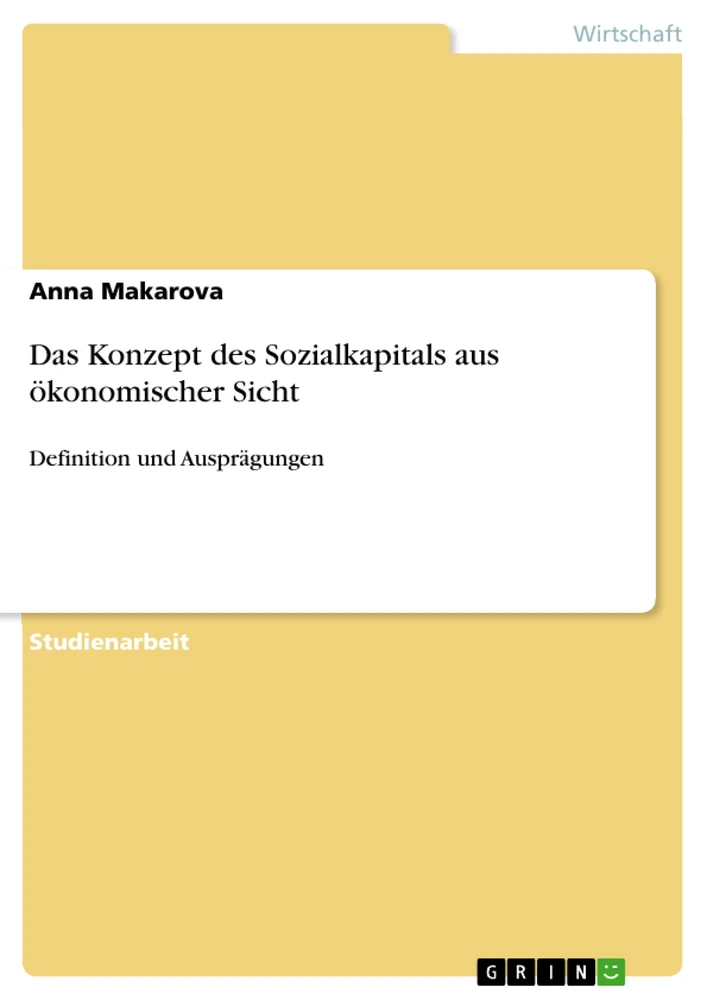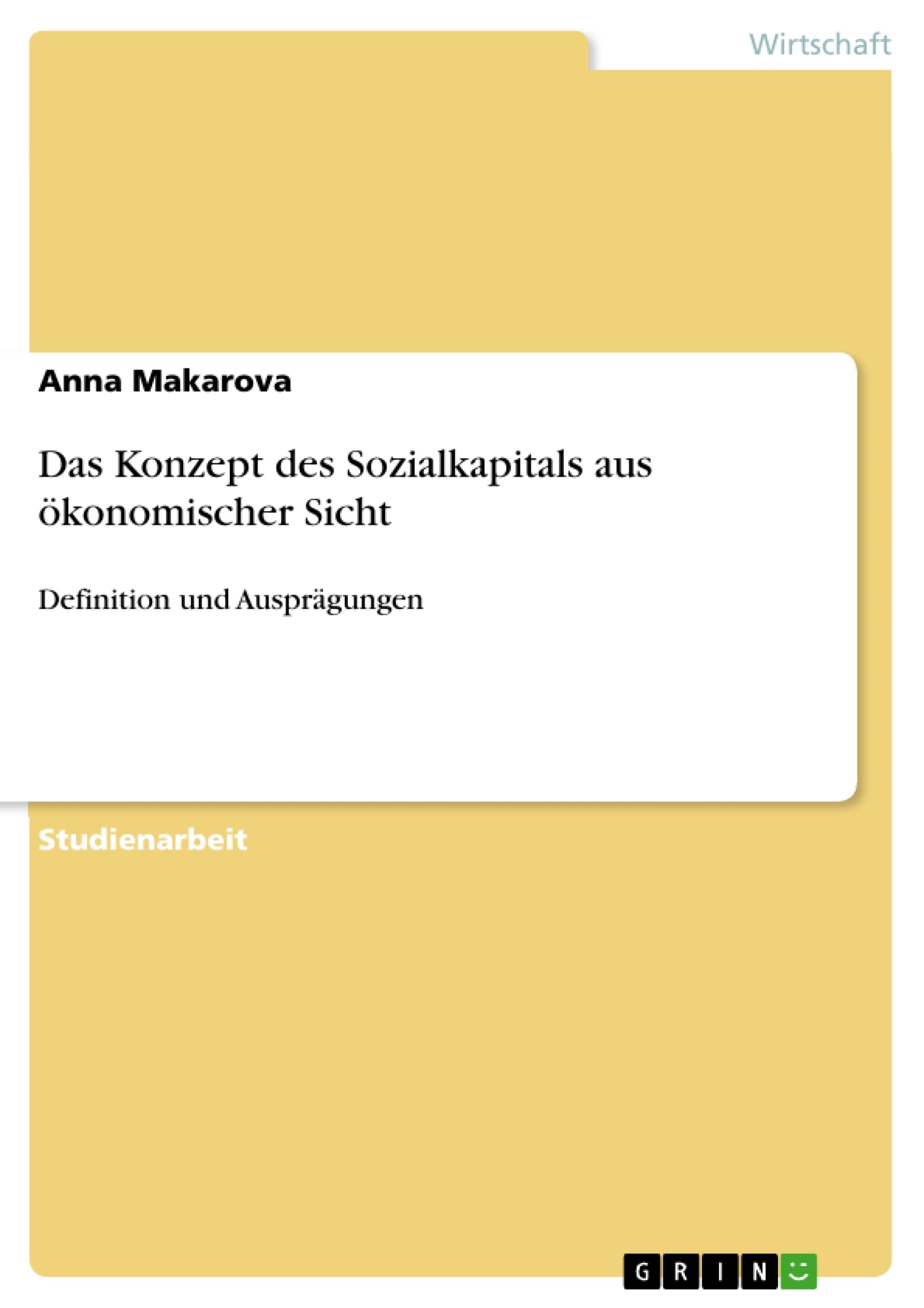In der vorliegenden Arbeit soll das Konzept des Sozialkapitals aus ökonomischer Sicht dargestellt werden. Um sich Klarheit über die Funktionen, sich ergebende Bestimmungsfaktoren oder Effekte von Sozialkapital in der Wirtschaft zu gewinnen, ist es daher wichtig die Vielzahl der Konzepte zu strukturieren.
Im ersten Kapitel wird erklärt, was unter Sozialkapital zu verstehen ist. Dabei wird das Problem einer eindeutigen Definition des Begriffs Sozialkapital angesprochen. Außerdem wird die Frage beantwortet, warum Sozialkapital Kapital darstellt und welche Besonderheiten dieses in Vergleich zu anderen Kapitalarten aufweist.
In der Literatur lassen sich zwei Hauptansätze unterscheiden, die Sozialkapital auf zwei Ebenen analysieren:
Auf der individuellen Ebene (Mikro-Ebene) tritt Sozialkapital als Beziehungsgröße von Individuen und somit als Wert sozialer Beziehungen, die Individuen für das Verfolgen ihrer persönlichen Ziele einsetzen, auf.
Auf der gesellschaftlichen Ebene (Makro-Ebene) wird Sozialkapital als kollektives Gut angesehen.
Unabhängig von der jeweiligen Ebene (individuelle oder gesellschaftliche Ebene) besteht der Wert des Sozialkapitals aus den positiven Effekten für die einzelnen Mitglieder und für die Gruppe als Ganzes (vgl. Seubert, 2007: 13).
Da die beiden Ebenen (individuelle bzw. gesellschaftliche Ebene) zusammenhängen und sich einander ergänzen, treffen die Elemente bzw.
Ausprägungen des Sozialkapitals auf beide Ebenen zu. Auf die Elemente bzw. Ausprägungen des Sozialkapitals wird im zweiten Teil der Arbeit eingegangen. Anschließend werden die Auswirkungen des Sozialkapitals hinsichtlich Wirtschaftswachstum, nachhaltiger Entwicklung und Bürgerschaft dargestellt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Was ist Sozialkapital?
- Probleme der einheitlichen Definition
- Ist Sozialkapital ein Kapital?
- Ebenen des Sozialkapitals
- Mikro-Ebene (Individuelle Ebene)
- Makro-Ebene (Gesellschaftliche Ebene)
- Korrespondenz von Mikro- und Makroebene
- Elemente bzw. Ausprägungen des Sozialkapitals
- Soziale Netzwerk
- Horizontale und vertikale Netzwerke
- Formelle und informelle Beziehungen
- Starke und schwache Beziehungen
- Vertrauen
- Reziprozität
- Gemeinsame Normen und Werte
- Auswirkungen des Sozialkapitals für die Gesellschaft
- Sozialkapital und Wirtschaftswachstum
- Sozialkapital und nachhaltige Entwicklung
- Sozialkapital und Bürgergesellschaft
- Zusammenfassende Betrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Konzept des Sozialkapitals aus ökonomischer Sicht und beleuchtet dessen Funktionen, Bestimmungsfaktoren und Effekte in der Wirtschaft. Sie zielt darauf ab, die Vielfalt der Konzepte zu strukturieren, um Klarheit über die Bedeutung von Sozialkapital für den wirtschaftlichen Kontext zu gewinnen.
- Definition und Abgrenzung des Begriffs Sozialkapital
- Unterscheidung zwischen individuellen und gesellschaftlichen Ebenen des Sozialkapitals
- Analyse wichtiger Elemente und Ausprägungen des Sozialkapitals, wie z.B. soziale Netzwerke, Vertrauen und Reziprozität
- Bedeutung von Sozialkapital für Wirtschaftswachstum, nachhaltige Entwicklung und die Bürgergesellschaft
- Zusammenfassende Betrachtung der Rolle und Bedeutung von Sozialkapital in der Wirtschaft
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel befasst sich mit der Definition und Abgrenzung des Begriffs Sozialkapital. Es analysiert die Probleme einer einheitlichen Definition und diskutiert, warum Sozialkapital als Kapital betrachtet werden kann. Es werden die Besonderheiten des Sozialkapitals im Vergleich zu anderen Kapitalarten wie ökonomischem Kapital und Humankapital beleuchtet.
- Kapitel Zwei untersucht die verschiedenen Ebenen des Sozialkapitals, sowohl auf individueller als auch auf gesellschaftlicher Ebene. Es wird die Bedeutung von sozialen Netzwerken, Vertrauen und Reziprozität für die Entstehung und den Wert des Sozialkapitals herausgestellt.
- Kapitel Drei befasst sich mit den Auswirkungen des Sozialkapitals auf die Gesellschaft. Es analysiert die Verbindung zwischen Sozialkapital und Wirtschaftswachstum, nachhaltiger Entwicklung und der Stärkung der Bürgergesellschaft.
Schlüsselwörter
Sozialkapital, ökonomische Perspektive, Definition, Ebenen des Sozialkapitals, Mikro-Ebene, Makro-Ebene, soziale Netzwerke, Vertrauen, Reziprozität, Wirtschaftswachstum, nachhaltige Entwicklung, Bürgergesellschaft, Investitionen, Rendite.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Sozialkapital aus ökonomischer Sicht?
Aus ökonomischer Sicht stellt Sozialkapital den Wert sozialer Beziehungen dar, die Individuen oder Gruppen nutzen können, um ihre Ziele effizienter zu erreichen.
Was ist der Unterschied zwischen der Mikro- und Makro-Ebene des Sozialkapitals?
Die Mikro-Ebene betrachtet den Wert persönlicher Beziehungen für das Individuum. Die Makro-Ebene sieht Sozialkapital als kollektives Gut einer ganzen Gesellschaft (z.B. Institutionenvertrauen).
Warum wird Sozialkapital als "Kapital" bezeichnet?
Es wird als Kapital betrachtet, weil es durch Investitionen (Zeit, Pflege von Kontakten) aufgebaut wird und künftige Erträge oder Nutzen (Rendite) abwirft.
Welche Elemente bilden das Sozialkapital?
Zentrale Elemente sind soziale Netzwerke, Vertrauen, Reziprozität (Gegenseitigkeit) sowie gemeinsame Normen und Werte.
Wie beeinflusst Sozialkapital das Wirtschaftswachstum?
Hohes Sozialkapital senkt Transaktionskosten, fördert Innovationen durch Informationsaustausch und stabilisiert die wirtschaftliche Entwicklung einer Gesellschaft.
- Arbeit zitieren
- Anna Makarova (Autor:in), 2009, Das Konzept des Sozialkapitals aus ökonomischer Sicht , München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/157769