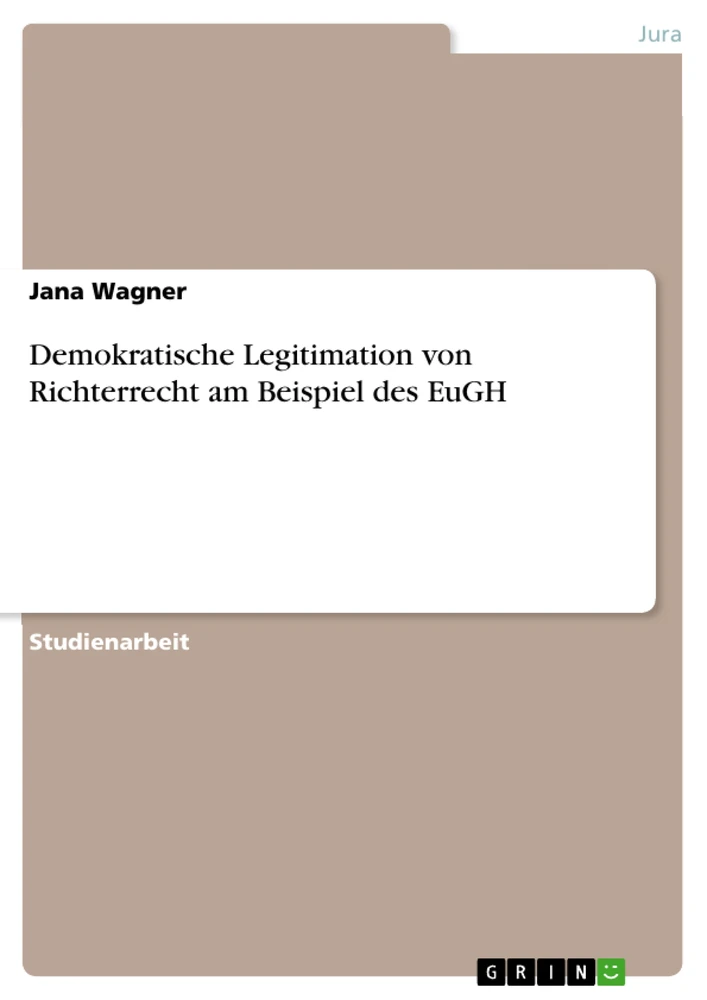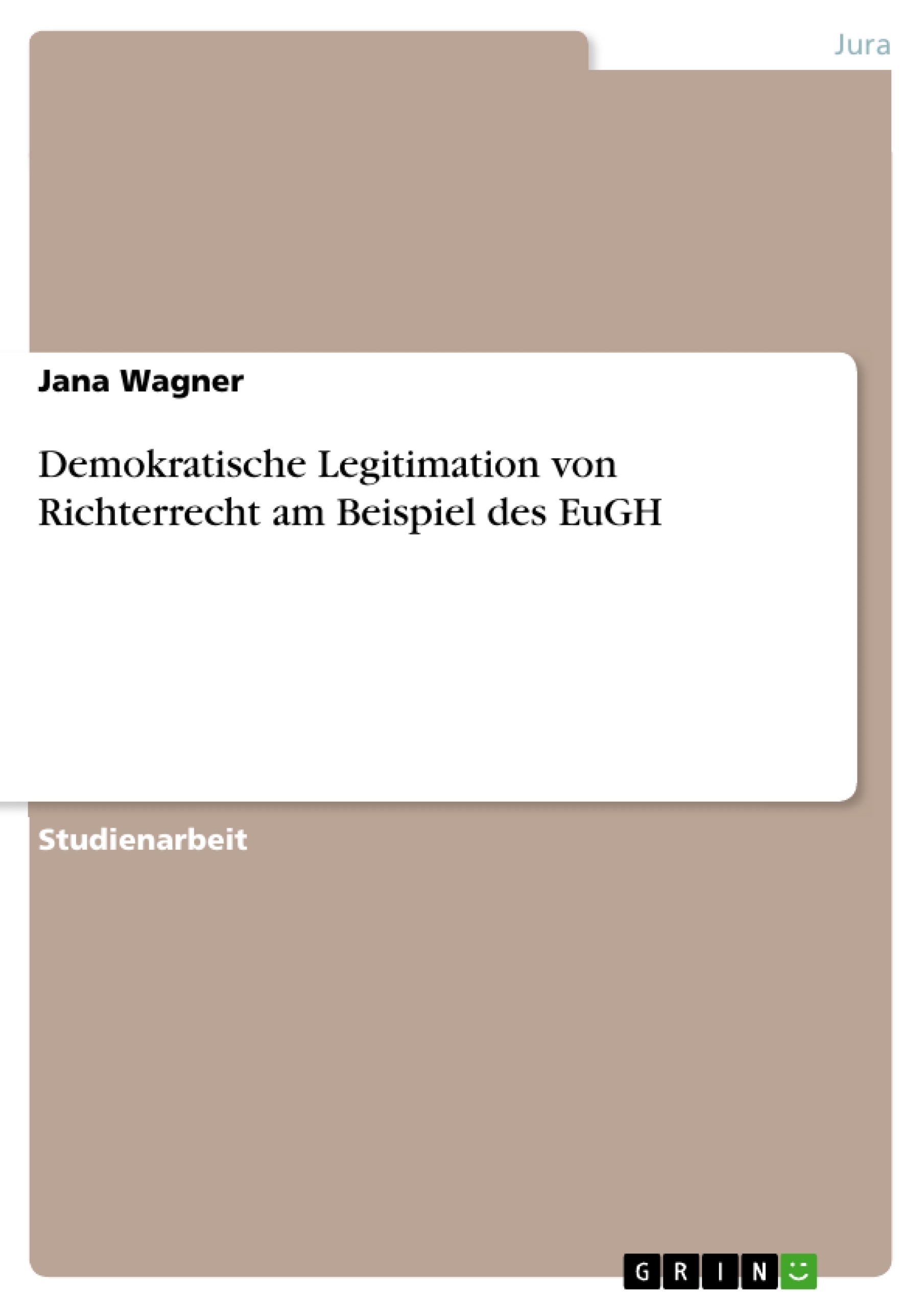Ob bzw. inwieweit die Europäische Union demokratisch legitimiert ist, stellt eine vieldiskutierte, unter unterschiedlichsten Gesichtspunkten beleuchtete und auf Grund ihrer großen Bedeutung für Millionen von Menschen äußerst wichtige Frage dar. Trotz der unterschiedlichen Positionen zu diesem Thema herrscht weitgehende Einigkeit darüber, dass es ein europäisches Demokratiedefizit, in welchem Ausmaß sei dahin gestellt, gibt (vgl. Dingwerth et al. 2010: 80; Blauberger 2010: 52). Besonders harsch wird Kritik bisweilen am Europäischen Gerichtshof formuliert, die in der Forderung der „Zerstörung“ des EuGH kumuliert (vgl. Frenz 2010: 669).
Hintergrund der Kritik ist die politische Rolle des EuGH als „Motor der Integration“, der maßgeblich an der Gestaltung der EU beteiligt ist (vgl. Dobler 2008: 510, 524; Frenz 2010: 666). Seinen Einfluss übt der EuGH aus, indem er Gesetze nicht nur auslegt, sondern selbst normsetzend wirkt. Dieses durch die Urteile des EuGH entstehende Richterrecht wird in der politikwissenschaftlichen Literatur vergleichsweise wenig beachtet (vgl. Schmidt 2008: 102).
Besonders die Frage nach der Legitimität solcher normsetzender Akte wird vor allem in der juristischen Diskussion gestellt (vgl. z. B. Dobler 2008; Bydlinski 1985). So es in der politikwissenschaftlichen Literatur doch Abwägungen über die demokratische Legitimität des Richterrechts gibt, basieren diese entweder auf der Gleichsetzung von Legitimität und Folgebereitschaft (vgl. z. B. Gibson/Caldeira 1998) oder, bei einer normativeren Herangehensweise, bleiben sie ohne klare Definition, welches denn die Kriterien für die Legitimation des von Richtern geschaffenen Rechts überhaupt sein könnten (vgl. z. B. Scharpf 2009). Sich über diese Kriterien im Klaren zu sein, ist jedoch notwendig zur Beurteilung der Praxis am EuGH, denn die Existenz von Richterrecht an sich kann, wie noch gezeigt werden wird, noch nicht als demokratisch unlegitimiert angesehen werden.
Der Versuch, anhand allgemeiner demokratietheoretischer Überlegungen Legitimationskriterien für Richterrecht herauszuarbeiten, soll nun in dieser Arbeit in Angriff genommen werden. Auf dieser Basis ist es dann möglich, das Richterrecht des EuGH auf seine demokratische Legitimität hin zu überprüfen.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG.
- RICHTERRECHT.
- RICHTERRECHT DEFINITION
- RICHTERRECHT BEIM EUGH
- LEGITIMATION AUS DEMOKRATIETHEORETISCHER SICHT
- DEFINITION DES BEGRIFFES DER LEGITIMATION
- DEMOKRATIETHEORETISCHE GRUNDLAGEN FÜR KRITERIEN DER LEGITIMATION VON RICHTERRECHT.
- DIE DEMOKRATISCHE LEGITIMATION DES UNIONSEUROPÄISCHEN RICHTERRECHTS.
- MÖGLICHKEIT DES ÖFFENTLICHEN DISKURSES
- PERSONELLE DEMOKRATISCHE LEGITIMATIONSKETTE.
- REVERSIBILITÄT.
- RECHTSSICHERHEIT.
- ZUSAMMENFASSENDE WERTUNG
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die demokratische Legitimität des Richterrechts des Europäischen Gerichtshofs (EuGH). Sie befasst sich mit der Frage, inwieweit die vom EuGH geschaffenen Normen im Einklang mit den Prinzipien der Demokratie stehen.
- Definition des Begriffs „Richterrecht“ und seine Ausprägung im Kontext des EuGH
- Analyse der demokratischen Legitimation aus theoretischer Perspektive
- Anwendung von Legitimationskriterien auf die Praxis des EuGH
- Bewertung der demokratischen Legitimität des europäischen Richterrechts
- Bedeutung des öffentlichen Diskurses und der Rechtssicherheit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der demokratischen Legitimität der Europäischen Union ein und beleuchtet die Kritik am Europäischen Gerichtshof im Kontext des europäischen Demokratiedefizits.
Das zweite Kapitel befasst sich mit der Definition des Begriffs „Richterrecht“ und zeigt die besondere Rolle des EuGH bei der Normsetzung auf.
Kapitel 3 setzt sich mit der Frage auseinander, was unter demokratischer Legitimität zu verstehen ist und beleuchtet die zugrundeliegenden Demokratiebegriffe.
Im vierten Kapitel werden die theoretischen Überlegungen anhand der Praxis des EuGH konkret untersucht. Es werden die Kriterien des öffentlichen Diskurses, der demokratischen Legitimationskette, der Reversibilität und der Rechtssicherheit in Bezug auf die Urteilsfindung des EuGH analysiert.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen der Arbeit sind: Richterrecht, Europäischer Gerichtshof (EuGH), demokratische Legitimation, Demokratiedefizit, öffentlicher Diskurs, Rechtssicherheit, Reversibilität, Rechtsfortbildung, Normsetzung, EU-Recht.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter dem Begriff „Richterrecht“?
Richterrecht bezeichnet die Normsetzung durch Gerichte, bei der Gesetze nicht nur ausgelegt, sondern durch Urteile neue rechtliche Standards geschaffen werden.
Warum steht der Europäische Gerichtshof (EuGH) in der Kritik?
Kritiker werfen dem EuGH vor, als „Motor der Integration“ politisch zu agieren und durch seine Rechtsprechung ein demokratisches Defizit zu verstärken.
Ist Richterrecht grundsätzlich demokratisch unlegitimiert?
Nein, die Arbeit zeigt auf, dass Richterrecht an sich nicht automatisch unlegitimiert ist, sofern bestimmte demokratische Kriterien erfüllt sind.
Welche Kriterien werden zur Prüfung der Legitimität des EuGH herangezogen?
Analysiert werden der öffentliche Diskurs, die personelle demokratische Legitimationskette, die Reversibilität der Urteile und die Rechtssicherheit.
Welche Rolle spielt die Reversibilität beim Richterrecht?
Reversibilität bedeutet, dass richterliche Entscheidungen durch den Gesetzgeber korrigiert werden können, was ein wichtiger Faktor für die demokratische Legitimation ist.
Was ist das Ziel dieser wissenschaftlichen Arbeit?
Das Ziel ist es, anhand demokratietheoretischer Überlegungen Legitimationskriterien für das Richterrecht des EuGH herauszuarbeiten und zu bewerten.
- Citation du texte
- Jana Wagner (Auteur), 2010, Demokratische Legitimation von Richterrecht am Beispiel des EuGH, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/157875