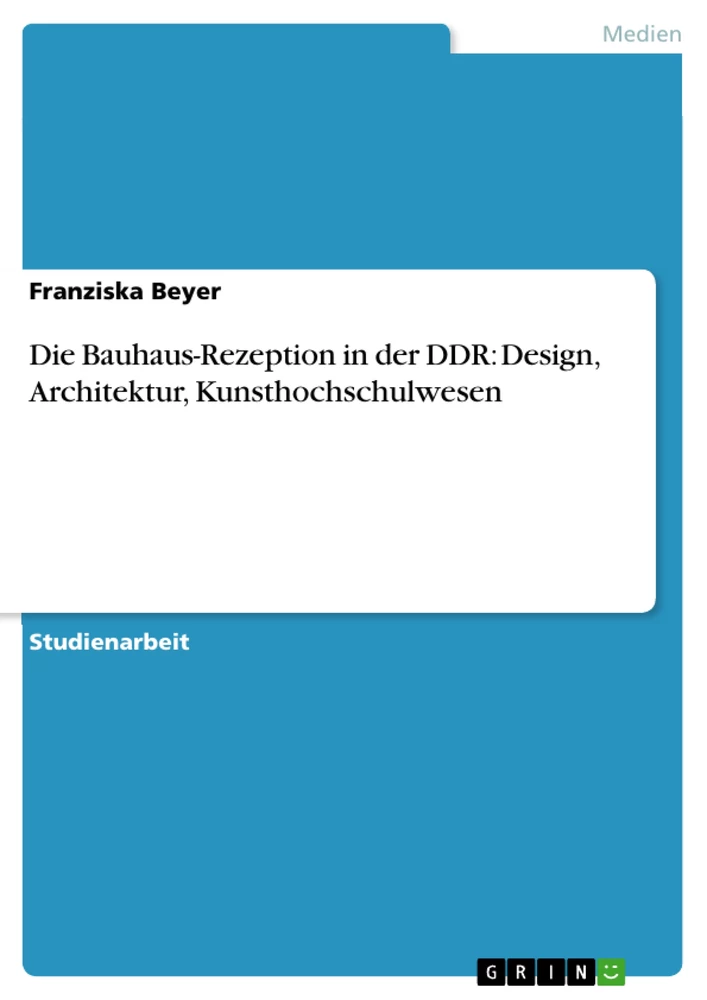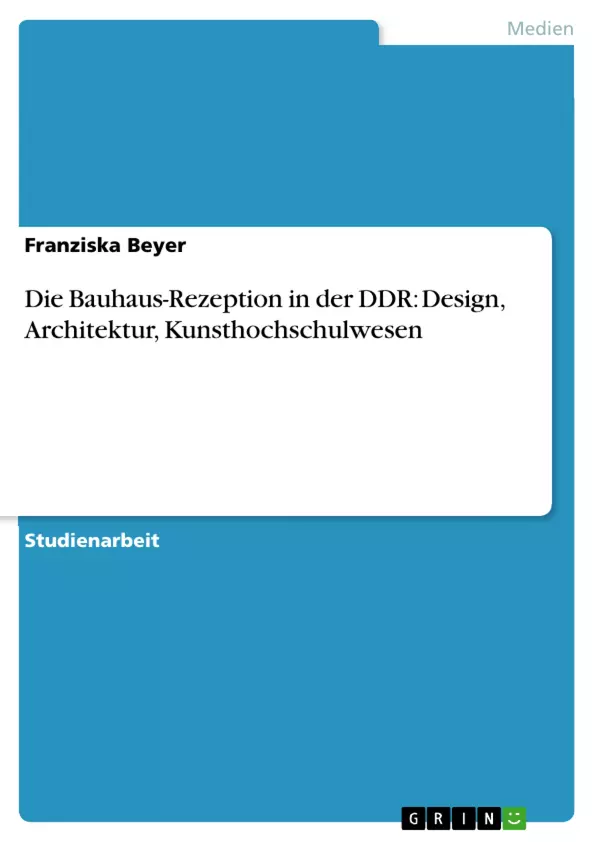Das Bauhaus ist in den vergangenen Jahren zu einem der populärsten
Forschungsthemen der deutschen und internationalen Kunsthistoriker avanciert. Dementsprechend groß ist der Bestand an Literatur zur Geschichte der Schule, den Dozenten und Fachbereiche. Die Ideen des Bauhauses haben dessen Einrichtung bis heute überlebt und wurden von seinen Vertretern und Schülern in die Welt getragen. Auch in der DDR haben solche Auffassungen Karriere gemacht und deutliche Spuren hinterlassen. Die Konzepte von Gropius, van der Rohe, Meyers und anderen haben Architektur, Design und Pädagogik so wesentlich beeinflusst, dass man bereits über jedes dieser Themen mehrere Bücher verfassen könnte. Allein: solche Bücher wurden noch nicht geschrieben. Der Anteil der Bauhaus-Literatur, der sich mit der DDR beschäftigt, ist verschwindend gering und zum größten Teil provokant-spielerisch oder rein monografisch in der Form.
Wer sich dennoch auf dieses Sujet einlässt, bemerkt, wie eng verstrickt die beteiligten Personen, Institutionen und Ereignisse sind, auch Disziplin übergreifend. Personen aus dem ehemaligen Bauhaus tauchten an Kunsthochschulen und in politisch markanten Ämtern auf. Wohnungen, welche neu gebaut wurden, wurden Trendgerecht eingerichtet. Diese Wechselbeziehungen sind der Grund für etliche Dopplungen, die in dieser Arbeit vorkommen mögen; wenn sie vorkommen, sind sie notwendig, um
Zusammenhänge besser zu beleuchten.
Die Bauhaus-Rezeption in der DDR lief auf weiten Strecken parallel zur politischen Entwicklung im Land und lässt sich in mehrere Phasen gliedern, die nahezu mit den einzelnen Jahrzehnten zusammen fallen und unübersehbar mit der jeweiligen wirtschaftlichen und kultur-politischen Situation im Land verquickt sind. Um nicht zu verwirren habe ich meine Abhandlung daher chronologisch gegliedert. Da die Bauhaus-Einflüsse in Ost-Deutschland wie bereits erwähnt umfassend waren, erhebt sie freilich keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern kann höchstens einen kurzen Abriss oder eine Übersicht über ein facettenreiches, umfangreiches Phänomen darstellen.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Das Bauhaus-Erbe in der Deutschen Demokratischen Republik
- An Kunsthochschulen
- Im Design
- In der Architektur
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Rezeption des Bauhauses in der DDR. Sie beleuchtet die Auswirkungen des Bauhauses auf Design, Architektur und das Kunsthochschulwesen in diesem Kontext. Die Arbeit verfolgt das Ziel, einen Überblick über die vielschichtigen Einflüsse des Bauhauses auf die Gestaltungskultur in der DDR zu geben.
- Die Auswirkungen des Bauhauses auf die Gestaltungskultur in der DDR
- Die Rolle des Bauhauses in der architektonischen Entwicklung der DDR
- Die Rezeption des Bauhauses an den Kunsthochschulen der DDR
- Die Bedeutung des Bauhauses für die Entwicklung des Designs in der DDR
- Die politische und ideologische Bedeutung des Bauhauses in der DDR
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas und die Forschungslücke dar. Sie erklärt die chronologische Gliederung der Arbeit und die Fokussierung auf die wichtigsten Einflussbereiche des Bauhauses in der DDR.
Kapitel 1 analysiert die vielfältigen Auswirkungen des Bauhauses auf die DDR. Es beleuchtet die Rezeption und Weiterentwicklung der Bauhaus-Ideen in den Bereichen Architektur, Design und Kunsthochschulwesen.
Schlüsselwörter
Bauhaus, DDR, Design, Architektur, Kunsthochschulwesen, Sozialistischer Realismus, Gropius, van der Rohe, Meyers, Formgestaltung, industrielle Bauweisen, Wohnungsbau, Bauhaus-Kolloquium, politische Entwicklung, kultur-politische Situation.
- Arbeit zitieren
- Franziska Beyer (Autor:in), 2006, Die Bauhaus-Rezeption in der DDR: Design, Architektur, Kunsthochschulwesen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/157916