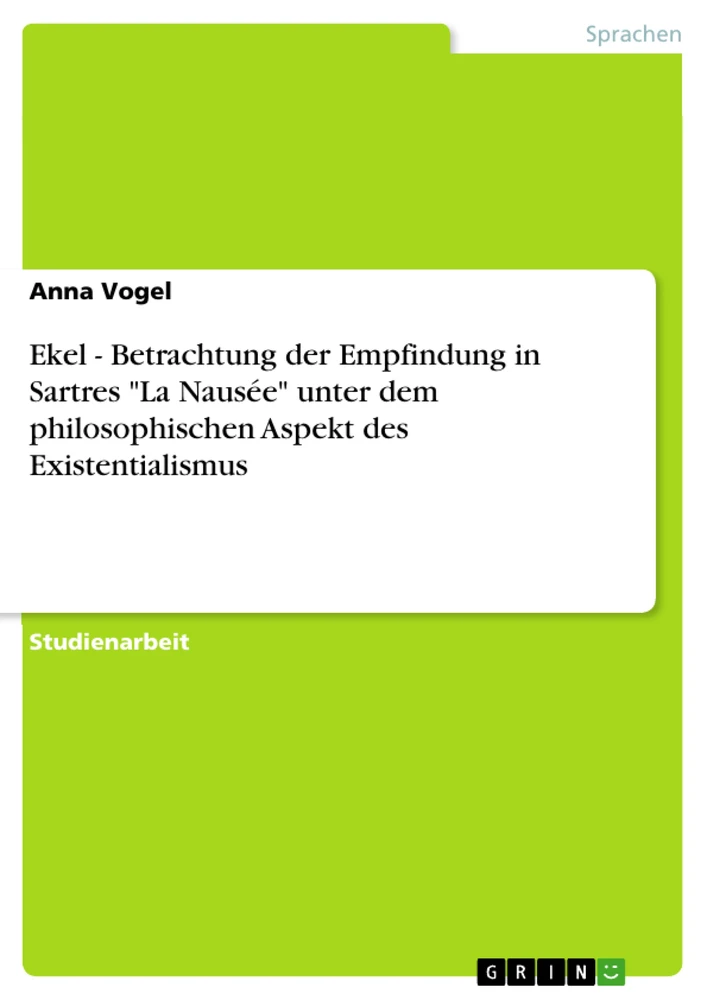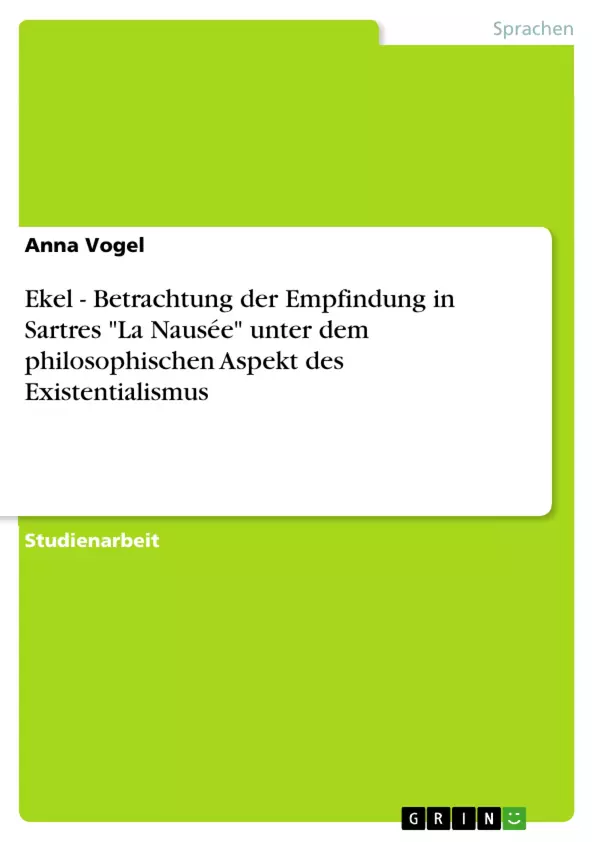In Sartres Roman La Nausée verwendet der Protagonist des Öfteren sowohl den Begriff nausée als auch den Ausdruck dégoût. Im Deutschen jedoch ist lediglich der Universalterminus “Ekel“ als Äquivalent gebräuchlich, weshalb nicht exakt zwischen den beiden französischen Begriffen differenziert werden kann. Dennoch ist anhand der wörtlichen Übersetzung eine leichte Differenz feststellbar: während nämlich der Begriff nausée wörtlich mit “Übelkeit“ und “Brechgefühl“ übersetzt wird und lediglich im übertragenen Sinn “Ekel“ bedeutet, bezeichnet der Terminus dégoût buchstäblich “Ekel“ und “Abscheu“. Der Protagonist hält sich also regelmäßig innerhalb des Bereichs des dégoût auf, des Ekels im eigentlichen Sinn, wenn er im Roman von nausée, von einer ihn überkommenden Übelkeit, spricht.
Der Begriff nausée findet sich in der Existenzphilosophie Sartres wieder und erlangt somit eine philosophische Komponente, während hingegen den Ekel konkret hervorrufende organische Aggregatzustände in die Kategorie des dégoût, des Ekels im allgemeinen Sinn, fallen. Fraglich ist nun, was genau der Protagonist letzten Endes unter nausée versteht, dem Gefühl, das ihn so oft überfällt und in dessen Kontext nicht selten das Gefühl der Angst steht.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Die Entwicklung des Ekels in Sartres La Nausée
- III. Schlussbemerkung
- IV. Résumé
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert das Gefühl des Ekels im Roman "La Nausée" von Jean-Paul Sartre im Kontext des Existentialismus. Sie betrachtet die Entwicklung dieses Gefühls bei dem Protagonisten Antoine Roquentin und beleuchtet die philosophischen Implikationen des Ekels im Rahmen der existentialistischen Philosophie Sartres.
- Der Ekel als Ausdruck der menschlichen Existenz und ihrer Grenzen
- Die Entfremdung von der Welt und den Objekten
- Die Rolle des Ekels im Prozess der Selbstfindung
- Der Ekel als Ausdruck der Absurdität der Existenz
- Die philosophische Bedeutung des Ekels in Sartres Werk
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung
Die Einleitung definiert den Begriff Ekel und untersucht seine Rolle in der menschlichen Wahrnehmung. Sie stellt die Verbindung zwischen dem Ekel und dem Existentialismus Sartres her und beleuchtet die Besonderheiten der französischen Begriffe "nausée" und "dégoût".
II. Die Entwicklung des Ekels in Sartres La Nausée
Dieses Kapitel untersucht die Entwicklung des Ekels bei dem Protagonisten Antoine Roquentin. Es wird die Entstehung des Gefühls des Ekels anhand von konkreten Beispielen aus dem Roman erläutert und die Auswirkungen des Ekels auf die Wahrnehmung der Welt durch Roquentin beschrieben.
Schlüsselwörter
Existentialismus, Ekel, La Nausée, Sartre, Entfremdung, Selbstfindung, Absurdität, "nausée", "dégoût", Wahrnehmung, Philosophie.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen "nausée" und "dégoût" bei Sartre?
"Nausée" (Übelkeit) hat eine philosophische Komponente im Existentialismus, während "dégoût" den konkreten, organischen Ekel im allgemeinen Sinn bezeichnet.
Wer ist der Protagonist in "La Nausée"?
Die Geschichte folgt Antoine Roquentin und seiner Wahrnehmung der Welt.
Was symbolisiert der Ekel im Kontext des Existentialismus?
Er ist ein Ausdruck der Absurdität der menschlichen Existenz, der Entfremdung von der Welt und der Erkenntnis der eigenen Freiheit.
Wie entwickelt sich das Gefühl des Ekels im Roman?
Der Ekel überkommt den Protagonisten oft im Kontakt mit Objekten und führt zu einer tiefgreifenden Veränderung seiner Selbst- und Weltwahrnehmung.
Welche Rolle spielt die Angst im Zusammenhang mit der Nausée?
Das Gefühl der Übelkeit steht oft in engem Kontext mit der existentiellen Angst vor der Sinnlosigkeit des Seins.
- Arbeit zitieren
- Anna Vogel (Autor:in), 2009, Ekel - Betrachtung der Empfindung in Sartres "La Nausée" unter dem philosophischen Aspekt des Existentialismus, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/157923