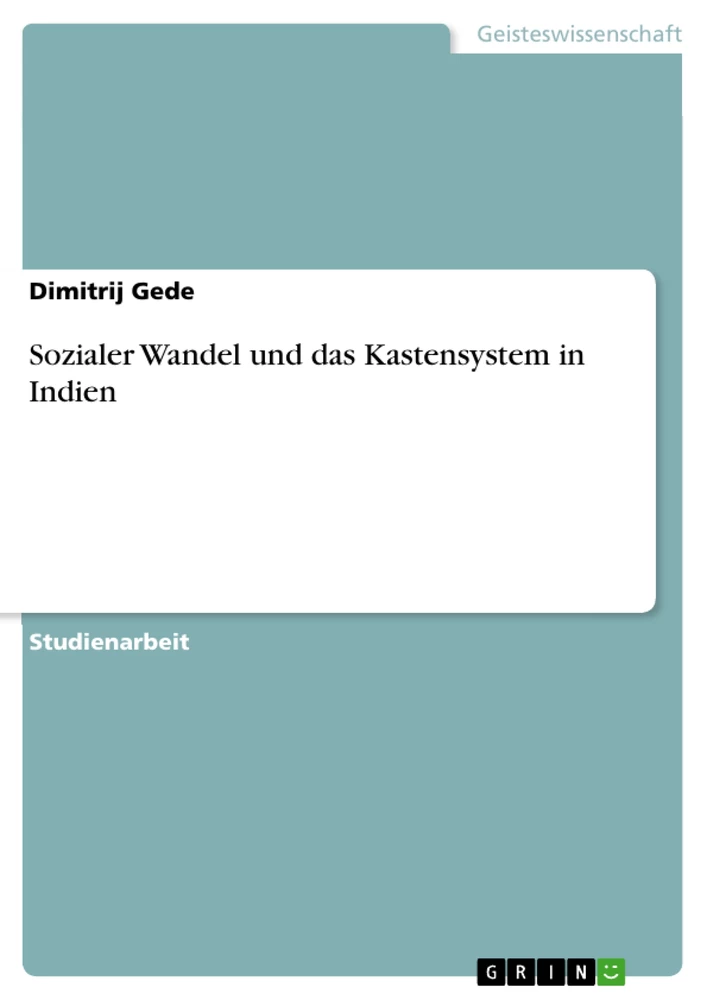1.) Einleitung
Auf dem indischen Subkontinent leben derzeit c.a. 1.112 Milliarden Einwohner, dessen Zahl jährlich um 1,4 % - das entspricht c.a. 15 Mio. Menschen – ansteigt.
Diese Einwohner unterscheiden sich nicht nur anhand ihrer Nationalität, sondern sie teilen sich auch, je nach Geburtsstand und Berufsgruppe hierarchisch in sogenannte Kasten auf.
Aber was sind diese Kasten eigentlich und wodurch unterscheiden sie sich?
Zunächst einmal muss differenziert werden in Kasten (Jati) und Stände (Varnas).
Es gibt vier bzw. fünf große Varnas und mehr als 200 Jatis
Die Varnas lassen sich Vergleichen mit dem europäischen Schichtsystem von Unter,- Mittel- und Oberschicht. Jatis sind die darin anzutreffenden Untergruppen, die überwiegend an ihren Geburtsorten, Familiengeschichten, Berufs- und Glaubensrichtungen klassifiziert werden.
Je heller die Hautfarbe eines Einwohners ist, desto höher ist die Stellung im hierarchischen System. Dies lässt sich darauf zurückführen, dass die europäischen Einwanderer eine hellere Hautfarbe als die indischen Ureinwohner hatten, von denen sie sich nach unten hin abgrenzen wollten und es auch heute noch tun .
Schneider definiert die Kaste als „eine auf realer Verwandtschaft basierende Gemeinschaft, in die der einzelne hineingeboren wird, die als solche anderen gleichartigen Gemeinschaften gegenüber steht und oft mit ihnen über riesige Flächen hinweg in Symbiose lebt.“
Bei Glasenapp findet sich ergänzend folgende Definition: „Diese Kasten […] sind endogame Gruppen von Personen, die ihren Ursprung auf eine bestimmte menschliche oder göttliche Persönlichkeit zurückführen und durch feste, vererbte Pflichten und Rechte, miteinander verbunden sind.“
Dies bedeutet jeder Hindu gehört vom Tag seiner Geburt einer ganz bestimmten Familie sowie deren Totengilde und Gottheit einer Jati an.
Inhaltsverzeichnis
- 1.) EINLEITUNG
- 2.) DARSTELLUNG DES KASTENSYSTEMS
- 2.1) GESETZE UND ABGRENZUNGEN
- 2.2) VOR- UND NACHTEILE DES KASTENSYSTEMS
- 3.) DARSTELLUNG DER VARNA
- 4.) DIE ENTSTEHUNG DES KASTENSYSTEMS AUF DEM INDISCHEN SUBKONTINENT
- 5.) DAS KASTENSYSTEM IM SOZIALEN WANDEL
- 5.1) DIE KASTE IM SOZIALEN WANDEL
- 6.) SCHLUSS
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das indische Kastensystem, seine historische Entwicklung und seinen Wandel im Kontext des sozialen Wandels in Indien. Das Ziel ist es, das komplexe System der Kasten und Stände zu erklären und seine Bedeutung für die indische Gesellschaft zu beleuchten.
- Die Definition und Unterscheidung von Kasten (Jati) und Ständen (Varna)
- Die hierarchische Struktur des Kastensystems und seine sozialen Auswirkungen
- Die Gesetze und Regeln, die die Kastenordnung aufrechterhalten
- Die Entstehung des Kastensystems auf dem indischen Subkontinent
- Der Einfluss des sozialen Wandels auf das Kastensystem
Zusammenfassung der Kapitel
1.) EINLEITUNG: Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die grundlegende Frage nach der Natur und den Unterschieden des indischen Kastensystems. Sie erwähnt die immense Bevölkerung Indiens und deren Aufteilung in hierarchische Kasten, basierend auf Geburt und Beruf, und hebt die Unterscheidung zwischen Jatis (Kasten) und Varnas (Stände) hervor. Die Einleitung legt den Grundstein für die detailliertere Auseinandersetzung mit dem Thema in den folgenden Kapiteln.
2.) DARSTELLUNG DES KASTENSYSTEMS: Dieses Kapitel beschreibt das Kastensystem detailliert. Es differenziert zwischen Jatis und Varnas, wobei Jatis als Untergruppen innerhalb der Varnas definiert werden, die durch Geburtsort, Familiengeschichte, Beruf und Religion bestimmt sind. Die Rolle der Hautfarbe in der Hierarchie wird ebenfalls angesprochen. Es werden verschiedene Definitionen des Kastensystems aus wissenschaftlicher Literatur vorgestellt und die Bemühungen der Hindu-Gemeinschaft, die Grenzen zwischen den Kasten aufrechtzuerhalten, werden betont.
3.) DARSTELLUNG DER VARNA: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die vier (oder fünf) Hauptgruppen der Varnas: Brahmanen (Priester), Kshatriyas (Krieger), Vaishyas (Kaufleute/Händler) und Shudras (Bauern), sowie die "Unberührbaren". Es wird die hierarchische Ordnung der Varnas beschrieben und ihre relative Stellung innerhalb des Gesamtsystems verdeutlicht. Die besondere Stellung der Asketen, die außerhalb der Kastenordnung stehen, wird ebenfalls erwähnt.
4.) DIE ENTSTEHUNG DES KASTENSYSTEMS AUF DEM INDISCHEN SUBKONTINENT: Dieses Kapitel befasst sich mit der historischen Entwicklung und den Ursprüngen des Kastensystems. (Anmerkung: Da der bereitgestellte Text keine Informationen zur Entstehung des Systems enthält, kann hier keine Zusammenfassung gegeben werden.)
5.) DAS KASTENSYSTEM IM SOZIALEN WANDEL: Dieses Kapitel analysiert den Einfluss des sozialen Wandels auf das Kastensystem. Es wird die Dynamik zwischen Tradition und Modernisierung im Kontext der Kastenordnung untersucht. (Anmerkung: Der bereitgestellte Text bietet zu diesem Thema nur einen Hinweis, eine detaillierte Zusammenfassung ist daher nicht möglich.)
Schlüsselwörter
Kastensystem, Indien, Jati, Varna, Brahmanen, Kshatriyas, Vaishyas, Shudras, Unberührbare, soziale Hierarchie, Hinduismus, soziale Ordnung, Endogamie, Reinheitsvorschriften, sozialer Wandel.
Häufig gestellte Fragen zum indischen Kastensystem
Was ist der Inhalt dieses Textes?
Dieser Text bietet einen umfassenden Überblick über das indische Kastensystem. Er beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und wichtige Schlüsselbegriffe. Der Fokus liegt auf der Beschreibung des Systems, der Unterscheidung zwischen Jatis (Kasten) und Varnas (Stände), sowie auf der Betrachtung des Einflusses des sozialen Wandels auf das Kastensystem.
Welche Kapitel umfasst der Text?
Der Text gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Darstellung des Kastensystems (inkl. Gesetze und Abgrenzungen sowie Vor- und Nachteile), Darstellung der Varna, Entstehung des Kastensystems auf dem indischen Subkontinent, Das Kastensystem im sozialen Wandel und Schlussfolgerung.
Was ist die Zielsetzung des Textes?
Der Text zielt darauf ab, das komplexe indische Kastensystem zu erklären, seine historische Entwicklung nachzuvollziehen und seinen Wandel im Kontext des sozialen Wandels in Indien zu beleuchten. Es geht um die Erläuterung der Bedeutung des Systems für die indische Gesellschaft.
Was sind die wichtigsten Themenschwerpunkte?
Die wichtigsten Themen sind die Definition und Unterscheidung von Jatis und Varnas, die hierarchische Struktur des Kastensystems und seine sozialen Auswirkungen, die Gesetze und Regeln zur Aufrechterhaltung der Kastenordnung, die Entstehung des Kastensystems und der Einfluss des sozialen Wandels darauf.
Wie werden Jatis und Varnas unterschieden?
Jatis sind Untergruppen innerhalb der Varnas. Jatis werden durch Geburtsort, Familiengeschichte, Beruf und Religion bestimmt, während Varnas die vier (oder fünf) Hauptgruppen darstellen: Brahmanen, Kshatriyas, Vaishyas, Shudras und die "Unberührbaren".
Welche Rolle spielt die Hautfarbe im Kastensystem?
Der Text erwähnt die Rolle der Hautfarbe in der Hierarchie des Kastensystems, ohne jedoch detailliert darauf einzugehen. Weitere Informationen wären in der vollständigen Arbeit zu finden.
Was wird in Kapitel 4 ("Entstehung des Kastensystems") behandelt?
Leider enthält der bereitgestellte Text keine Informationen zur Entstehung des Kastensystems. Daher kann dieses Kapitel im vorliegenden Auszug nicht zusammengefasst werden.
Was wird in Kapitel 5 ("Das Kastensystem im sozialen Wandel") behandelt?
Kapitel 5 analysiert den Einfluss des sozialen Wandels auf das Kastensystem und die Dynamik zwischen Tradition und Modernisierung im Kontext der Kastenordnung. Jedoch enthält der Auszug nur einen Hinweis auf dieses Thema, eine detaillierte Zusammenfassung ist daher nicht möglich.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Text?
Schlüsselwörter sind: Kastensystem, Indien, Jati, Varna, Brahmanen, Kshatriyas, Vaishyas, Shudras, Unberührbare, soziale Hierarchie, Hinduismus, soziale Ordnung, Endogamie, Reinheitsvorschriften, sozialer Wandel.
- Arbeit zitieren
- Dimitrij Gede (Autor:in), 2009, Sozialer Wandel und das Kastensystem in Indien, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/158010